| 50. |  Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz. Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz. Anderer Ereignisse und Attribute:
- Beruf / Beschäftigung: Babtistalrat (1423-1442)
Natalrat (1444-1477)
Bürgermeister (1441, 1442)
Vogt von Bülach (1425), Kyburg (1429 & 1432 - 1436), Andelfingen und Ossingen (1438, 1441 & 1442), Oberglatt (1447), Neuamt (1456).
Pfleger des Barfüsserkloster (1439 & 1446)
Tagsatzungsgesandter
Stadtsiegelhalter
- Besitz: Moosburg, Effretikon, Zürich, Schweiz; Johannes III wohnte von 1424 bis 1437 auf der Mossburg
- Ehrung: 31 Mai 1433, Tiberbrücke, Rom; Ritterschlag empfangen von Kaiser Sigismund.
- Besitz: 1435-1438, Burg Dübelstein, Dübendorf, Schweiz
Notizen:
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18103.php
Schwend, Johannes
1417 in Zürich erstmals erw., gestorben 17.2.1477 Zürich, von Zürich. Ritter. Sohn des Johannes ( -> 2). ∞ 1) Regula Glenter, Tochter des Jakob Glenter, 2) Anna Schön, Witwe des Götz, 3) Klara von Reischach. 1423-40 und 1442-77 Vertreter der Konstaffel im Kl. Rat, u.a. 1429 und 1433 Vogt von Kyburg, 1425-27 von Bülach und 1438-42 von Andelfingen, 1441 Bürgermeister. Während 50 Jahren bestimmte der sehr reiche S. die Politik Zürichs mit, von der Expansionspolitik vor dem Alten Zürichkrieg 1436-50 bis zur Integration in die Eidgenossenschaft nach der Jahrhundertmitte.
Literatur
– E. Diener, Die Zürcher Fam. S. c. 1250-1536, 1901
Autorin/Autor: Martin Lassner
Bürgermeister von Zürich
Die Schwend stellten in den frühen Jahren vier Bürgermeister für Zürich.
Rudolf I Schwend, 1384 bis 1390
Johannes III Schwend, 1441 & 1442
Heinrich I Schwend, 1442 & 1443
Konrad II Schwend, Mai 1489 bis 1499
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stadtpr%C3%A4sidenten_von_Z%C3%BCrich
Bürgermeister 1336–1798
Die Daten bezeichnen das Jahr der Ernennung. In der Regel übten die Bürgermeister ihr Amt bis zu ihrem Tod aus. In Zürich wurde im Ancien Régime das Rotationsprinzip angewendet: Zwei Bürgermeister wechselten sich im Amt halbjährlich ab.
Rudolf Brun, Winter 1336
Rüdiger Manesse, September 1360
Johannes Vink, 1384
Rudolf Sohwend, 1384
Rudolf Schön, 1390, entsetzt Juni 1393
Johannes Manesse, 1392
Heinrich Meiss, Juni 1393
Johannes Meyer von Knonau, 1393
Johannes Herter, 1409
Pantaleon ab Inkenberg, 1414
Jakob Glentner, 1415
Felix Manesse, 1427
Rudolf Stüssi, 1429
Rudolf Meiss, 1434
Jakob Schwarzmurer, 1439
Johannes Schwend, 1441
Heinrich Schwend, 1442
Johannes Keller, 1445
Rudolf von Cham, 1454
Heinrich Röist, 1469
Heinrich Göldli, 1475
Hans Waldmann, 1483
Konrad Schwend, Mai 1489
Felix Brennwald, Dezember 1489
Rudolf Escher, 1499
Matthias Wyss, 1502
Markus Röist, 1505
Felix Schmid, 1510
Heinrich Walder, 1524
Diethelm Röist, 1524
Johannes Haab, 1542
Joh. Rudolf Lavater, Dezember 1544
Georg Müller, 16. Januar 1557
Bernhard von Cham, 15. Juni 1560
Johannes Bräm, 13. Dezember 1567
Johannes Kambli, Ende April 1571
Kaspar Thomann, 30. Mai 1584
Konrad Grossmann, Ende Dezember 1590
Johannes Keller, 14. Dezember 1594
Heinrich Bräm, 12. Dezember 1601
Hans Rudolf Rahn, 12. Dezember 1607
Leonhard Holzhalb, 8. April 1609
Johann Heinrich Holzhalb, 14. April 1617
Heinrich Bräm, 15. Dezember 1627
Salomon Hirzel, 10. Mai 1637
Hans Rudolf Rahn, 8. Oktober 1644
Johann Heinrich Waser, 28. Juni 1652
Johann Heinrich Rahn, 13. November 1655
Johann Kaspar Hirzel, 11. Februar 1669
Johann Konrad Grebel, 23. September 1669
Sigmund Spöndli, 23. April 1674
Heinrich Escher, 22. Juni 1678
Johann Caspar Escher vom Glas, 4. Juni 1691
Andreas Meyer, 16. Januar 1696
Johann Ludwig Hirzel, 22. April 1710
David Holzhalb, 7. Mai 1710
Hans Jakob Escher, 13. April 1711
Johann Jakob Ulrich, 20. November 1719
Johann Heinrich Hirzel, 1. März 1723
Johannes Hofmeister, 20. Mai 1734
Hans Kaspar Escher, 17. März 1740
Johannes Fries, 3. Januar 1742
Hans Jakob Leu, 16. Mai 1759
Johann Kaspar Landolt, 27. Dezember 1762
Hans Konrad Heidegger, 12. November 1768
Johann Heinrich von Orelli, 4. Mai 1778
Johann Heinrich Landolt, 17. August 1778
Johann Heinrich Ott, 20. November 1780
Heinrich Kilchsperger, 5. Juli 1785
David von Wyss, 20. Juni 1795, res. 12. März 1798
Bürgermeister 1803–1869
Der Titel eines Bürgermeisters wurde seit 1803 für den Vorsteher der kantonalen Regierung verwendet. Das Amt wurde kollegial von zwei Mitgliedern des Regierungsrates bekleidet, die sich als Amtsbürgermeister im Jahresturnus abwechselten.
Hans von Reinhard, 21. April 1803
Johann Konrad von Escher, 21. April 1803
Hans Konrad von Escher, 24. Juni 1814
David von Wyss, 16. Dezember 1814
Paul Usteri, 25. März 1831 (vor Amtsantritt verstorben)
Hans Konrad von Muralt, 13. April 1831
Conrad Melchior Hirzel, 20. März 1832
Johann Jakob Hess, 20. März 1832
Hans Konrad von Muralt, 1839–1844
Johann Heinrich Mousson, 1840–1845
Hans Ulrich Zehnder, 1844–1850 (bis 1866 im Regierungsrat)
Jonas Furrer, 1845–1848
Alfred Escher, 1848–1850 (bis 1855 im Regierungsrat)
1850 ging die Regierung im Kanton Zürich vom Kollegial zum Departementalsystem über und die Würde eines Bürgermeisters wurde zugunsten eines jährlich wechselnden Präsidiums des Regierungsrates abgeschafft.
Stadtpräsidenten ab 1803
Mit der Verfassungsänderung von 1869 tritt der Präsident des Regierungsrates an die Spitze der Zürcher Regierung. Die Stadt Zürich wird als Gemeinde des Kantons Zürich seit 1803 von einem Stadtpräsidenten geleitet.
Liste der Stadtpräsidenten von Zürich (Jahr der Wahl)
Hans Konrad Escher, 1803
Hans Rudolf Werdmüller, 1804
Hans Heinrich Landolt, 1810
Hans Georg Finsler, 1815
Hans Konrad Vogel, 1821
Georg Konrad Bürkli, 1831
Hans Jakob Escher, 1831
Paul Carl Eduard Ziegler, 1837
Johann Ludwig Hess, 1840
Johann Heinrich Mousson, 1863
Melchior Römer, 1869
Hans Konrad Pestalozzi, 1889
Robert Billeter (FDP), 1909
Hans Nägeli (Demokraten), 1917
Emil Klöti (SP), 1928
Ernst Nobs (SP), 1942
Adolf Lüchinger (SP), 1944
Emil Landolt (FDP), 1949
Sigmund Widmer (LdU) 1966
Thomas Wagner (FDP), 1982
Josef Estermann (SP), 1990
Elmar Ledergerber (SP), 2002
Corine Mauch (SP), 2009
Johannes heiratete Regula Glenter in Datum unbekannt. Regula (Tochter von Jakob Glenter und Margaretha Keller) gestorben in nach 1418. [Familienblatt] [Familientafel]
|

 Maria Pfyffer von Altishofen (Tochter von Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen und Jacobea Segesser von Brunegg).
Maria Pfyffer von Altishofen (Tochter von Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen und Jacobea Segesser von Brunegg). 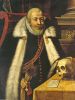 Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen wurde geboren in 1524 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Leodegar Pfyffer und Elisabeth Kiehl); gestorben am 17 Mrz 1594 in Luzern, LU, Schweiz.
Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen wurde geboren in 1524 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Leodegar Pfyffer und Elisabeth Kiehl); gestorben am 17 Mrz 1594 in Luzern, LU, Schweiz.  Jacobea Segesser von Brunegg (Tochter von Johann Bernhard Segesser von Brunegg und Margareta von Münsingen ?).
Jacobea Segesser von Brunegg (Tochter von Johann Bernhard Segesser von Brunegg und Margareta von Münsingen ?).  Leodegar Pfyffer (Sohn von Johannes Pfyffer und Anna zur Tannen).
Leodegar Pfyffer (Sohn von Johannes Pfyffer und Anna zur Tannen).  Johann Bernhard Segesser von Brunegg (Sohn von Hans Ulrich III Segesser von Brunegg und Veronika von Silenen).
Johann Bernhard Segesser von Brunegg (Sohn von Hans Ulrich III Segesser von Brunegg und Veronika von Silenen).  Johannes Pfyffer wurde geboren in Rothenburg, LU, Schweiz.
Johannes Pfyffer wurde geboren in Rothenburg, LU, Schweiz.  Veronika von Silenen (Tochter von Ritter Albin von Silenen und Verena Netstaler).
Veronika von Silenen (Tochter von Ritter Albin von Silenen und Verena Netstaler).  Hans Ulrich I Segesser wurde geboren in Mellingen, AG, Schweiz (Sohn von Johann Segesser (Segenser) und Verena von Birchdorf (von Birchidorf)); gestorben in kurz vor 12 Jan 1457.
Hans Ulrich I Segesser wurde geboren in Mellingen, AG, Schweiz (Sohn von Johann Segesser (Segenser) und Verena von Birchdorf (von Birchidorf)); gestorben in kurz vor 12 Jan 1457.  Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz.
Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz.  Regula Glenter (Tochter von Jakob Glenter und Margaretha Keller); gestorben in nach 1418.
Regula Glenter (Tochter von Jakob Glenter und Margaretha Keller); gestorben in nach 1418.  Christof von Silenen (Sohn von Arnold von Silenen und Verena von Hunwil); gestorben in nach 1445 in Küssnacht.
Christof von Silenen (Sohn von Arnold von Silenen und Verena von Hunwil); gestorben in nach 1445 in Küssnacht.  Isabelle de Chevron-Villette (Tochter von Jean de Chevron-Villette und Perronnette de la Bastie (Bâtiaz)).
Isabelle de Chevron-Villette (Tochter von Jean de Chevron-Villette und Perronnette de la Bastie (Bâtiaz)).  Anna Elisabetha von Moos (Tochter von Heinrich von Moos).
Anna Elisabetha von Moos (Tochter von Heinrich von Moos).