
| 1. | 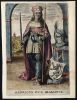 Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) wurde geboren in cir 1165 (Sohn von Gottfried III. von Löwen und Margarete von Limburg); gestorben am 5 Sep 1235 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) wurde geboren in cir 1165 (Sohn von Gottfried III. von Löwen und Margarete von Limburg); gestorben am 5 Sep 1235 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Brabant) Heinrich heiratete Mathilda von Elsass (von Flandern) in 1179. Mathilda (Tochter von Graf Matthäus von Elsass (von Flandern) und Gräfin Maria von Boulogne (von Blois)) wurde geboren in 1170; gestorben am 16 Okt 1210. [Familienblatt] [Familientafel] Notizen: Kinder von Heinrich und Mathilde waren:Kinder:
Heinrich heiratete Prinzessin Maria von Frankreich in 1213. Maria wurde geboren in 1198; gestorben in 1224. [Familienblatt] [Familientafel] Notizen: Kinder von Heinrich und Maria waren: |
| 2. |  Gottfried III. von Löwen (Sohn von Graf Gottfried II. von Löwen und Luitgard von Sulzbach); gestorben am 11/12 Aug 1190. Gottfried III. von Löwen (Sohn von Graf Gottfried II. von Löwen und Luitgard von Sulzbach); gestorben am 11/12 Aug 1190. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_III._(Löwen) Gottfried + Margarete von Limburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. |  Margarete von Limburg (Tochter von Herzog Heinrich II. von Limburg und Mathilde von Saffenberg). Margarete von Limburg (Tochter von Herzog Heinrich II. von Limburg und Mathilde von Saffenberg).
|
| 4. |  Graf Gottfried II. von Löwen wurde geboren in cir 1110 (Sohn von Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige und Ida von Chiny); gestorben am 13 Jun 1142. Graf Gottfried II. von Löwen wurde geboren in cir 1110 (Sohn von Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige und Ida von Chiny); gestorben am 13 Jun 1142. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_II._(Löwen) Gottfried + Luitgard von Sulzbach. Luitgard (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)) gestorben in nach 1163. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. |  Luitgard von Sulzbach (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)); gestorben in nach 1163. Luitgard von Sulzbach (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)); gestorben in nach 1163.
|
| 6. |  Herzog Heinrich II. von Limburg wurde geboren in cir 1110 (Sohn von Walram III. von Limburg und Judith (Jutta) von Wassenberg); gestorben in Aug 1167 in bei Rom. Herzog Heinrich II. von Limburg wurde geboren in cir 1110 (Sohn von Walram III. von Limburg und Judith (Jutta) von Wassenberg); gestorben in Aug 1167 in bei Rom. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Limburg) Heinrich heiratete Mathilde von Saffenberg in cir 1135. Mathilde wurde geboren in cir 1120; gestorben am 2 Jan 1145. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Mathilde von Saffenberg wurde geboren in cir 1120; gestorben am 2 Jan 1145.
|
| 8. |  Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige wurde geboren in cir 1063 (Sohn von Graf Heinrich II. von Löwen und Adelheid von Betuwe); gestorben am 25 Jan 1139; wurde beigesetzt in Affligem. Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige wurde geboren in cir 1063 (Sohn von Graf Heinrich II. von Löwen und Adelheid von Betuwe); gestorben am 25 Jan 1139; wurde beigesetzt in Affligem. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_VI._(Niederlothringen) Gottfried heiratete Ida von Chiny in cir 1105. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Ida von Chiny (Tochter von Otto II. von Chiny und Alix von Namur). Notizen: Es ist nicht klar welche der zwei Gattinen des Otto II.die Mutter von Ida ist.
|
| 10. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_I._von_Sulzbach Berengar + Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen). Adelheid (Tochter von Kuno von Frontenhausen) wurde beigesetzt in Kloster Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. |  Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen) (Tochter von Kuno von Frontenhausen); wurde beigesetzt in Kloster Baumburg. Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen) (Tochter von Kuno von Frontenhausen); wurde beigesetzt in Kloster Baumburg. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Megling-Frontenhausen
|
| 12. |  Walram III. von Limburg wurde geboren in cir 1085 (Sohn von Herzog Heinrich I. von Limburg (von Arlon) und von Arlon); gestorben am 16 Jul 1139. Walram III. von Limburg wurde geboren in cir 1085 (Sohn von Herzog Heinrich I. von Limburg (von Arlon) und von Arlon); gestorben am 16 Jul 1139. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_III._(Limburg) Walram + Judith (Jutta) von Wassenberg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Notizen: Name: Notizen: Ihre Kinder waren:
|
| 16. |  Graf Heinrich II. von Löwen wurde geboren in cir 1020 (Sohn von Lambert II. von Löwen und Oda von Verdun); gestorben in 1078 in Nivelles, Belgien. Graf Heinrich II. von Löwen wurde geboren in cir 1020 (Sohn von Lambert II. von Löwen und Oda von Verdun); gestorben in 1078 in Nivelles, Belgien. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Löwen) (Okt 2017) Heinrich + Adelheid von Betuwe. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. |  Adelheid von Betuwe (Tochter von Graf Eberhard von Betuwe). Adelheid von Betuwe (Tochter von Graf Eberhard von Betuwe). Notizen: Gründerin des Klosters Affligem Notizen: Ihre Kinder waren:
|
| 18. | Otto II. von Chiny gestorben in Dez 1131. Otto + Alix von Namur. Alix (Tochter von Graf Albert III. von Namur und Herzogin Ida von Sachsen?) gestorben in cir 1124. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Alix von Namur (Tochter von Graf Albert III. von Namur und Herzogin Ida von Sachsen?); gestorben in cir 1124.
|
| 20. |  Graf Gebhard I. (II.) von Sulzbach wurde geboren in 1043 (Sohn von Graf Berengar von Sulzbach (im Nordgau) und Adelheid); gestorben in 1085. Graf Gebhard I. (II.) von Sulzbach wurde geboren in 1043 (Sohn von Graf Berengar von Sulzbach (im Nordgau) und Adelheid); gestorben in 1085. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sulzbach_(Adelsgeschlecht) Gebhard + Irmgard von Rott. Irmgard (Tochter von Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) und Uta von Regensburg (III. von Diessen)) gestorben am 14 Jun 1101. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. |  Irmgard von Rott (Tochter von Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) und Uta von Regensburg (III. von Diessen)); gestorben am 14 Jun 1101. Irmgard von Rott (Tochter von Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) und Uta von Regensburg (III. von Diessen)); gestorben am 14 Jun 1101. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_von_Rott
|
| 22. |  Kuno von Frontenhausen Kuno von Frontenhausen
|
| 24. |  Herzog Heinrich I. von Limburg (von Arlon) (Sohn von Graf Walram II. (Udo) von Arlon und Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen)); gestorben in 1119. Herzog Heinrich I. von Limburg (von Arlon) (Sohn von Graf Walram II. (Udo) von Arlon und Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen)); gestorben in 1119. Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Limburg) Heinrich + von Arlon. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | von Arlon (Tochter von Graf Walram II. von Arlon und Judith von Niederlothringen). Notizen: Name: Notizen: Die Kinder Heinrich – aus welcher Ehe auch immer – waren 1 Sohn und 3 Töchter:
|
| 26. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_III._von_Wassenberg (Jun 2021)
|
| 32. |  Lambert II. von Löwen (Sohn von Graf Lambert I. von Löwen (Hennegau), und Gerberga von Niederlothringen); gestorben am 19 Jun 1054. Lambert II. von Löwen (Sohn von Graf Lambert I. von Löwen (Hennegau), und Gerberga von Niederlothringen); gestorben am 19 Jun 1054. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Lambert_II._(Löwen) (Okt 2017) Lambert + Oda von Verdun. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. |  Oda von Verdun (Tochter von Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse und Ermengarde von Lothringen). Oda von Verdun (Tochter von Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse und Ermengarde von Lothringen). Notizen: Außer seinem Erben Heinrich II. hatte Lambert einen Sohn Rainer/Reginar (X 1077 im Haspengau) sowie eine Tochter Gerberga.
|
| 34. | Graf Eberhard von Betuwe
|
| 38. |  Graf Albert III. von Namur (Sohn von Graf Albert II. von Namur und Herzogin Reginlinde von Niederlothringen); gestorben am 22 Jun 1102. Graf Albert III. von Namur (Sohn von Graf Albert II. von Namur und Herzogin Reginlinde von Niederlothringen); gestorben am 22 Jun 1102. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_III,_Count_of_Namur Albert heiratete Herzogin Ida von Sachsen? in cir 1065. Ida (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) wurde geboren in cir 1035; gestorben am 31 Jul 1102. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 39. | Herzogin Ida von Sachsen? wurde geboren in cir 1035 (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt); gestorben am 31 Jul 1102. Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ida_de_Saxe
|
| 40. |  Graf Berengar von Sulzbach (im Nordgau) wurde geboren in cir 1007. Graf Berengar von Sulzbach (im Nordgau) wurde geboren in cir 1007. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Berengar + Adelheid. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Adelheid
|
| 42. |  Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) wurde geboren in cir 1015 (Sohn von Poppo von Chiemgau und Hazaga von Kärnten); gestorben in an einem 27 Mär spätestens 1086. Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) wurde geboren in cir 1015 (Sohn von Poppo von Chiemgau und Hazaga von Kärnten); gestorben in an einem 27 Mär spätestens 1086. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuno_I._von_Rott Kuno + Uta von Regensburg (III. von Diessen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | Uta von Regensburg (III. von Diessen) (Tochter von Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen) und Hadamut von Eppenstein). Notizen: Kuno war verheiratet mit einer Uta, von der vermutet wird, dass sie die Tochter des Grafen Friedrich II. († 1075) von Dießen-Andechs gewesen sein könnte. ?
|
| 48. |  Graf Walram II. (Udo) von Arlon wurde geboren in cir 998/1000; gestorben in vor 1082. Graf Walram II. (Udo) von Arlon wurde geboren in cir 998/1000; gestorben in vor 1082. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_II._(Arlon) Walram + Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 49. |  Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen) (Tochter von Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen) und Gerberga von Boulogne). Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen) (Tochter von Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen) und Gerberga von Boulogne). Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Limburg
|
| 50. | Graf Walram II. von Arlon (Sohn von Graf Walram I. von Arlon und Adelheid (Adele) von Oberlothringen (von Bar)); gestorben in vor 1082. Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_II._(Arlon) Walram + Judith von Niederlothringen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. | Judith von Niederlothringen Notizen: Name:
|
| 52. | Dietrich I. (Flamenses) Hennegau (Sohn von Elias ? und Beatrix ?). Notizen: Name:
|