
| 1. | Rudolf II. von Vermandois (von Frankreich), der Aussätzige wurde geboren in 1145/47 (Sohn von Rudolf I. von Vermandois (von Frankreich), der Tapfere, der Einäugige und Aélis (Petronilla) von Aquitanien); gestorben in 1167. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Rudiolf II. zog sich um 1163 die Lepra zu und seine noch nicht vollzogene Ehe mit Margarete wurde aufgelöst. Rudolf heiratete Gräfin Margarete I. von Elsass (von Flandern) in cir 1160. Margarete (Tochter von Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) und Sibylle von Anjou-Château-Landon) wurde geboren in cir 1145; gestorben am 15 Nov 1194 in Schloss Male bei Brügge; wurde beigesetzt in Kirche Sainte-Waudru in Mons. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 2. |  Rudolf I. von Vermandois (von Frankreich), der Tapfere, der Einäugige wurde geboren in 1085 (Sohn von Hugo von Vermandois (von Frankreich) und Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger)); gestorben am 14 Okt 1152. Rudolf I. von Vermandois (von Frankreich), der Tapfere, der Einäugige wurde geboren in 1085 (Sohn von Hugo von Vermandois (von Frankreich) und Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger)); gestorben am 14 Okt 1152. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Vermandois) Rudolf heiratete Aélis (Petronilla) von Aquitanien in cir 1142, und geschieden in ? 1151. Aélis (Tochter von Herzog Wilhelm X. von Aquitanien (von Poitou) und Eleonore von Châtellerault) gestorben in nach 24 Okt 1153. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Aélis (Petronilla) von Aquitanien (Tochter von Herzog Wilhelm X. von Aquitanien (von Poitou) und Eleonore von Châtellerault); gestorben in nach 24 Okt 1153.
|
| 4. |  Hugo von Vermandois (von Frankreich) wurde geboren in 1057 (Sohn von Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) und Anna von Kiew (Rurikiden)); gestorben am 18 Okt 1101. Hugo von Vermandois (von Frankreich) wurde geboren in 1057 (Sohn von Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) und Anna von Kiew (Rurikiden)); gestorben am 18 Okt 1101. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Vermandois Hugo heiratete Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger) in 1078. Adelheid (Tochter von Heribert IV. von Vermandois und Adele von Valois) wurde geboren in 1065; gestorben am 28 Sep 1120/1124. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. |  Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger) wurde geboren in 1065 (Tochter von Heribert IV. von Vermandois und Adele von Valois); gestorben am 28 Sep 1120/1124. Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger) wurde geboren in 1065 (Tochter von Heribert IV. von Vermandois und Adele von Valois); gestorben am 28 Sep 1120/1124.
|
| 6. |  Herzog Wilhelm X. von Aquitanien (von Poitou) wurde geboren in 1099 in Toulouse (Sohn von Herzog Wilhelm VII. (IX.) Aquitanien Aquitanien (von Poitou) und Gräfin Philippa von Toulouse (Raimundiner)); gestorben am 9 Apr 1137. Herzog Wilhelm X. von Aquitanien (von Poitou) wurde geboren in 1099 in Toulouse (Sohn von Herzog Wilhelm VII. (IX.) Aquitanien Aquitanien (von Poitou) und Gräfin Philippa von Toulouse (Raimundiner)); gestorben am 9 Apr 1137. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_X._(Aquitanien) (Okt 2017) Wilhelm + Eleonore von Châtellerault. Eleonore gestorben am nach Mrz 1130. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. |  Eleonore von Châtellerault gestorben am nach Mrz 1130. Eleonore von Châtellerault gestorben am nach Mrz 1130. Notizen: Name: Notizen: Eleonore und Wilhelm X. hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter:
|
| 8. |  Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) wurde geboren in 1008 (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)); gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) wurde geboren in 1008 (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)); gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Frankreich) Heinrich heiratete Anna von Kiew (Rurikiden) am 19 Mai 1051. Anna (Tochter von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden) wurde geboren in zw 1024 und 1035. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. |  Anna von Kiew (Rurikiden) wurde geboren in zw 1024 und 1035 (Tochter von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden). Anna von Kiew (Rurikiden) wurde geboren in zw 1024 und 1035 (Tochter von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden). Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Kiew
|
| 10. |  Heribert IV. von Vermandois wurde geboren in cir 1032 (Sohn von Otto (Eudes) von Vermandois und Pavia N.); gestorben in cir 1080. Heribert IV. von Vermandois wurde geboren in cir 1032 (Sohn von Otto (Eudes) von Vermandois und Pavia N.); gestorben in cir 1080. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_IV._(Vermandois) Heribert heiratete Adele von Valois in vor 1068. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. |  Adele von Valois (Tochter von Rudolf III. (IV.) von Valois (von Vexin) und Adele von Bar-sur-Aube). Adele von Valois (Tochter von Rudolf III. (IV.) von Valois (von Vexin) und Adele von Bar-sur-Aube).
|
| 12. |  Herzog Wilhelm VII. (IX.) Aquitanien Aquitanien (von Poitou) wurde geboren am 22 Okt 1071 (Sohn von Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) und Hildegard von Burgund); gestorben am 10 Feb 1126. Herzog Wilhelm VII. (IX.) Aquitanien Aquitanien (von Poitou) wurde geboren am 22 Okt 1071 (Sohn von Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) und Hildegard von Burgund); gestorben am 10 Feb 1126. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_IX._(Aquitanien) (Okt 2017) Wilhelm + Gräfin Philippa von Toulouse (Raimundiner). Philippa (Tochter von Graf Wilhelm IV. von Toulouse (Raimundiner) und Emma von Mortain) wurde geboren in cir 1073; gestorben am 28 Nov 1118 in Abbaye Fontevrault. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. |  Gräfin Philippa von Toulouse (Raimundiner) wurde geboren in cir 1073 (Tochter von Graf Wilhelm IV. von Toulouse (Raimundiner) und Emma von Mortain); gestorben am 28 Nov 1118 in Abbaye Fontevrault. Gräfin Philippa von Toulouse (Raimundiner) wurde geboren in cir 1073 (Tochter von Graf Wilhelm IV. von Toulouse (Raimundiner) und Emma von Mortain); gestorben am 28 Nov 1118 in Abbaye Fontevrault. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippa_von_Toulouse (Aug 2023) Notizen: 2. Aus ihrer Ehe mit Wilhelm IX. von Aquitanien hatte Philippa zwei Söhne und fünf Töchter:
|
| 16. |  König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme wurde geboren am 27 Mrz 972 (Sohn von König Hugo Capet (Kapetinger) und Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien)); gestorben am 20 Jul 1031 in Melun. König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme wurde geboren am 27 Mrz 972 (Sohn von König Hugo Capet (Kapetinger) und Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien)); gestorben am 20 Jul 1031 in Melun. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Frankreich) Robert heiratete Königin Konstanze von der Provence (von Arles) in 1003. Konstanze (Tochter von Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier und Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou) wurde geboren in 986; gestorben am 25 Jul 1034 in Melun oder Senlis; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. |  Königin Konstanze von der Provence (von Arles) wurde geboren in 986 (Tochter von Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier und Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou); gestorben am 25 Jul 1034 in Melun oder Senlis; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. Königin Konstanze von der Provence (von Arles) wurde geboren in 986 (Tochter von Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier und Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou); gestorben am 25 Jul 1034 in Melun oder Senlis; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. Notizen: Konstanze hatte mit Robert II. sieben Kinder, drei Töchter und vier Söhne. Notizen: Aus Roberts dritter Ehe mit Konstanze von der Provence gingen sieben Kinder hervor:
|
| 18. |  Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise wurde geboren in 978 (Sohn von Grossfürst Wladimir I. von Kiew (Rurikiden), der Grosse und Prinzessin Rogneda von Polotzk, die Kummervolle ); gestorben am 20 Feb 1054 in Wyschegorod; wurde beigesetzt in Kiew. Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise wurde geboren in 978 (Sohn von Grossfürst Wladimir I. von Kiew (Rurikiden), der Grosse und Prinzessin Rogneda von Polotzk, die Kummervolle ); gestorben am 20 Feb 1054 in Wyschegorod; wurde beigesetzt in Kiew. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jaroslaw_der_Weise Jaroslaw heiratete Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden in 1019. Ingegerd (Tochter von Olof Skötkonung von Schweden und Estrid (Obodritin)) wurde geboren in 1001; gestorben am 10 Feb 1050. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden wurde geboren in 1001 (Tochter von Olof Skötkonung von Schweden und Estrid (Obodritin)); gestorben am 10 Feb 1050. Notizen: Ingegerd und Jaroslaw hatten acht Kinder, fünf Söhne und drei Töchter.
|
| 20. |  Otto (Eudes) von Vermandois wurde geboren am 29 Aug 979 (Sohn von Herbert III. von Vermandois und Ermengard N.); gestorben am 25 Mai 1045. Otto (Eudes) von Vermandois wurde geboren am 29 Aug 979 (Sohn von Herbert III. von Vermandois und Ermengard N.); gestorben am 25 Mai 1045. Otto + Pavia N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. | Pavia N.
|
| 22. |  Rudolf III. (IV.) von Valois (von Vexin) (Sohn von Rudolf II. von Valois und Adèle de Breteuil); gestorben am 23 Feb 1074 in Péronne. Rudolf III. (IV.) von Valois (von Vexin) (Sohn von Rudolf II. von Valois und Adèle de Breteuil); gestorben am 23 Feb 1074 in Péronne. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV._(Vexin) (Okt 2017) Rudolf + Adele von Bar-sur-Aube. Adele (Tochter von Graf Notker III. von Bar-sur-Aube) gestorben in 1053. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Adele von Bar-sur-Aube (Tochter von Graf Notker III. von Bar-sur-Aube); gestorben in 1053. Notizen: Die Kinder aus seiner ersten Ehe des Rudolf mit Adele:
|
| 24. |  Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) wurde geboren in cir 1025 (Sohn von Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse und Gräfin Agnes von Burgund); gestorben am 25 Sep 1086. Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) wurde geboren in cir 1025 (Sohn von Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse und Gräfin Agnes von Burgund); gestorben am 25 Sep 1086. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_VIII._(Aquitanien) (Okt 2017) Wilhelm heiratete Hildegard von Burgund am 1068 / 1069. Hildegard (Tochter von Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte und Ermengarde von Anjou) gestorben in cir 1120. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Hildegard von Burgund (Tochter von Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte und Ermengarde von Anjou); gestorben in cir 1120. Notizen: Nachkommen:
|
| 26. |  Graf Wilhelm IV. von Toulouse (Raimundiner) wurde geboren in cir 1040 (Sohn von Graf Pons von Toulouse (Raimundiner) und Almodis de la Marche); gestorben in 1094. Graf Wilhelm IV. von Toulouse (Raimundiner) wurde geboren in cir 1040 (Sohn von Graf Pons von Toulouse (Raimundiner) und Almodis de la Marche); gestorben in 1094. Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_IV._(Toulouse) (Aug 2023) Wilhelm + Emma von Mortain. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. |  Emma von Mortain (Tochter von Graf Robert von Mortain (Conteville), 1. Earl of Cornwall und Mathilde de Montgommery). Emma von Mortain (Tochter von Graf Robert von Mortain (Conteville), 1. Earl of Cornwall und Mathilde de Montgommery). Notizen: Aus dieser Ehe ging als einziges überlebendes Kind die Tochter Philippa hervor.
|
| 32. |  König Hugo Capet (Kapetinger) wurde geboren am 940 od 941 (Sohn von Herzog Hugo von Franzien, der Grosse und Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen)); gestorben am 24 Okt 996 in Les Juifs, Chartres, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. König Hugo Capet (Kapetinger) wurde geboren am 940 od 941 (Sohn von Herzog Hugo von Franzien, der Grosse und Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen)); gestorben am 24 Okt 996 in Les Juifs, Chartres, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capet Hugo + Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien). Adelheid (Tochter von Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf und Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie) wurde geboren in cir 950; gestorben in 1004. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. |  Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien) wurde geboren in cir 950 (Tochter von Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf und Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie); gestorben in 1004. Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien) wurde geboren in cir 950 (Tochter von Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf und Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie); gestorben in 1004. Notizen: Adelheid hatte mit Hugo Capet vier Kinder. Notizen: Mit Adelheid hatte Hugo einen Sohn, den Thronfolger, und drei Töchter:
|
| 34. |  Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier (Sohn von Graf Boso II. von der Provence (von Arles) und Konstanze von Vienne (Buviniden)); gestorben in 993. Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier (Sohn von Graf Boso II. von der Provence (von Arles) und Konstanze von Vienne (Buviniden)); gestorben in 993. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Provence) Wilhelm heiratete Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou in zw 984 und 986. Adélaide (Tochter von Graf Fulko II. von Anjou, der Gute und Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden)) gestorben in 1026. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. |  Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou (Tochter von Graf Fulko II. von Anjou, der Gute und Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden)); gestorben in 1026. Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou (Tochter von Graf Fulko II. von Anjou, der Gute und Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden)); gestorben in 1026. Notizen: Geburt: Notizen: Adelheid und Wilhelm I. hatten zwei oder drei Töchter.
|
| 36. |  Grossfürst Wladimir I. von Kiew (Rurikiden), der Grosse (Sohn von Grossfürst Swjatislaw I. von Kiew (Rurikiden) und Maluschka); gestorben am 15 Jul 1015 in Berestow. Grossfürst Wladimir I. von Kiew (Rurikiden), der Grosse (Sohn von Grossfürst Swjatislaw I. von Kiew (Rurikiden) und Maluschka); gestorben am 15 Jul 1015 in Berestow. Wladimir heiratete Prinzessin Rogneda von Polotzk, die Kummervolle in 980. Rogneda (Tochter von Fürst Rogwald von Polotzk) gestorben in zw 1001 und 1002. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Prinzessin Rogneda von Polotzk, die Kummervolle (Tochter von Fürst Rogwald von Polotzk); gestorben in zw 1001 und 1002. Notizen: Trat 989 ins Kloster ein.
|
| 38. |  Olof Skötkonung von Schweden wurde geboren in cir 980 (Sohn von König Erik VIII. (Erik Segersäll) von Schweden, der Siegreiche und Prinzessin Świętosława (Gunnhild) von Polen, die Hochmütige ); gestorben in cir 1022. Olof Skötkonung von Schweden wurde geboren in cir 980 (Sohn von König Erik VIII. (Erik Segersäll) von Schweden, der Siegreiche und Prinzessin Świętosława (Gunnhild) von Polen, die Hochmütige ); gestorben in cir 1022. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Olof_Skötkonung Olof + Estrid (Obodritin). Estrid wurde geboren in cir 979; gestorben in cir 1035. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 39. | Estrid (Obodritin) wurde geboren in cir 979; gestorben in cir 1035. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Estrid_(Obodritin)
|
| 40. |  Herbert III. von Vermandois wurde geboren in 953 (Sohn von Adalbert I. von Vermandois und Gerberga von Lothringen); gestorben in 1015. Herbert III. von Vermandois wurde geboren in 953 (Sohn von Adalbert I. von Vermandois und Gerberga von Lothringen); gestorben in 1015. Herbert + Ermengard N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Ermengard N.
|
| 44. | Rudolf II. von Valois Rudolf + Adèle de Breteuil. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 45. | Adèle de Breteuil
|
| 46. | Graf Notker III. von Bar-sur-Aube
|
| 48. |  Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse wurde geboren in cir 969 (Sohn von Graf Wilhelm IV. von Poitou (Ramnulfiden), Eisenarm und Gräfin Emma von Blois); gestorben am 31 Jan 1030 in Kloster Maillezais. Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse wurde geboren in cir 969 (Sohn von Graf Wilhelm IV. von Poitou (Ramnulfiden), Eisenarm und Gräfin Emma von Blois); gestorben am 31 Jan 1030 in Kloster Maillezais. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_V._(Aquitanien) (Okt 2017) Wilhelm heiratete Gräfin Agnes von Burgund in 1018. Agnes (Tochter von Graf Otto Wilhelm von Burgund und Gräfin Ermentrud von Roucy) wurde geboren in cir 995 in Burgund; gestorben am 10 Nov 1068. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 49. |  Gräfin Agnes von Burgund wurde geboren in cir 995 in Burgund (Tochter von Graf Otto Wilhelm von Burgund und Gräfin Ermentrud von Roucy); gestorben am 10 Nov 1068. Gräfin Agnes von Burgund wurde geboren in cir 995 in Burgund (Tochter von Graf Otto Wilhelm von Burgund und Gräfin Ermentrud von Roucy); gestorben am 10 Nov 1068. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Burgund_(Herzogin_von_Aquitanien) (Okt 2017) Notizen: Nachkommen:
|
| 50. |  Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte wurde geboren in 1011 (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)); gestorben am 21 Mrz 1076 in Fleurey-sur-Ouche. Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte wurde geboren in 1011 (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)); gestorben am 21 Mrz 1076 in Fleurey-sur-Ouche. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Liste der Herrscher von Burgund: Robert + Ermengarde von Anjou. Ermengarde (Tochter von Graf Fulko III. von Anjou und Hildegard von Sundgau ?) wurde geboren in ? 1018; gestorben am 18 Mrz 1076 in Fleurey-sur-Ouche. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. |  Ermengarde von Anjou wurde geboren in ? 1018 (Tochter von Graf Fulko III. von Anjou und Hildegard von Sundgau ?); gestorben am 18 Mrz 1076 in Fleurey-sur-Ouche. Ermengarde von Anjou wurde geboren in ? 1018 (Tochter von Graf Fulko III. von Anjou und Hildegard von Sundgau ?); gestorben am 18 Mrz 1076 in Fleurey-sur-Ouche. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_von_Anjou_(†_1076)
|
| 52. |  Graf Pons von Toulouse (Raimundiner) wurde geboren in vor 1037 (Sohn von Graf Wilhem III. von Toulouse (Taillefer) und Emma von der Provence); gestorben in cir 1061 in Toulouse. Graf Pons von Toulouse (Raimundiner) wurde geboren in vor 1037 (Sohn von Graf Wilhem III. von Toulouse (Taillefer) und Emma von der Provence); gestorben in cir 1061 in Toulouse. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Pons_(Toulouse) (Aug 2023) Pons + Almodis de la Marche. Almodis (Tochter von Graf Bernard I. de la Marche und Amelia de Rasès) wurde geboren in 1020; gestorben am 16 Okt 1071. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 53. | 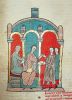 Almodis de la Marche wurde geboren in 1020 (Tochter von Graf Bernard I. de la Marche und Amelia de Rasès); gestorben am 16 Okt 1071. Almodis de la Marche wurde geboren in 1020 (Tochter von Graf Bernard I. de la Marche und Amelia de Rasès); gestorben am 16 Okt 1071. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Almodis_de_la_Marche Notizen: Den Besitz erbten nacheinander sein zweiter Sohn, Wilhelm IV., und sein dritter Sohn, Raimund von Saint-Gilles, deren Mutter sicher Almodis ist.
|
| 54. |  Graf Robert von Mortain (Conteville), 1. Earl of Cornwall wurde geboren in 1031 (Sohn von Herluin von Conteville und Herleva (Arlette) de Crey); gestorben am 8 Dez 1090; wurde beigesetzt in Abtei Grestain. Graf Robert von Mortain (Conteville), 1. Earl of Cornwall wurde geboren in 1031 (Sohn von Herluin von Conteville und Herleva (Arlette) de Crey); gestorben am 8 Dez 1090; wurde beigesetzt in Abtei Grestain. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Conteville,_comte_de_Mortain (Jul 2023) Robert heiratete Mathilde de Montgommery in 1058. Mathilde (Tochter von Roger de Montgommery (Montgomerie), 1. Earl of Shrewsbury und Mable (Mabile) de Bellême) wurde geboren in 1039; gestorben in 1085. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. |  Mathilde de Montgommery wurde geboren in 1039 (Tochter von Roger de Montgommery (Montgomerie), 1. Earl of Shrewsbury und Mable (Mabile) de Bellême); gestorben in 1085. Mathilde de Montgommery wurde geboren in 1039 (Tochter von Roger de Montgommery (Montgomerie), 1. Earl of Shrewsbury und Mable (Mabile) de Bellême); gestorben in 1085. Notizen: Kinder:
|