
| 1. | von Genf Notizen: Schwester der Bertha von Genf Familie/Ehepartner: Graf Kuno von Rheinfelden. Kuno (Sohn von Pfalzgraf Quidam (Kuno?) von Burgund und Beatrix von Frankreich) gestorben in 1026. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_of_Rheinfelden Rudolf heiratete Prinzessin Mathilde von Deutschland (von Weiblingen) in 1059. Mathilde wurde geboren in 1045; gestorben am 12 Mai 1060 in Goslar. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzogin Adelheid von Turin (von Maurienne). Adelheid (Tochter von Graf Otto von Savoyen (von Maurienne) und Markgräfin Adelheid (Arduine) von Susa (von Turin)) gestorben in 1079. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Herzog Berthold von Rheinfelden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Rheinfelden |
| 4. | Adelheid von Rheinfelden (von Schwaben) Notizen: Adelheid und Ladislaus I. sollen drei Töchter gehabt haben. Familie/Ehepartner: Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige . Ladislaus (Sohn von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) wurde geboren in 1048 in Polen; gestorben am 29 Jul 1095 in Neutra. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Herzogin Agnes von Rheinfelden Herzogin Agnes von Rheinfelden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Rheinfelden Agnes heiratete Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen in 1079. Berthold (Sohn von Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige und Gräfin Richwara (von Lothringen) ?) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 12 Apr 1111. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Stein_(Rheinfelden) Familie/Ehepartner: Graf Ulrich X. von Bregenz. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich von Bregenz) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 27 Okt 1097; wurde beigesetzt in Mehrerau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Otto von Rheinfelden (von Schwaben) Notizen: Gestorben: |
| 8. | Bruno von Rheinfelden (von Schwaben) |
| 9. |  Piroska (Eirene) von Ungarn Piroska (Eirene) von Ungarn Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Piroska_von_Ungarn (Jun 2017) Piroska heiratete Johannes II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) in 1104/1105. Johannes (Sohn von Alexios I. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Irene (Eirene) Dukaina) wurde geboren am 13 Sep 1087 in Konstantinopel; gestorben am 8 Apr 1143 in Taurusgebirge. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |  Graf Rudolf II. von Zähringen Graf Rudolf II. von Zähringen |
| 11. |  Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Zähringen) Familie/Ehepartner: Sofie von Bayern (Welfen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. |  Herzog Konrad I. von Zähringen Herzog Konrad I. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_I,_Duke_of_Z%C3%A4hringen Konrad heiratete Clementia von Namur in cir 1130. Clementia (Tochter von Gottfried von Namur und Ermensinde von Luxemburg) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 28 Dez 1158; wurde beigesetzt in St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  Agnes von Zähringen Agnes von Zähringen |
| 14. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen |
| 15. |  Petrissa von Zähringen Petrissa von Zähringen Petrissa heiratete Graf Friedrich I. von Bar-Mümpelgard (von Pfirt) in 1111. Friedrich (Sohn von Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois und Gräfin Ermentrud von Burgund) gestorben in Aug 1160. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Familie/Ehepartner: Gottfried II. von Calw. Gottfried (Sohn von Graf Adalbert II. von Calw und Wiltrud von Niederlothringen) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 6 Feb 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  Judith von Zähringen Judith von Zähringen Familie/Ehepartner: Graf Ulrich II. von Gammertingen (Gammertinger). Ulrich (Sohn von Graf Ulrich I. von Gammertingen (Gammertinger) und Adelheid von Kyburg (von Dillingen)) gestorben am 18 Sep 1150 in Kloster Zwiefalten, Zwiefalten, Reutlingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Judith heiratete Egino von Zollern-Urach in Datum unbekannt. Egino (Sohn von Graf Friedrich I. von Zollern und Udilhild von Urach) wurde geboren in cir 1098; gestorben in nach 1134. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |  Graf Rudolf von Bregenz und Churrätien Graf Rudolf von Bregenz und Churrätien Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Irmengard von Calw. Irmengard gestorben in spätestens 1128. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Wulfhild von Bayern in cir 1128. Wulfhild (Tochter von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) gestorben in nach 1160. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. |  Alexios Komnenos Komnenos (Byzanz, Komnenen) Alexios Komnenos Komnenos (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexios_Komnenos_Porphyrogennetos (Okt 2017) Alexios heiratete Eupraxia (Eudokia-Dobrodeja) von Kiew (Rurikiden) in 1122. Eupraxia (Tochter von Mstislaw I. (Wladimirowitsch) von Kiew (Rurikiden), der Grosse und Christina Ingesdotter von Schweden) gestorben in 1136. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Kata von Georgien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. |  Maria Komnena (Byzanz, Komnenen) Maria Komnena (Byzanz, Komnenen) Notizen: Name: Maria heiratete Kaisar Johannes Roger Dallassenos in Datum unbekannt. Johannes wurde geboren in cir 1100; gestorben in vor 1166 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. |  Prinz Andronikos Komnenos (Byzanz, Komnenen) Prinz Andronikos Komnenos (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Andronikos_Komnenos_(Sohn_Johannes’_II.) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Irene (Eirene) Aineiadissa. Irene gestorben am 1150 / 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Anna Komnena (Byzanz, Komnenen) Anna Komnena (Byzanz, Komnenen) Anna heiratete Stephanos Kontostephanos in 1125. Stephanos gestorben in 1149 in Korfu. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. |  Prinz Isaak Komnenos (Byzanz, Komnenen) Prinz Isaak Komnenos (Byzanz, Komnenen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Komnenos_(Sohn_Johannes’_II.) (Jul 2017) Familie/Ehepartner: Theodora Kamaterina. Theodora gestorben in 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
Isaak heiratete Irene Diplosynadene in 1146. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. |  Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen) Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen) Notizen: Gestorben: Theodora heiratete Manuel Anemas in Datum unbekannt. Manuel gestorben in 1146/1147. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. |  Eudokia Komnena (Byzanz, Komnenen) Eudokia Komnena (Byzanz, Komnenen) Eudokia heiratete Theodores Batatzes (Vatatzes) in cir 1130. Theodores gestorben in vor 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manuel_I._(Byzanz) (Okt 2017) Manuel heiratete Bertha (Irene) von Sulzbach in 1146. Bertha (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)) wurde geboren in cir 1110 in Sulzbach; gestorben in 1158/60 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Melisende von Tripolis. [Familienblatt] [Familientafel] Manuel heiratete Maria (Xene) von Antiochia (Poitiers) am 25 Dez 1161. Maria (Tochter von Fürst Raimund von Antiochia (Poitiers) und Fürstin Konstanze von Antiochia) wurde geboren in 1145; gestorben am 27 Aug 1182. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Theodora Batatzina. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Maria Taronitissa. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. |  Konrad von Zähringen Konrad von Zähringen |
| 28. |  Herzog Berthold (Berchtold) IV. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) IV. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen:
Berthold heiratete Gräfin Heilwig von Froburg (Frohburg) in 1183. Heilwig (Tochter von Volmar II. von Froburg (Frohburg)) gestorben in cir 1183. [Familienblatt] [Familientafel]
Berthold heiratete Gräfin Ida von Elsass in 1183. Ida (Tochter von Graf Matthäus von Elsass (von Flandern) und Gräfin Maria von Boulogne (von Blois)) wurde geboren in 1160/61; gestorben am 21 Apr 1216. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. |  Clementina von Zähringen Clementina von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Clementia_of_Z%C3%A4hringen Clementina heiratete Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe in 1148, und geschieden in 1162. Heinrich (Sohn von Heinrich Welf (von Bayern), der Stolze und Gertrud (Gertraud) von Sachsen (von Süpplingenburg)) wurde geboren in cir 1129 / 1130; gestorben am 6 Aug 1195 in Braunschweig; wurde beigesetzt in Braunschweiger Dom (Blasius-Kirche), Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Humbert III. von Savoyen (von Maurienne). Humbert (Sohn von Graf Amadeus III. von Savoyen (Maurienne) und Mathilde von Albon) wurde geboren am 1 Aug 1136; gestorben am 4 Mai 1188 in Veillane. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_I._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | R. von Zähringen |
| 32. | Herzog Hugo von Zähringen (von Ullenburg) |
| 33. |  Uta von Schauenburg (von Calw) Uta von Schauenburg (von Calw) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Uta_von_Schauenburg Familie/Ehepartner: Markgraf Welf VI. (Welfen). Welf (Sohn von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) wurde geboren in 1115; gestorben am 15 Dez 1191 in Memmingen, Schwaben, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Kloster Steingaden in der Klosterkirche St. Johannes Baptist. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  Graf Ulrich III. von Gammertingen (Gammertinger) Graf Ulrich III. von Gammertingen (Gammertinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Adelheid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. |  Luithold von Aichelberg (Zollern-Urach) Luithold von Aichelberg (Zollern-Urach) Luithold heiratete Ne von Otterswang in Datum unbekannt. Ne (Tochter von Mangold von Otterswang) wurde geboren in 1145 in Otterswang, Oberschwaben, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. |  Gräfin Elisabeth von Bregenz und Churrätien Gräfin Elisabeth von Bregenz und Churrätien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Bregenz Elisabeth heiratete Pfalzgraf Hugo II. von Tübingen in cir 1150. Hugo (Sohn von Pfalzgraf Hugo V. von Nagold (I. von Tübingen) und Hemma (Gemma) von Zollern) wurde geboren in 1115; gestorben in 1182. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. |  Maria Komnena (Byzanz, Komnenen) Maria Komnena (Byzanz, Komnenen) Familie/Ehepartner: Alexios Axuch. Alexios gestorben in nach 1167 in auf dem Berg Papikion. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. |  Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen) Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Theodora und Heinrich II. hatten drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Theodora heiratete Herzog Heinrich II. von Österreich, Jasomirgott in Dez 1149. Heinrich (Sohn von Leopold III. von Österreich (Babenberger), der Heilige und Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen)) wurde geboren in 1107; gestorben am 13 Jan 1177 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Königin von Ungarn Maria Komnena (Byzanz, Komnenen) Königin von Ungarn Maria Komnena (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Komnene_von_Byzanz (Okt 2017) Maria heiratete Stephan IV. von Ungarn in 1156. Stephan (Sohn von König Béla II. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Helena (Jelena, Ilona) von Serbien) wurde geboren in cir 1133; gestorben am 11 Apr 1165. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 40. |  Theodora Kalusina Komnena (Byzanz, Komnenen) Theodora Kalusina Komnena (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodora_Komnena_(Jerusalem) Familie/Ehepartner: Andronikos I. Komnenos (Byzanz, Komnenen). Andronikos (Sohn von Isaak Komnenos (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in cir 1122; gestorben am 12 Sep 1185 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
Theodora heiratete König Balduin III. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) in 1158. Balduin (Sohn von Graf Fulko V. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) und Melisende von Jerusalem) wurde geboren in 1130; gestorben am 10 Feb 1162. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. |  Eudokia Komnena (Byzanz, Komnenen) Eudokia Komnena (Byzanz, Komnenen) |
| 42. | Theodora Batatzina Familie/Ehepartner: Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt). Manuel (Sohn von Johannes II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Piroska (Eirene) von Ungarn) wurde geboren am 28 Nov 1118; gestorben am 24 Sep 1180. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. |  Maria Komnena (Byzanz, Komnenen, Montferrat) Maria Komnena (Byzanz, Komnenen, Montferrat) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Komnene_(Montferrat) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Rainer von Montferrat (Aleramiden). Rainer (Sohn von Markgraf Wilhelm V. von Montferrat (Aleramiden) und Judith von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in cir 1162; gestorben in 1183. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden). Béla (Sohn von König Géza II von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Euphrosina Mstislawna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in cir 1148; gestorben am 24 Apr 1196. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 44. |  Kaiser Alexios II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) Kaiser Alexios II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexios_Komnenos_(Sebastokrator) (Okt 2017) Alexios heiratete Prinzessin Agnes (Anna) von Frankreich (Kapetinger) am 2 Mrz 1180. Agnes (Tochter von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois)) wurde geboren in 1171; gestorben in cir 1240. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 45. |  Alexios Komnenos (Byzanz, Komnenen) Alexios Komnenos (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexios_Komnenos_(Sebastokrator) (Okt 2017) Alexios heiratete Irene Komnena (Byzanz, Komnenen) in 1183. Irene (Tochter von Andronikos I. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Theodora Kalusina Komnena (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in 1168. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 46. |  Herzog Berthold V. von Zähringen Herzog Berthold V. von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_V._(Zähringen) Berthold heiratete Clementia von Auxonne in 1212. Clementia (Tochter von Graf Stephan III. von Auxonne (von Chalon) und Beatrix von Chalon (Thiern)) wurde geboren in cir 1189; gestorben in nach 1235. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 47. |  Agnes von Zähringen Agnes von Zähringen Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Agnes heiratete Graf Egino IV. von Urach, der Bärtige in cir 1177. Egino (Sohn von Egino III. von Urach und Kunigunde von Wasserburg (Andechs)) wurde geboren in cir 1160 in Urach, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 12 Jan 1230 in Tennenbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. |  Anna von Zähringen Anna von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Zähringen Anna heiratete Graf Ulrich III. von Kyburg in zw 1180 und 1181. Ulrich (Sohn von Graf Hartmann III. von Kyburg und Gräfin Richenza von Lenzburg-Baden) gestorben in 1227. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. |  Königin Gertrud von Bayern (von Sachsen) Königin Gertrud von Bayern (von Sachsen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_(Bayern_und_Sachsen) Gertrud heiratete Friedrich IV. von Schwaben in 1166. Friedrich (Sohn von König Konrad III. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) und Gertrud von Sulzbach) wurde geboren am 1144 / 1145; gestorben am 19 Aug 1167 in Rom, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] Gertrud heiratete Knut VI. von Dänemark in 1177. Knut (Sohn von König Waldemar I. von Dänemark, der Grosse und Königin Sophia von Dänemark (von Minsk)) wurde geboren in cir 1162; gestorben in 1202; wurde beigesetzt in St.-Bendts-Kirche, Ringsted. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 50. |  Herzog Adalbert II. (Albrecht) von Teck Herzog Adalbert II. (Albrecht) von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_II._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. |  Elisabeth (Welfen) Elisabeth (Welfen) Elisabeth heiratete Rudolf von Pfullendorf-Bregenz in cir 1150. Rudolf (Sohn von Ulrich von Ramsberg und Adelheid von Bregenz) wurde geboren in ca 1100/1110; gestorben am 9 Jan 1181 in Jerusalem. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. |  Graf Welf VII. (Welfen) Graf Welf VII. (Welfen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Welf_VII. |
| 53. |  Udihild von Gammertingen Udihild von Gammertingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Markgraf Heinrich von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. |  Wilipirg von Aichelberg Wilipirg von Aichelberg Wilipirg heiratete Graf Burkhard IV. von Hohenberg in cir 1200. Burkhard (Sohn von Graf Burkhard III. von Hohenberg und Kunigunde von Grünberg) gestorben in 1217/25. [Familienblatt] [Familientafel]
Wilipirg heiratete Graf Diepold von Kersch (von Berg) in Datum unbekannt. Diepold (Sohn von Graf Ulrich von Berg und Adelheid (Udelhild) von Ronsberg) wurde geboren in cir 1160; gestorben in cir 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Tübingen) Rudolf heiratete Gräfin Mechthild von Gießen in 1181. Mechthild (Tochter von Graf Wilhelm von Gleiberg und Salomone (Salome) von Isenburg (von Giessen)) wurde geboren in cir 1155; gestorben in 12 Nov nach 1203. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 56. |  Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenburg Familie/Ehepartner: Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Mechthild von Wangen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. |  Herzogin Agnes von Österreich (Babenberger) Herzogin Agnes von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Agnes heiratete König Stephan III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) in zw 1166 und 1168. Stephan (Sohn von König Géza II von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Euphrosina Mstislawna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1147; gestorben am 4 Mrz 1172; wurde beigesetzt in Esztergom. [Familienblatt] [Familientafel] Agnes heiratete Herzog Hermann II. von Kärnten in 1173. Hermann (Sohn von Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) und Judith von Baden (von Verona)) gestorben am 4 Okt 1181. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 58. |  Herzog Leopold V. von Österreich, der Tugendhafte Herzog Leopold V. von Österreich, der Tugendhafte Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_V._(Österreich) Leopold heiratete Ilona (Helena) von Ungarn am 12 Mai 1177. Ilona (Tochter von König Géza II von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Euphrosina Mstislawna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1158; gestorben in 1199. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. |  Irene Komnena (Byzanz, Komnenen) Irene Komnena (Byzanz, Komnenen) Notizen: Hier stellt sich mir ein grosses Fragezeichen ? In den Berichten von Theodora Kalusine Komnena und Alexios Komnenos (Sebastokrator)soll Irene mit Alexios Komnenos (Sebastokrator) verheiratet gewesen sein und dann in die Verbannung gegangen sein. Familie/Ehepartner: Isaak II, Angelos (Byzanz). Isaak (Sohn von Andronikos Dukas Angelos und Euphrosyne Kastamonnites) wurde geboren in 1155; gestorben am 28 Jan 1204 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
Irene heiratete Alexios Komnenos (Byzanz, Komnenen) in 1183. Alexios (Sohn von Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) und Theodora Batatzina) wurde geboren in cir 1153; gestorben in nach 1192 in auf dem Berg Papikion. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 60. |  Alexios Komnenos (Byzanz, Komnenen) Alexios Komnenos (Byzanz, Komnenen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexios_Komnenos_(Sebastokrator) (Okt 2017) Alexios heiratete Irene Komnena (Byzanz, Komnenen) in 1183. Irene (Tochter von Andronikos I. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Theodora Kalusina Komnena (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in 1168. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 61. | Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Urach |
| 62. | Marguerite heiratete Swigger IV. von Gundeldingen in Datum unbekannt. Swigger (Sohn von Swigger III. von Gundelfingen) wurde geboren in 1179 in Gundelfingen, Münsingen, DE; gestorben in 1231 in Gundelfingen, Münsingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. |  Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Egino_V._(Urach) Familie/Ehepartner: Adelheid von Neuffen. Adelheid (Tochter von Graf Heinrich I. von Neuffen und Adelheid von Winnenden) gestorben in 1248. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. | Jolanthe heiratete Graf Ulrich III. von Neuenburg in 1202. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Neuenburg und Baronin Berta (Berthe) von Grenchen (de Granges)) wurde geboren in cir 1175; gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 65. |
| 66. |
| 67. | Familie/Ehepartner: Markgraf Heinrich I von Baden. Heinrich (Sohn von Markgraf Hermann IV von Baden und Markgräfin Bertha von Tübingen) wurde geboren in vor 1190; gestorben am 2 Jul 1231; wurde beigesetzt in Kloster Tennenbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Friedrich II. von Pfirt. Friedrich (Sohn von Graf Ludwig II. von Pfirt und Agnes von Saugern) gestorben in zw 1231 und 1233. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. |  Graf Werner von Kyburg (Kiburg) Graf Werner von Kyburg (Kiburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nahm am fünften Kreuzzug Kaiser Friedrichs II. teil, fiel bei Akkon und wurde nach der Wiedereroberung von Jerusalem von den Johanniterrittern dort beigesetzt. Familie/Ehepartner: Herzogin Alix Berta von Lothringen. Alix (Tochter von Herzog Friedrich II. von Lothringen (von Bitsch) und Gräfin Agnes von Bar) gestorben in 1242. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. |  Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg) Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise . Albrecht (Sohn von Rudolf II. von Habsburg, der Gütige und Agnes von Staufen) wurde geboren in cir 1188; gestorben am 25 Nov 1239 in Askalon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 71. |  von Kyburg (Kiburg) von Kyburg (Kiburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Ludwig von Württemberg. Ludwig (Sohn von Graf Ludwig II. von Württemberg und Willibirg von Kirchberg) gestorben in cir 1228/36. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 72. |  Herzog Konrad I. von Teck Herzog Konrad I. von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Teck) Familie/Ehepartner: von Henneberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. |  Ita von Pfullendorf-Bregenz Ita von Pfullendorf-Bregenz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Pfullendorf Ita heiratete Albrecht III. (Albert) von Habsburg, der Reiche in 1164. Albrecht (Sohn von Graf Werner II. (III.) von Habsburg und Ida (Ita) von Starkenberg) gestorben am 10 Feb 1199. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. |  von Ronsberg von Ronsberg Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Rudolf II. von Tübingen. Rudolf (Sohn von Pfalzgraf Rudolf I. von Tübingen und Gräfin Mechthild von Gießen) gestorben am 1 Nov 1247. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 75. |  Adelheid (Udelhild) von Ronsberg Adelheid (Udelhild) von Ronsberg Familie/Ehepartner: Graf Ulrich von Berg. Ulrich (Sohn von Graf Diepold von Berg-Schelklingen und Gisela von Andechs (von Diessen)) wurde geboren in 1166; gestorben in 1205. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. |  Graf Burkhard V. von Hohenberg Graf Burkhard V. von Hohenberg Notizen: Zitat aus: Familie/Ehepartner: Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. |  Engino von Aichelberg Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete von Otterswang in Datum unbekannt. wurde geboren in cir 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. |  Pfalzgraf Rudolf II. von Tübingen Pfalzgraf Rudolf II. von Tübingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Tübingen) Familie/Ehepartner: von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 79. |  Graf Rudolf I. von Montfort-Werdenberg Graf Rudolf I. von Montfort-Werdenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Klementa von Kyburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 80. |  Graf Hugo II. von Montfort Graf Hugo II. von Montfort Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Montfort_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Berg (von Burgau). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. |  Elisabeth von Montfort Elisabeth von Montfort Elisabeth heiratete Graf Mangold von Nellenburg (von Veringen) in cir 1220/25. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Heinrich von Werd in 1232/34. Heinrich gestorben in spätestens 1238. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Wildgraf Emicho in vor 1239. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 82. | Bischof Heinrich I. von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Montfort |
| 83. |  Herzog Leopold VI. von Österreich (Babenberger, der Glorreiche Herzog Leopold VI. von Österreich (Babenberger, der Glorreiche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_VI._(Österreich) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Theodora Angela von Byzanz. Theodora (Tochter von Isaak II, Angelos (Byzanz) und Margarete von Ungarn) wurde geboren in zw 1180 und 1185; gestorben am 22/23 Jun 1246. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. |  Irene (Maria) von Byzanz Irene (Maria) von Byzanz Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Irene_von_Byzanz (Jun 2017) Irene heiratete Roger III. von Sizilien (Hauteville) in 1193. Roger (Sohn von König Tankred von Sizilien (Lecce, Hauteville) und Sibylle von Acerra (Medania-Aquino)) wurde geboren in 1175; gestorben in 1193. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: König Philipp von Schwaben (Staufer). Philipp (Sohn von Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) von Schwaben (von Staufen) und Kaiserin Beatrix von Burgund) wurde geboren in zw Feb und Aug 1177 in Pavia, Italien; gestorben am 21 Jun 1208 in Bamberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. |  Alexios IV. Angelos von Byzanz Alexios IV. Angelos von Byzanz Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexios_IV._(Byzanz) |
| 86. |  Swigger V. von Gundelfingen Swigger V. von Gundelfingen Notizen: Name: Swigger heiratete Ita von Entringen in cir 1226. Ita (Tochter von Otto II. von Entringen und Adelheid von Hattstatt) wurde geboren in 1206 in Entringen, Ammerbuch, Baden-Württemberg, DE ; gestorben am 17 Mrz 1273 in Gundelfingen, Münsingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. | Notizen: Adelheid und Gottfried hatten zwei Söhne. Familie/Ehepartner: Graf Gottfried I. von Habsburg (von Laufenburg). Gottfried (Sohn von Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame und Gertrud von Regensberg) wurde geboren in 1239; gestorben in 1271. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 88. |  Graf Konrad I. von Freiburg (von Urach) Graf Konrad I. von Freiburg (von Urach) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Freiburg) Familie/Ehepartner: Sophia von Zollern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. |  Heinrich I. von Fürstenberg (von Urach) Heinrich I. von Fürstenberg (von Urach) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(F%C3%BCrstenberg) Familie/Ehepartner: Agnes von Truhendingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. | Familie/Ehepartner: Otto I. von Eberstein. Otto (Sohn von Eberhard III. von Eberstein und Gräfin Kunigunde von Andechs) wurde geboren in 1190/1200 in Grafschaft Eberstein; gestorben in 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Heinrich II von Baden-Hachberg Heinrich II von Baden-Hachberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Baden-Hachberg) Familie/Ehepartner: Anna von Uesenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 92. |  Graf Ulrich von Pfirt Graf Ulrich von Pfirt Notizen: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19533.php Ulrich heiratete Herrin Agnes de Vergy in cir 1233. Agnes (Tochter von Herr Guillaume de de Vergy und Herrin Clémentine de Fouvent) gestorben in cir 1261. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. |  Graf Hartmann V. von Kyburg Graf Hartmann V. von Kyburg Notizen: Name: Hartmann heiratete Isabel (Elisabeth) von Bourgonne-Comté (von Chalon) in 1254. Isabel (Tochter von Hugo von Chalon (Salins) und Adelheid von Meranien (von Andechs)) gestorben am 8 Jul 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 94. |  Gräfin Adelheid von Kyburg Gräfin Adelheid von Kyburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken) und Agnes von Eberstein) gestorben in 1287. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 95. |  Klementa von Kyburg Klementa von Kyburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Rudolf I. von Montfort-Werdenberg. Rudolf (Sohn von Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) und Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg) gestorben in 1243/48. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf von Hohenberg oder Homberg ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 96. |  König Rudolf I. (IV.) von Habsburg König Rudolf I. (IV.) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(HRR) - Feb 2022 Rudolf heiratete Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg in 1253 in Elsass. Gertrud (Tochter von Graf Burkhard V. von Hohenberg und Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen) wurde geboren in 1225 in Deilingen; gestorben am 16 Feb 1281 in Wien; wurde beigesetzt in Münster Basel, dann Kloster St. Blasien, dann Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. |  Kunigunde von Habsburg Kunigunde von Habsburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich III. von Küssaberg und Stühlingen. Heinrich gestorben in 1250. [Familienblatt] [Familientafel] Kunigunde heiratete Otto II. von Ochsenstein in cir 1240. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I,_Count_of_Württemberg Familie/Ehepartner: Gräfin Mechthild von Baden. Mechthild (Tochter von Markgraf Hermann V von Baden und Pfalzgräfin Irmengard bei Rhein (von Braunschweig)) wurde geboren in nach 1225; gestorben in nach 1258; wurde beigesetzt in Stiftskirche Beutelsbach. [Familienblatt] [Familientafel]
Ulrich heiratete Herzogin Agnes von Schlesien-Liegnitz in nach 1259. Agnes (Tochter von Herzog Boleslaw II. von Schlesien (Piasten) und Hedwig von Anhalt) wurde geboren in nach 1242 in Breslau, Polen; gestorben am 13 Mrz 1265. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 99. |  Adelheid von Württemberg Adelheid von Württemberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau). Heinrich (Sohn von Graf Ulrich von Berg und Adelheid (Udelhild) von Ronsberg) wurde geboren in 1177 in Burgau, DE; gestorben am 12 Jun 1239 in Burgau, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. |  Herzog Ludwig I. von Teck Herzog Ludwig I. von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 101. |  Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere Notizen: Stammliste der Herzöge von Teck: Familie/Ehepartner: Uta von Zweibrücken. Uta (Tochter von Simon I. von Zweibrücken und von Calw) gestorben in vor 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. |  Rudolf II. von Habsburg, der Gütige Rudolf II. von Habsburg, der Gütige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Agnes von Staufen. Agnes (Tochter von Gottfried von Staufen) wurde geboren in zw 1165 und 1170; gestorben in vor 1232. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 103. |  Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Palatine_of_T%C3%BCbingen Familie/Ehepartner: Graf Burkhard V. von Hohenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. |  Graf Diepold von Kersch (von Berg) Graf Diepold von Kersch (von Berg) Notizen: Geburt: Diepold heiratete Wilipirg von Aichelberg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 105. |  Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Württemberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. |  Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_von_Hohenberg Gertrud heiratete König Rudolf I. (IV.) von Habsburg in 1253 in Elsass. Rudolf (Sohn von Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise und Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg)) wurde geboren am 1 Mai 1218; gestorben am 15 Jul 1291 in Speyer, Pfalz, DE; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 107. |  Graf Engino von Aichelberg Graf Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete Agnes von Helfenstein in Datum unbekannt. Agnes (Tochter von Wilhelm II. von Helfenstein und Irmengarde von Molsberg) wurde geboren in 1212. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 108. |  Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberg_(Adelsgeschlecht)#Grafen_von_Werdenberg-Sargans Hartmann heiratete Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg in 1258. Elisabeth (Tochter von Pfalzgraf Rapoto III. von Ortenburg in Kreiburg und Adelheid von Zollern) gestorben in spätestens 1305. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. |  Klementa von Werdenberg Klementa von Werdenberg Familie/Ehepartner: Graf Friedrich III. von Toggenburg. Friedrich (Sohn von Kraft von Toggenburg und Elisabeth von Bussnang) gestorben in 1303/05. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 110. |  Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Notizen: Zitat aus: https://regiowiki.at/wiki/Rudolf_II._von_Montfort Rudolf heiratete Agnes von Grüningen (Grieningen) in zw 1255 und 1260. Agnes (Tochter von Graf Hartmann II. von Grüningen) wurde geboren in Grüningen, Baden-Württemberg, DE; gestorben in spätestens 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 111. |  Ulrich I. von Montfort-Bregenz Ulrich I. von Montfort-Bregenz |
| 112. |  Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang |
| 113. |  Bischof Friedrich von Montfort Bischof Friedrich von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 114. |  Fürstabt Wilhelm von Montfort Fürstabt Wilhelm von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 115. |  Königin Margarete von Österreich(Babenberger) Königin Margarete von Österreich(Babenberger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Babenberg (Okt 2017) Familie/Ehepartner: König Heinrich VII. von Staufen. Heinrich (Sohn von König Friedrich II. von Staufen und Königin Konstanze von Aragón) wurde geboren in 1211 in Königreich Sizilien; gestorben in ? 12 Feb 1242 in Martirano, Kalabrien. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) am 11 Feb 1252 in Burgkapelle von Hainburg, und geschieden in 1261. Ottokar (Sohn von König Wenzel I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde (Cunegundis) von Schwaben (Staufer)) wurde geboren in cir 1232 in Městec Králové, Tschechien; gestorben am 26 Aug 1278 in Dürnkrut, in Niederösterreich. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 116. |  Agnes von Österreich Agnes von Österreich Agnes heiratete Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) in 1222. Albrecht (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in cir 1175; gestorben am 7 Okt 1260; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 117. |  Herzog Heinrich von Österreich (Babenberger) Herzog Heinrich von Österreich (Babenberger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_der_Grausame_von_Österreich (Okt 2017) Heinrich heiratete Agnes von Thüringen (Ludowinger) am 29 Nov 1225 in Nürnberg, Bayern, DE. Agnes (Tochter von Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) und Sophia von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in 1205; gestorben in vor 1247. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 118. |  Constantia von Österreich (Babenberger) Constantia von Österreich (Babenberger) Notizen: Constantia hatte mit Heinrich III. zwei Söhne. Constantia heiratete Markgraf Heinrich III. von Meissen (Wettiner) am 1 Mai 1234 in Wien. Heinrich (Sohn von Markgraf Dietrich von Meissen (Wettiner) und Jutta von Thüringen (Ludowinger)) wurde geboren in cir 1215 in Meissen, Sachsen, DE; gestorben am 15 Feb 1288 in Dresden, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. |  Beatrix von Schwaben (Staufer) Beatrix von Schwaben (Staufer) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrix_von_Schwaben Familie/Ehepartner: König Otto IV. von Braunschweig (von Sachsen). Otto (Sohn von Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe und Mathilde von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1175/1176; gestorben am 19 Mai 1218 in Harzburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 120. |  Königin Kunigunde (Cunegundis) von Schwaben (Staufer) Königin Kunigunde (Cunegundis) von Schwaben (Staufer) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Kunigunde hatte mindestens fünf Kinder mit Wenzel I. Familie/Ehepartner: König Wenzel I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden). Wenzel (Sohn von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Konstanze von Ungarn) wurde geboren in cir 1205; gestorben am 23 Sep 1253 in Počaply. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 121. |  Marie von Schwaben (Staufer) Marie von Schwaben (Staufer) Notizen: Marie hatte mit Heinrich II. sechs Kinder, zwei Söhne und vier Töchter. Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen). Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1207; gestorben am 1 Feb 1248 in Löwen, Brabant; wurde beigesetzt in Villers-la-Ville. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 122. |  Königin Beatrix von Schwaben, die Jüngere Königin Beatrix von Schwaben, die Jüngere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix hatte mit Ferdinand III. zehn Kinder. Beatrix heiratete König Ferdinand III. von León (von Kastilien) am 30 Nov 1219 in Burgos. Ferdinand (Sohn von König Alfons IX. von León (von Kastilien) und Königin Berenguela von Kastilien) wurde geboren in 30 Jul od 05 Aug 1199 in Zamora; gestorben am 30 Mai 1252 in Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 123. |  Swigger von Gundelfingen Swigger von Gundelfingen Notizen: Name: Swigger heiratete Mechthild von Lupfen in Datum unbekannt. Mechthild wurde geboren in cir 1240. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 124. |  Graf Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Habsburg-Laufenburg) Rudolf heiratete Elisabeth von Rapperswil in 1296. Elisabeth (Tochter von Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) und Mechthild von Neifen) wurde geboren in ca 1251 oder 1261; gestorben in 1309 in Vermutlich Rapperswil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 125. |  Heinrich von Freiburg Heinrich von Freiburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Freiburg Familie/Ehepartner: Anna von Wartenberg. Anna (Tochter von Heinrich von Wartenberg und Elisabeth) gestorben am 1 Aug 1321; wurde beigesetzt in Amtenhausen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 126. |  Graf Friedrich I. von Fürstenberg Graf Friedrich I. von Fürstenberg Familie/Ehepartner: Udelhild von Wolfach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 127. |  Adelheid von Eberstein Adelheid von Eberstein Notizen: Name: Adelheid heiratete Heinrich II von Lichtenberg in 1251. Heinrich (Sohn von Ludwig von Lichtenberg und Adelheid oder Elisa) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 128. |  Markgraf Rudolf I. von Hachberg-Sausenberg Markgraf Rudolf I. von Hachberg-Sausenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Hachberg-Sausenberg) Rudolf heiratete Agnes von Rötteln am 1298 / 1299. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 129. |  Adelheid von Pfirt Adelheid von Pfirt Notizen: Adelheid erscheint im Bericht ihres Gatten Ulrich I. In der Stammliste der Pfirt wird sie jedoch nicht aufgeführt?? Familie/Ehepartner: Ulrich von Regensberg. Ulrich (Sohn von Lütold V. von Regensberg und Berta von Neuenburg) gestorben in 1281. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 130. |  Beatrix von Pfirt Beatrix von Pfirt Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Rudolf von Thierstein-Pfeffingen. Rudolf (Sohn von Graf Rudolf von Thierstein und Sophie von Froburg (Frohburg)) gestorben am 27 Aug 1318; wurde beigesetzt in Münster Basel, BS, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 131. |  Irmgard von Pfirt Irmgard von Pfirt Notizen: Geburt: Irmgard heiratete Eberhard II. von Grüningen-Landau in 1291 in Burg Landau. Eberhard (Sohn von Eberhard I. von Grüningen-Landau und Richenza von Löwenstein) wurde geboren in 1259 in Burg Landau; gestorben in 1345. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 132. |  Anna von Kyburg (von Thun und Burgdorf) Anna von Kyburg (von Thun und Burgdorf) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Kyburg_(Adelsgeschlecht) Anna heiratete Eberhard I. von Habsburg-Laufenburg in 1273. Eberhard (Sohn von Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame und Gertrud von Regensberg) wurde geboren in cir 1249; gestorben in cir 1284. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 133. |  Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberg_(Adelsgeschlecht)#Grafen_von_Werdenberg-Sargans Hartmann heiratete Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg in 1258. Elisabeth (Tochter von Pfalzgraf Rapoto III. von Ortenburg in Kreiburg und Adelheid von Zollern) gestorben in spätestens 1305. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 134. |  Klementa von Werdenberg Klementa von Werdenberg Familie/Ehepartner: Graf Friedrich III. von Toggenburg. Friedrich (Sohn von Kraft von Toggenburg und Elisabeth von Bussnang) gestorben in 1303/05. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 135. |  Mathilde von Habsburg Mathilde von Habsburg Mathilde heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 24 Okt 1273 in Aachen, Deutschland. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 136. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(HRR) Albrecht heiratete Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) am 20 Nov 1274 in Wien. Elisabeth (Tochter von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1262 in München, Bayern, DE; gestorben am 28 Okt 1313 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Zuerst Kloster Königsfelden, 1770 in das Kloster St. Blasien, 1809 nach Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 137. |  Katharina von Habsburg Katharina von Habsburg Notizen: Katharina hatte mit Otto III. zwei Kinder, die Zwillinge Rudolf und Heinrich, die allerdings schon im Jahr ihrer Geburt, 1280, gestorben waren. Katharina heiratete König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) in cir 1279 in Wien. Otto (Sohn von Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren am 11 Feb 1261; gestorben am 9 Sep 1312 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 138. |  Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Notizen: Agnes hatte mit Albrecht II. sechs Kinder. Agnes heiratete Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1273. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) und Helene von Braunschweig) wurde geboren in cir 1250; gestorben am 25 Aug 1298 in Schlachtfeld bei Aken an der Elbe; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 139. | 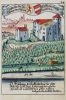 Klementia von Habsburg Klementia von Habsburg Notizen: Klementia und Karl Martell von Ungarn hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Klementia heiratete Karl Martell von Ungarn (von Anjou) am 11 Jan 1281 in Wien. Karl (Sohn von Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme und Maria von Ungarn) wurde geboren am 8 Sep 1271; gestorben am 19 Aug 1295 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 140. |  Graf Hartmann von Habsburg Graf Hartmann von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmann_von_Habsburg Familie/Ehepartner: Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt). Johanna (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren in 1272 in Schlachtfeld vor Akkon, Israel; gestorben am 23 Apr 1307 in Clare Castle, Suffolk; wurde beigesetzt in Augustinerpriorei Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 141. | 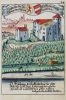 Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Österreich) Rudolf heiratete Agnes von Böhmen (Přemysliden) in 1289 in Prag, Tschechien . Agnes (Tochter von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren in 1269; gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 142. |  Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guta_von_Habsburg Guta heiratete König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) am 7 Feb 1285 in Prag, Tschechien . Wenzel (Sohn von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren am 27 Sep 1271; gestorben am 21 Jun 1305 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Kirche des Kloster Königsaal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 143. |  Otto III. von Ochsenstein Otto III. von Ochsenstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Lichtenberg. Kunigunde (Tochter von Heinrich II von Lichtenberg und Adelheid von Eberstein) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 144. |  Katharina von Ochsenstein Katharina von Ochsenstein Katharina heiratete Emich V. von Leiningen in Datum unbekannt. Emich (Sohn von Graf Emich IV. von Leiningen und Elisabeth) gestorben in 1289. [Familienblatt] [Familientafel] Katharina heiratete Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Heinrich I. von Sponheim-Starkenburg und Blancheflor von Jülich) wurde geboren in zw 1265 und 1270; gestorben in 22 Feb oder 29 Mrz 1324. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 145. |  Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg. Berthold (Sohn von Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg und Jeanne von Granges) gestorben in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 146. |  Agnes von Württemberg Agnes von Württemberg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Württemberg Agnes heiratete Konrad IV. von Oettlingen am 7 Mai 1275. Konrad gestorben in vor 15 Feb 1279. [Familienblatt] [Familientafel] Agnes heiratete Friedrich II. von Truhendingen in vor 11 Jan 1282. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich I. von Truhendingen und Margareta von Meran) gestorben am 15 Mrz 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Herr Kraft I. von Hohenlohe-Weikersheim in vor 3 Jul 1295. Kraft (Sohn von Graf Gottfried I. von Hohenlohe-Weikersheim und Richenza (Richza) von Krautheim) wurde geboren in cir 1240; gestorben am 19 Dez 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 147. |  Graf Eberhard I. von Württemberg Graf Eberhard I. von Württemberg Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Eberhard_I,_Count_of_W%C3%BCrttemberg Familie/Ehepartner: (von Werdenberg?) oder (von Teck?). [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Margarethe von Lothringen. Margarethe (Tochter von Herzog Friedrich III. von Lothringen und Marguerite von Navarra) gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
Eberhard heiratete Markgräfin Irmengard von Baden am 21 Jun 1296. Irmengard (Tochter von Markgraf Rudolf I von Baden und Kunigunde von Eberstein) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 8 Feb 1320. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 148. |  Luitgard von Burgau Luitgard von Burgau Familie/Ehepartner: Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere . Ludwig (Sohn von Herzog Ludwig I. von Teck) wurde geboren in cir 1255; gestorben in 1 Mai 1280/20 Jul 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 149. |  Markgraf Heinrich II. von Burgau Markgraf Heinrich II. von Burgau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Alpeck. Adelheid (Tochter von Witegow von Alpeck) gestorben in 1280; wurde beigesetzt in Wengenkloster bei Ulm. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 150. |  Elisabeth von Berg (von Burgau) Elisabeth von Berg (von Burgau) Familie/Ehepartner: Graf Hugo II. von Montfort. Hugo (Sohn von Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) und Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg) gestorben am 11 Aug 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 151. |  Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere Familie/Ehepartner: Luitgard von Burgau. Luitgard (Tochter von Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) und Adelheid von Württemberg) wurde geboren in vor 1260; gestorben in vor 13 Mai 1295. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 152. |  Simon von Teck Simon von Teck Familie/Ehepartner: Agnes von Helfenstein. Agnes (Tochter von Graf Ulrich III. von Helfenstein und Adelheid von Graisbach) gestorben in 1335/36. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 153. |  Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_IV._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 154. |  Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Gertrud von Regensberg. Gertrud (Tochter von Lüthold VI. von Regensberg und Adelburg von Kaiserstuhl) wurde geboren in cir 1200. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 155. |  Gertrud von Habsburg Gertrud von Habsburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Ludwig III. von Froburg (Frohburg). Ludwig (Sohn von Graf Hermann II. von Froburg (Frohburg) und von Kyburg ?) gestorben in 1256/59. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 156. |  Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_von_Hohenberg Gertrud heiratete König Rudolf I. (IV.) von Habsburg in 1253 in Elsass. Rudolf (Sohn von Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise und Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg)) wurde geboren am 1 Mai 1218; gestorben am 15 Jul 1291 in Speyer, Pfalz, DE; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 157. |  Engino von Aichelberg Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete von Otterswang in Datum unbekannt. wurde geboren in cir 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 158. |  Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Herzogin Anna von Teck in cir 1260. Anna (Tochter von Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere und Luitgard von Burgau) wurde geboren in cir 1240 in Teck, Owen, DE; gestorben in 1270 in Eichelberg, Östringen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 159. |  Rudolf II. von Werdenberg-Sargans Rudolf II. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Rudolf heiratete Adelheid von Burgau in vor 1291. Adelheid (Tochter von Markgraf Heinrich II. von Burgau und Adelheid von Alpeck) gestorben am spätestens 1307 ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: von Aspermont. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 160. |  Margareta von Toggenburg Margareta von Toggenburg Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Helfenstein. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Helfenstein und Willibirg von Dillingen) gestorben in cir 1315; wurde beigesetzt in Wiesensteig. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 161. |  Klementa von Toggenburg Klementa von Toggenburg Familie/Ehepartner: Hesso von Uesenberg. Hesso (Sohn von Burkhard von Uesenberg und Elisabeth von Geroldseck) gestorben in 1306. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 162. |  Friedrich IV. von Toggenburg Friedrich IV. von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Ita von Homberg. Ita (Tochter von Graf Werner I. (III.) von Homberg und Kunigunde) gestorben in spätestens 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 163. |  Elisabeth von Montfort Elisabeth von Montfort Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Montfort_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Eberhard Truchsess von Waldburg. Eberhard (Sohn von Otto Bertold Truchsess von Waldburg) gestorben am 30 Dez 1291. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 164. |  Graf Hugo IV. von Montfort zu Feldkirch Graf Hugo IV. von Montfort zu Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Anna von Veringen. Anna (Tochter von Graf Heinrich von Veringen (von Altveringen) und Verena von Klingen) wurde geboren in cir 1278; gestorben in 1320 in Neuburg, Oesterreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 165. |  Bischof Rudolf III. von Montfort-Feldkirch Bischof Rudolf III. von Montfort-Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._von_Montfort |
| 166. |  Ulrich II. von Montfort-Feldkirch Ulrich II. von Montfort-Feldkirch |
| 167. | Notizen: Judith hatte mit Erik IV. vier Kinder, alles Töchter. Judith heiratete König Erik IV. von Dänemark am 17 Nov 1239. Erik (Sohn von König Waldemar II. von Dänemark und Prinzessin Berengaria von Portugal) wurde geboren in 1216; gestorben am 10 Aug 1250 in Missunde. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Burchard VII. von Querfurt-Rosenburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 168. | Notizen: Jutta und Johann I. hatten fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter. Jutta heiratete Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) in vor 1255. Johann (Sohn von Albrecht II. von Brandenburg (Askanier) und Mathilde von Groitzsch) wurde geboren in cir 1213; gestorben am 4 Apt 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 169. |  Herzogin Gertrud von Österreich (Babenberger) Herzogin Gertrud von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Vladislaw keine Kinder. Gertrud heiratete Vladislav von Böhmen in cir 1246. Vladislav (Sohn von König Wenzel I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde (Cunegundis) von Schwaben (Staufer)) gestorben am 3 Jan 1247. [Familienblatt] [Familientafel] Gertrud heiratete Markgraf Hermann VI von Baden in cir 1248. Hermann (Sohn von Markgraf Hermann V von Baden und Pfalzgräfin Irmengard bei Rhein (von Braunschweig)) wurde geboren in cir 1225; gestorben am 4 Okt 1250. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Roman von Halicz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 170. |  Albrecht II. von Meissen (Wettiner) Albrecht II. von Meissen (Wettiner) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Meißen) Albrecht heiratete Prinzessin Margaretha von Staufen am 1254 / 1255. Margaretha (Tochter von König Friedrich II. von Staufen und Prinzessin Isabella von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1237; gestorben am 8 Aug 1270. [Familienblatt] [Familientafel]
Albrecht heiratete Kunigunde von Eisenberg in nach 1270. Kunigunde (Tochter von Otto von Eisenberg) wurde geboren in cir 1245; gestorben in vor 31 Okt 1286; wurde beigesetzt in Katharinenkloster, Eisenach. [Familienblatt] [Familientafel] Albrecht heiratete Elisabeth von Weimar-Orlamünde (Askanier), die Ältere in 1290. Elisabeth (Tochter von Graf Hermann III. von Weimar-Orlamünde (Askanier) und N N) gestorben in vor 24 Mrz 1333. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 171. |  Dietrich von Landsberg (Meissen, Wettiner) Dietrich von Landsberg (Meissen, Wettiner) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Landsberg Dietrich heiratete Helene von Brandenburg in 1258. Helene (Tochter von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Sophia von Dänemark) wurde geboren in 1241/1242; gestorben in 1304; wurde beigesetzt in St.-Claren-Kloster in Weißenfels. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 172. | Vladislav von Böhmen Vladislav heiratete Herzogin Gertrud von Österreich (Babenberger) in cir 1246. Gertrud (Tochter von Herzog Heinrich von Österreich (Babenberger) und Agnes von Thüringen (Ludowinger)) wurde geboren in 1226; gestorben am 24 Apr 1288. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 173. |  König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ottokar_II._Přemysl (Feb 2022) Ottokar heiratete Königin Margarete von Österreich(Babenberger) am 11 Feb 1252 in Burgkapelle von Hainburg, und geschieden in 1261. Margarete (Tochter von Herzog Leopold VI. von Österreich (Babenberger, der Glorreiche und Theodora Angela von Byzanz) wurde geboren am 1204 / 1205; gestorben am 29 Okt 1266 in Burg Krumau am Kamp; wurde beigesetzt in Stift Lilienfeld. [Familienblatt] [Familientafel] Ottokar heiratete Königin Kunigunde von Halitsch in Okt 1261 in Burg Pozsony (heute Bratislava). Kunigunde (Tochter von Grossfürst Rostislaw von Kiew und Anna von Ungarn (Árpáden)) wurde geboren in cir 1245; gestorben am 9 Sep 1285 in Krummau. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Hofdame Anna (?Margarete, ?Agnes) von Chuenring (Kuenring). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 174. | Beatrix (Božena) von Böhmen Notizen: Beatrix (Božena) und Otto III. hatten sechs Kinder, vier Söhne und zwei Töchter. Beatrix heiratete Markgraf Otto III. von Brandenburg (Askanier), der Fromme in 1243. Otto (Sohn von Albrecht II. von Brandenburg (Askanier) und Mathilde von Groitzsch) wurde geboren in 1215; gestorben am 9 Okt 1267 in Brandenburg an der Havel, DE; wurde beigesetzt in Kirche des Strausberger Dominikanerkloster. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 175. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Mathilde und Robert I. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Mathilde heiratete Robert I. von Artois (von Frankreich) am 14 Jun 1237 in Compiègne, Frankreich. Robert (Sohn von König Ludwig VIII. von Frankreich, der Löwe und Königin Blanka von Kastilien) wurde geboren am 17 Sep 1216; gestorben am 8 Feb 1250 in Al-Mansura. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) am cir Mai 1254 in Neapel, Italien. Guido (Sohn von Graf Hugo I. (V.) von Châtillon-Saint Pol und Gräfin Maria von Avesnes) gestorben am 12 Feb 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 176. |  Herzogin Maria von Brabant Herzogin Maria von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria hatte mit Ludwig II. keine Kinder. Maria heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 2 Aug 1254. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 177. | 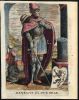 Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Brabant) Heinrich heiratete Adelheid von Burgund in 1251. Adelheid (Tochter von Herzog Hugo IV. von Burgund und Yolande von Dreux) wurde geboren in 1233; gestorben in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 178. |  König Alfons X. von León (von Kastilien), der Weise König Alfons X. von León (von Kastilien), der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_X._(Kastilien) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Prinzessin María Guillén de Guzmán. [Familienblatt] [Familientafel]
Alfons heiratete Violante von Aragón am 26 Dez 1246 in Valladolid, Spanien. Violante (Tochter von König Jakob I. von Aragón und Königin Yolanda (Violante) von Ungarn) wurde geboren in 1236 in Saragossa; gestorben in 1301 in Roncevalles. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 179. |  Graf Manuel von Kastilien Graf Manuel von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Manuel heiratete Konstanze (Constance) von Aragón in 1260. Konstanze (Tochter von König Jakob I. von Aragón und Königin Yolanda (Violante) von Ungarn) wurde geboren in 1239; gestorben in cir 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
Manuel heiratete Beatrice von Savoyen in 1275. Beatrice (Tochter von Graf Amadeus IV. von Savoyen und Cécile (Passerose) von Baux) wurde geboren in 1250; gestorben in 1292. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 180. |  Berthold von Gundelfingen, der Ältere Berthold von Gundelfingen, der Ältere Notizen: Name: Berthold heiratete Guta von Hohentann in Datum unbekannt. Guta wurde geboren in cir 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 181. |  Graf Johann I. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Johann I. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Habsburg-Laufenburg) Familie/Ehepartner: Agnes von Werd. Agnes (Tochter von Sigismund von Werd) gestorben in nach 9 Feb 1354. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 182. |  Verena von Freiburg Verena von Freiburg Familie/Ehepartner: Graf Heinrich II. von Fürstenberg. Heinrich (Sohn von Graf Friedrich I. von Fürstenberg und Udelhild von Wolfach) gestorben am 14 Dez 1337; wurde beigesetzt in Kloster Neidingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 183. |  Graf Heinrich II. von Fürstenberg Graf Heinrich II. von Fürstenberg Familie/Ehepartner: Verena von Freiburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 184. |  Kunigunde von Lichtenberg Kunigunde von Lichtenberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Otto III. von Ochsenstein. Otto (Sohn von Otto II. von Ochsenstein und Kunigunde von Habsburg) gestorben am 2 Jul 1298 in Göllheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 185. |  Markgraf Rudolf II. von Hachberg-Sausenberg Markgraf Rudolf II. von Hachberg-Sausenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Hachberg-Sausenberg) Familie/Ehepartner: Katharina von Thierstein-Pfeffingen. Katharina (Tochter von Pfalzgraf Walram II. (I.) von Thierstein-Pfeffingen und Gräfin Agnes von Aarberg-Aarberg) gestorben in 1385. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 186. |  Adelheid von Regensberg Adelheid von Regensberg Notizen: Freiin Familie/Ehepartner: Ulrich von Altenklingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 187. |  Pfalzgraf Ulrich von Thierstein-Pfeffingen Pfalzgraf Ulrich von Thierstein-Pfeffingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Geroldseck am Wasichen ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 188. |  Eberhard III. von Landau Eberhard III. von Landau Notizen: Name: Eberhard heiratete Guta von Gundelfingen in 1330 in Burg Landau. Guta (Tochter von Berthold von Gundelfingen, der Jüngere und von Becht) wurde geboren in cir 1302 in Gundelfingen, Münsingen, DE; gestorben in 1363 in Binswangen, Dillingen an der Donau, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Elisabeth. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 189. |  Rudolf II. von Werdenberg-Sargans Rudolf II. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Rudolf heiratete Adelheid von Burgau in vor 1291. Adelheid (Tochter von Markgraf Heinrich II. von Burgau und Adelheid von Alpeck) gestorben am spätestens 1307 ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: von Aspermont. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 190. |  Margareta von Toggenburg Margareta von Toggenburg Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Helfenstein. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Helfenstein und Willibirg von Dillingen) gestorben in cir 1315; wurde beigesetzt in Wiesensteig. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 191. |  Klementa von Toggenburg Klementa von Toggenburg Familie/Ehepartner: Hesso von Uesenberg. Hesso (Sohn von Burkhard von Uesenberg und Elisabeth von Geroldseck) gestorben in 1306. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 192. |  Friedrich IV. von Toggenburg Friedrich IV. von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Ita von Homberg. Ita (Tochter von Graf Werner I. (III.) von Homberg und Kunigunde) gestorben in spätestens 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 193. |  Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I,_Duke_of_Bavaria Rudolf heiratete Prinzessin Mechthild von Nassau am 1 Sep 1294 in Nürnberg, Bayern, DE. Mechthild (Tochter von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1280; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 194. |  Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Fürst Otto II. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1288. Otto (Sohn von Herzog Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) und Liutgard von Holstein) wurde geboren in cir 1266; gestorben am 10 Apr 1330; wurde beigesetzt in Kloster St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 195. |  Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes heiratete Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) in 1303. Heinrich (Sohn von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren am 21 Mrz 1256; gestorben am 14 Feb 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Landgraf Heinrich von Hessen in 1290. Heinrich wurde geboren in 1264; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 196. |  Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(HRR) Ludwig heiratete Beatrix von Schlesien-Schweidnitz in cir 1308. Beatrix (Tochter von Herzog Bolko I. von Schlesien (von Schweidnitz) (Piasten) und Beatrix von Brandenburg) wurde geboren in cir 1290; gestorben am 24 Aug 1322 in München, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Margarethe von Hennegau (von Holland) am 25 Feb 1324 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Margarethe (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in ca 1307 / 1310 in Valenciennes ?; gestorben am 23 Jun 1356 in Quesnoy; wurde beigesetzt in Minoritenkirche zu Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 197. |  Anna von Habsburg Anna von Habsburg Notizen: Anna und Hermann (III.) der Lange hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange in 1295. Hermann (Sohn von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) wurde geboren in cir 1275; gestorben am 1 Feb 1308 in bei Lübz; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 18 Mrz 1294; gestorben am 24 Nov 1335; wurde beigesetzt in Klarissenkloster, Breslau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 198. |  Agnes von Habsburg (von Ungarn) Agnes von Habsburg (von Ungarn) Notizen: Über Kinder von Agnes mit Andreas III. ist nichts bekannt. Agnes heiratete König Andreas III. von Ungarn (Árpáden), der Venezianer am 13 Feb 1296 in Wien. Andreas (Sohn von Prinz Stephan von Slowenien (von Ungarn) (Árpáden) und Katharina Morosini (Morossini)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 14 Jan 1301. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 199. |  Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Böhmen) Rudolf heiratete Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) in 1300. Blanka (Tochter von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in cir 1285 in Paris, France; gestorben am 1 Mrz 1305 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen am 16 Okt 1306. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 200. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nancy und Friedrich IV. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Elisabeth heiratete Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur in 1307 in Nancy, FR. Friedrich (Sohn von Herzog Theobald II. von Lothringen und Isabelle de Rumigny) wurde geboren am 15 Apr 1282 in Gondreville; gestorben am 23 Aug 1328 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 201. |  Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Österreich) (Mai 2018) Albrecht heiratete Herzogin Johanna von Pfirt am 26 Mrz 1324 in Wien. Johanna (Tochter von Ulrich von Pfirt und Prinzessin Johanna von Mömpelgard) wurde geboren in 1300 in Basel, BS, Schweiz; gestorben am 15 Nov 1351 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 202. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(Habsburg) Leopold heiratete Prinzessin Katharina von Savoyen am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Katharina (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in zw 1297 und 1304 in Brabant; gestorben am 30 Sep 1336 in Rheinfelden, AG, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann 1770 Dom St. Blasien, dann 1806 Stift Spital Phyrn, dann 1809 Stiftskirchengruft Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 203. |  Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Sachsen-Wittenberg) Rudolf heiratete Jutta (Brigitte) von Brandenburg in 1298. Jutta (Tochter von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) gestorben am 9 Mai 1328 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Kunigunde von Polen am 28 Aug 1328. Kunigunde (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in cir 1293; gestorben in 1333/1335. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Agnes von Lindow-Ruppin in 1333. Agnes (Tochter von Graf Günther ? von Lindow-Ruppin) wurde geboren in cir 1300; gestorben am 9 Mai 1343 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 204. |  König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(Ungarn) Familie/Ehepartner: Maria von Oppeln (von Beuthen). Maria (Tochter von Herzog Kasimir I. von Oppeln (von Beuthen) (Piasten) und Helena N.) gestorben in 1317. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Königin Beatrix von Luxemburg am 24 Jun 1318. Beatrix (Tochter von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren in 1305; gestorben am 11 Nov 1319; wurde beigesetzt in Kathedrale von Varaždin. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Elisabeth von Polen am 6 Jul 1320. Elisabeth (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in 1305; gestorben am 29 Dez 1380 in Budapest. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 205. |  Herzog Johann von Schwaben Herzog Johann von Schwaben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Parricida |
| 206. |  König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_III._(Böhmen) (Feb 2022) Wenzel heiratete Viola Elisabeth von Teschen in 1305. Viola (Tochter von Herzog Mesko I. (Miezko) von Teschen) wurde geboren in 1290; gestorben am 21 Sep 1317. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 207. | Anna Přemyslovna Notizen: Annas Ehe mit Heinrich blieb kinderlos. Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner). Heinrich (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 2 Apr 1335 in Schloss Tirol. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 208. |  Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(Königin_von_Böhmen_1311–1330) (Apr 2018) Elisabeth heiratete König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde in 1310 in Speyer, Pfalz, DE. Johann (Sohn von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren am 10 Aug 1296 in Luxemburg; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 209. | Margarethe von Böhmen Margarethe heiratete Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) in vor 13 Jan 1303. Bolesław (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 23 Sep 1291; gestorben am 21 Apr 1351. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 210. |  Guota (Imagina) von Ochsenstein Guota (Imagina) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Donat von Vaz. Donat (Sohn von Walter V. von Vaz und Luitgard (Liukarda) von Kirchberg) gestorben am 23 Apr 1337/38 in Churwalden, GR, Schweiz; wurde beigesetzt in Churwalden, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 211. |  Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Sponheim-Starkenburg) Heinrich heiratete Gräfin Loretta von Salm in Datum unbekannt. Loretta (Tochter von Johann I. von Salm und Jeanne von Joinville (von Geneville)) wurde geboren in 1300; gestorben in 1345/1346; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 212. |  Gertrude von Neuenburg-Strassberg Gertrude von Neuenburg-Strassberg Familie/Ehepartner: Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau. Rudolf (Sohn von Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau und Richenza) gestorben in 1308/1309. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 213. |  Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Marguerite von Freiburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 214. |  Graf Ulrich von Truhendingen Graf Ulrich von Truhendingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Imagina von Limburg. Imagina (Tochter von Johann I. von Limburg und Elisabeth von Geroldseck (Hohengeroldseck)) gestorben in spätestens 1337. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 215. |  Gottfried II. von Hohenlohe-Weikersheim (Röttingen) Gottfried II. von Hohenlohe-Weikersheim (Röttingen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Gottfried heiratete Elisabeth von Eberstein am 3 Nov 1319. Elisabeth wurde geboren in cir 1310; gestorben in 1381. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 216. |  Agnes von Hohenlohe-Weikersheim Agnes von Hohenlohe-Weikersheim Notizen: Name: Agnes heiratete Ulrich II. von Hanau in 1310. Ulrich (Sohn von Ulrich I. von Hanau und Elisabeth von Rieneck) gestorben in 2 Sep oder 23 Sep 1346; wurde beigesetzt in Klosters Arnsburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 217. |  Graf Ulrich III. von Württemberg Graf Ulrich III. von Württemberg Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_III,_Count_of_W%C3%BCrttemberg Familie/Ehepartner: Sophia von Pfirt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 218. |  Agnes von Württemberg Agnes von Württemberg Familie/Ehepartner: Graf Ludwig VI. von Oettingen. Ludwig wurde geboren in 1288; gestorben in 1346. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 219. |  Adelheid Mechthild von Württemberg Adelheid Mechthild von Württemberg Adelheid heiratete Herr Kraft II. von Hohenlohe-Weikersheim in cir 1306. Kraft (Sohn von Herr Kraft I. von Hohenlohe-Weikersheim und Margarethe von Truhendingen) wurde geboren in nach 1280; gestorben am 3 Mai 1344. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 220. |  Herzogin Anna von Teck Herzogin Anna von Teck Anna heiratete Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg in cir 1260. Diepold (Sohn von Graf Engino von Aichelberg und Agnes von Helfenstein) wurde geboren in 1234; gestorben am 6 Mrz 1270. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 221. |  Adelheid von Burgau Adelheid von Burgau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Burgau Adelheid heiratete Rudolf II. von Werdenberg-Sargans in vor 1291. Rudolf (Sohn von Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans und Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg) gestorben in 28 Sep 1322 ? in bei Mühldorf am Inn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 222. |  Heinrich von Burgau Heinrich von Burgau Familie/Ehepartner: Margarethe von Hohenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 223. |  Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Notizen: Zitat aus: https://regiowiki.at/wiki/Rudolf_II._von_Montfort Rudolf heiratete Agnes von Grüningen (Grieningen) in zw 1255 und 1260. Agnes (Tochter von Graf Hartmann II. von Grüningen) wurde geboren in Grüningen, Baden-Württemberg, DE; gestorben in spätestens 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 224. |  Ulrich I. von Montfort-Bregenz Ulrich I. von Montfort-Bregenz |
| 225. |  Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang |
| 226. |  Bischof Friedrich von Montfort Bischof Friedrich von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 227. |  Fürstabt Wilhelm von Montfort Fürstabt Wilhelm von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 228. |  Agnes von Teck Agnes von Teck Notizen: Stammliste der Herzöge von Teck: Familie/Ehepartner: Eberhard Truchsess von Waldburg. Eberhard (Sohn von Johann Truchsess von Waldburg und Klara von Neuffen (Neifen)) gestorben in 1361/62. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 229. |  König Rudolf I. (IV.) von Habsburg König Rudolf I. (IV.) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(HRR) - Feb 2022 Rudolf heiratete Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg in 1253 in Elsass. Gertrud (Tochter von Graf Burkhard V. von Hohenberg und Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen) wurde geboren in 1225 in Deilingen; gestorben am 16 Feb 1281 in Wien; wurde beigesetzt in Münster Basel, dann Kloster St. Blasien, dann Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 230. |  Kunigunde von Habsburg Kunigunde von Habsburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich III. von Küssaberg und Stühlingen. Heinrich gestorben in 1250. [Familienblatt] [Familientafel] Kunigunde heiratete Otto II. von Ochsenstein in cir 1240. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 231. |  Graf Gottfried I. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Gottfried I. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_I._(Habsburg-Laufenburg) Familie/Ehepartner: Adelheid von Urach (von Freiburg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 232. |  Eberhard I. von Habsburg-Laufenburg Eberhard I. von Habsburg-Laufenburg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg-Laufenburg Eberhard heiratete Anna von Kyburg (von Thun und Burgdorf) in 1273. Anna (Tochter von Graf Hartmann V. von Kyburg und Isabel (Elisabeth) von Bourgonne-Comté (von Chalon)) wurde geboren in 1256; gestorben in 1283. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 233. |  Graf Hermann IV. von Froburg (Frohburg) Graf Hermann IV. von Froburg (Frohburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Homberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 234. |  Mathilde von Habsburg Mathilde von Habsburg Mathilde heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 24 Okt 1273 in Aachen, Deutschland. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 235. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(HRR) Albrecht heiratete Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) am 20 Nov 1274 in Wien. Elisabeth (Tochter von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1262 in München, Bayern, DE; gestorben am 28 Okt 1313 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Zuerst Kloster Königsfelden, 1770 in das Kloster St. Blasien, 1809 nach Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 236. |  Katharina von Habsburg Katharina von Habsburg Notizen: Katharina hatte mit Otto III. zwei Kinder, die Zwillinge Rudolf und Heinrich, die allerdings schon im Jahr ihrer Geburt, 1280, gestorben waren. Katharina heiratete König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) in cir 1279 in Wien. Otto (Sohn von Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren am 11 Feb 1261; gestorben am 9 Sep 1312 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 237. |  Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Notizen: Agnes hatte mit Albrecht II. sechs Kinder. Agnes heiratete Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1273. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) und Helene von Braunschweig) wurde geboren in cir 1250; gestorben am 25 Aug 1298 in Schlachtfeld bei Aken an der Elbe; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 238. | 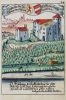 Klementia von Habsburg Klementia von Habsburg Notizen: Klementia und Karl Martell von Ungarn hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Klementia heiratete Karl Martell von Ungarn (von Anjou) am 11 Jan 1281 in Wien. Karl (Sohn von Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme und Maria von Ungarn) wurde geboren am 8 Sep 1271; gestorben am 19 Aug 1295 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 239. |  Graf Hartmann von Habsburg Graf Hartmann von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmann_von_Habsburg Familie/Ehepartner: Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt). Johanna (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren in 1272 in Schlachtfeld vor Akkon, Israel; gestorben am 23 Apr 1307 in Clare Castle, Suffolk; wurde beigesetzt in Augustinerpriorei Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 240. | 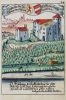 Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Österreich) Rudolf heiratete Agnes von Böhmen (Přemysliden) in 1289 in Prag, Tschechien . Agnes (Tochter von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren in 1269; gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 241. |  Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guta_von_Habsburg Guta heiratete König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) am 7 Feb 1285 in Prag, Tschechien . Wenzel (Sohn von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren am 27 Sep 1271; gestorben am 21 Jun 1305 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Kirche des Kloster Königsaal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 242. |  Graf Engino von Aichelberg Graf Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete Agnes von Helfenstein in Datum unbekannt. Agnes (Tochter von Wilhelm II. von Helfenstein und Irmengarde von Molsberg) wurde geboren in 1212. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 243. |  Graf Diepold II. von Aichelberg Graf Diepold II. von Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Gräfin Agnes von Rechberg in Datum unbekannt. Agnes wurde geboren in 1270 in Rechberg, Schwäbisch Gmünd, DE . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 244. |  Rudolf III. von Werdenberg-Sargans Rudolf III. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberg_(Adelsgeschlecht)#Grafen_von_Werdenberg-Sargans Familie/Ehepartner: Ursula von Vaz. Ursula (Tochter von Donat von Vaz und Guota (Imagina) von Ochsenstein) gestorben am 4 Apr 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 245. |  Burkhart von Uesenberg Burkhart von Uesenberg Familie/Ehepartner: von Hewen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 246. |  Diethelm von Toggenburg Diethelm von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Adelheid von Griessenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 247. |  Johann Truchsess von Waldburg Johann Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Klara von Neuffen (Neifen). Klara (Tochter von Graf Albert II. von Neuffen (Neifen) und Elisabeth von Graisbach) gestorben in 1339. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 248. |  Anna von Montfort-Feldkirch Anna von Montfort-Feldkirch |
| 249. |  Friedrich III von Montfort-Feldkirch Friedrich III von Montfort-Feldkirch |
| 250. |  Elisabeth von Montfort-Feldkirch Elisabeth von Montfort-Feldkirch |
| 251. |  Sophie von Montfort-Feldkirch Sophie von Montfort-Feldkirch Sophie heiratete Ritter Friedrich Thumb von Neuburg in 1300 in Untervaz, GR, Schweiz. Friedrich (Sohn von Ritter Swiggerus Thumb von Neuburg und Anna von Ems) wurde geboren in 1265 in Untervaz, GR, Schweiz; gestorben in Mrz 1316 in Untervaz, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 252. |  Hugo VI von Montfort-Tosters Hugo VI von Montfort-Tosters |
| 253. |  Katharina von Montfort-Feldkirch Katharina von Montfort-Feldkirch Familie/Ehepartner: Heinrich V von Tengen. Heinrich (Sohn von Konrad II von Tengen) gestorben in 1350/52. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 254. |  Rudolf IV von Montfort-Feldkirch Rudolf IV von Montfort-Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 255. |  Sophia von Dänemark Sophia von Dänemark Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sofia_von_Dänemark (Apr 2018) Sophia heiratete König Waldemar (Valdemar) von Schweden in 1260 in Jönköping. Waldemar (Sohn von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in 1243; gestorben am 26 Dez 1302 in Nyköpingshus. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 256. |  Jutta von Dänemark Jutta von Dänemark Familie/Ehepartner: König Waldemar (Valdemar) von Schweden. Waldemar (Sohn von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in 1243; gestorben am 26 Dez 1302 in Nyköpingshus. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 257. |  Agnes (Agnete) von Brandenburg Agnes (Agnete) von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes und Erik V. hatten sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Agnes heiratete König Erik V. von Dänemark, Klipping in 1273. Erik (Sohn von König Christoph I. von Dänemark und Margarete Sambiria von Pommerellen) wurde geboren in cir 1249 in Schloss Ålholm bei Nysted; gestorben am 22 Nov 1286 in Findrup bei Viborg, Jütland; wurde beigesetzt in Dom zu Viborg. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Graf Gerhard II. von Holstein (von Plön), der Blinde in 1293. Gerhard (Sohn von Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe und Elisabeth von Mecklenburg) wurde geboren in 1254; gestorben am 28 Okt 1312. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 258. |  Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Brandenburg) (Jun 2022) Heinrich heiratete Agnes von Bayern (Wittelsbacher) in 1303. Agnes (Tochter von Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge und Mathilde von Habsburg) wurde geboren in 1276; gestorben in 1340. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 259. |  Mechthild von Brandenburg (Askanier) Mechthild von Brandenburg (Askanier) Familie/Ehepartner: Herzog Bogislaw IV. von Pommern (Greifen). Bogislaw (Sohn von Herzog Barnim I. von Pommern (Greifen) und Marianne) wurde geboren in vor 1278; gestorben am 24 Feb 1309. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 260. |  Friedrich von Baden (von Österreich) Friedrich von Baden (von Österreich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Baden-Österreich |
| 261. |  Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Meißen) Friedrich heiratete Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) am 1 Jan 1286. Agnes (Tochter von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) gestorben in 14 Mai1293. [Familienblatt] [Familientafel] Friedrich heiratete Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk am 24 Aug 1301. Elisabeth (Tochter von Hartmann von Lobdeburg-Arnshaugk und Elisabeth von Weimar-Orlamünde (Askanier), die Ältere ) wurde geboren in 1286; gestorben am 22 Aug 1359 in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 262. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Meißen Agnes heiratete Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen in 1282. Heinrich (Sohn von Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große und Adelaide (Alessina) von Montferrat) wurde geboren in Aug 1267; gestorben am 7 Sep 1322 in Heldenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 263. |  Sophia von Landsberg Sophia von Landsberg Notizen: Sophias Ehe mit Konradin wurde wahrscheinlich nie vollzogen. Sophia heiratete König Konradin von Staufen in 1266. Konradin (Sohn von König Konrad IV. von Staufen und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 25 Mrz 1252 in Burg Wolfstein, Landshut; gestorben am 29 Okt 1268 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten). Konrad (Sohn von Herzog Heinrich II von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Fromme und Herzogin Anna von Böhmen) wurde geboren in zw 1232 und 1235; gestorben in 06 Aug 1273 oder 1274 in Glogau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 264. |  Herzogin, Äbtissin Kunigunde von Böhmen (Přemysliden) Herzogin, Äbtissin Kunigunde von Böhmen (Přemysliden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Kunigunde_von_Böhmen_(Äbtissin) (Feb 2022) Familie/Ehepartner: Herzog Boleslaw II. von Masowien (von Płock). Boleslaw wurde geboren in 1251; gestorben in 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 265. |  Agnes von Böhmen (Přemysliden) Agnes von Böhmen (Přemysliden) Agnes heiratete Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) in 1289 in Prag, Tschechien . Rudolf (Sohn von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in 1270 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 10 Mai 1290 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 266. |  König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_II._(Böhmen) (Okt 2017) Wenzel heiratete Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg am 7 Feb 1285 in Prag, Tschechien . Guta (Tochter von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren am 13 Mrz 1271 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 18 Jun 1297 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel]
Wenzel heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen in 1303. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 267. |  Herzog Nikolaus I. von Troppau Herzog Nikolaus I. von Troppau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_I._(Troppau) Nikolaus heiratete Adelheid von Habsburg in 1285 in Eger, Böhmen, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 268. |  Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_(V.)_(Brandenburg) Familie/Ehepartner: Katharina von Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg. Judith (Tochter von Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg und Margarete von Holland (von Henneberg)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 269. |  Markgraf Albrecht III. von Brandenburg Markgraf Albrecht III. von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_III._(Brandenburg) Albrecht heiratete Mathilde von Dänemark in 1268. Mathilde (Tochter von König Christoph I. von Dänemark und Margarete Sambiria von Pommerellen) gestorben in cir 1300. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 270. |  Kunigunde von Brandenburg Kunigunde von Brandenburg Kunigunde heiratete Herzog Béla (Bela) von Slawonien (Árpáden) in Datum unbekannt. Béla (Sohn von König Béla IV. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin von Ungarn Maria Laskaris (Nicäa)) wurde geboren in 1243; gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel] Kunigunde heiratete Herzog Walram V. von Limburg in 1273. Walram (Sohn von Herzog Heinrich IV. von Limburg und Irmgard von Berg) gestorben am 14 Okt 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 271. | Blanche von Artois Notizen: Das einzige Kind von Blanche mit Heinrich I., Johanna I. wurde die Nachfolgerin Heinrichs. Blanche heiratete König Heinrich I. von Navarra (von Champagne) in 1269 in Melun. Heinrich (Sohn von Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger und Marguerite von Bourbon (von Dampierre)) wurde geboren in cir 1244; gestorben in Jul 1274. [Familienblatt] [Familientafel]
Blanche heiratete Prinz Edmund von England (Plantagenêt), Crouchback in 1276. Edmund (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 16 Jan 1245 in Westminster; gestorben am 5 Jun 1296 in Bayonne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 272. |  Graf Robert II. von Artois Graf Robert II. von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Artois) Robert heiratete Amicia von Courtenay in 1262. Amicia (Tochter von Peter (Pierre) von Courtenay (Kapetinger) und Pétronille von Joigny) wurde geboren in 1250; gestorben in 1275 in Rom, Italien; wurde beigesetzt in Petersdom. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herrin Agnes von Bourbon (de Dampierre). Agnes (Tochter von Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) und Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers)) wurde geboren in 1237; gestorben in 1288. [Familienblatt] [Familientafel] Robert heiratete Margarete von Avesnes in 1298. Margarete (Tochter von Graf Johann II. (Jean) von Avesnes und Philippa von Luxemburg) gestorben am 18 Okt 1342. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 273. |  Hugo II. von Châtillon (Blois) Hugo II. von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_II._(Blois) Hugo heiratete Beatrix von Flandern in 1287. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 274. |  Graf Guido III. (Guy) von Châtillon-Saint-Pol (Blois) Graf Guido III. (Guy) von Châtillon-Saint-Pol (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_III._(St._Pol) Guido heiratete Marie von der Bretagne am 22 Jul 1292. Marie (Tochter von Herzog Johann II. von der Bretagne und Prinzessin Beatrix von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1268; gestorben am 5 Mrz 1339. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 275. |  Jacques von Châtillon (Blois) Jacques von Châtillon (Blois) |
| 276. |  Beatrix von Châtillon (Blois) Beatrix von Châtillon (Blois) Familie/Ehepartner: Graf Johann II. von Eu (Brienne). Johann (Sohn von Graf Alfons von Brienne und Gräfin Marie von Lusignan-Issoudun) gestorben am 12 Jun 1292 in Clermont-en-Beauvaisis; wurde beigesetzt in Abtei von Foucarmont. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 277. |  Herzog Johann I. von Brabant Herzog Johann I. von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Brabant) (Okt 2017) Johann heiratete Prinzessin Margarete von Frankreich in 1270. Margarete (Tochter von König Ludwig IX. von Frankreich und Königin Margarete von der Provence) wurde geboren in 1254/1255; gestorben in Jul 1271. [Familienblatt] [Familientafel] Johann heiratete Herzogin Margarete von Flandern (von Dampierre) in 1273. Margarete (Tochter von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Mathilde von Béthune) wurde geboren in cir 1251; gestorben am 3 Jul 1285. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 278. |  Herr Gottfried von Brabant-Arschot Herr Gottfried von Brabant-Arschot Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Aerschot Gottfried heiratete Jeanne Isabeau von Vierzon in 1277. Jeanne (Tochter von Herr Hervé IV. von Vierzon und Jeanne de Brenne) gestorben in cir 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 279. |  Maria von Brabant Maria von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria und Philipp III. hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Maria heiratete König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne am 21 Aug 1274 in Schloss Vincennes. Philipp (Sohn von König Ludwig IX. von Frankreich und Königin Margarete von der Provence) wurde geboren am 3 Apr 1245 in Burg Poissy; gestorben am 5 Okt 1285 in Perpignan; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 280. |  Prinzessin Beatrix von Kastilien Prinzessin Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix hatte mit Alfons III. acht Kinder, vier Töchter und vier Söhne. Familie/Ehepartner: König Alfons III. von Portugal. Alfons (Sohn von König Alfons II. von Portugal, der Dicke und Prinzessin Urraca von Kastilien (von Portugal)) wurde geboren am 5 Mai 1210 in Coimbra; gestorben am 16 Feb 1279 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 281. |  Prinzessin Beatrix von Kastilien Prinzessin Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Beatrix heiratete Markgraf Wilhelm VII. von Montferrat (Aleramiden), der Grosse in 1271. Wilhelm (Sohn von Markgraf Bonifatius II. von Montferrat (Aleramiden), der Riese und Margarete von Savoyen) gestorben am 8 Feb 1292. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 282. |  König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Sancho_IV_of_Castile Sancho heiratete Königin Maria de Molina in 1283. Maria (Tochter von Herzog Alfons de Molina (von León) und Teresa de Lara) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 1 Jul 1321 in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 283. |  Violante Manuel von Kastilien Violante Manuel von Kastilien Familie/Ehepartner: Herr Alfonso von Portugal. Alfonso (Sohn von König Alfons III. von Portugal und Prinzessin Beatrix von Kastilien) wurde geboren am 6/8 Feb 1263; gestorben am 2 Jan 1312. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 284. |  Don Juan Manuel Don Juan Manuel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel (Aug 2023) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 285. |  Berthold von Gundelfingen, der Jüngere Berthold von Gundelfingen, der Jüngere Notizen: Name: Berthold heiratete von Becht in Datum unbekannt. wurde geboren in cir 1280; gestorben in 1332. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 286. |  Graf Johann II. (Hans) von Habsburg (von Laufenburg) Graf Johann II. (Hans) von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Habsburg-Laufenburg) Johann heiratete Verena (Varenne) von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) in 1352. Verena (Tochter von Herr Thiébaud IV. von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) und Agnes von Geroldseck am Wasichen (Ès-Vosges)) gestorben in 1372. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 287. |  Heinrich III. von Fürstenberg Heinrich III. von Fürstenberg Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 288. |  Katharina von Fürstenberg Katharina von Fürstenberg |
| 289. |  Anna von Fürstenberg Anna von Fürstenberg |
| 290. |  Udelhild von Fürstenberg Udelhild von Fürstenberg Familie/Ehepartner: Heinrich von Blumenegg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 291. |  Guota (Imagina) von Ochsenstein Guota (Imagina) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Donat von Vaz. Donat (Sohn von Walter V. von Vaz und Luitgard (Liukarda) von Kirchberg) gestorben am 23 Apr 1337/38 in Churwalden, GR, Schweiz; wurde beigesetzt in Churwalden, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 292. |  Markgraf Rudolf III. von Hachberg-Sausenberg Markgraf Rudolf III. von Hachberg-Sausenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Hachberg-Sausenberg) Rudolf heiratete Adelheid von Lichtenberg in 1373. Adelheid (Tochter von Simund von Lichtenberg und Gräfin Adelheid von Helfenstein) wurde geboren in 1353; gestorben in vor 28 Apr 1378. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Anna von Freiburg-Neuenburg in 1387. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 293. |  Ulrich von Altenklingen Ulrich von Altenklingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Klingen_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Freiin von Regensberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 294. |  Amalia von Altenklingen Amalia von Altenklingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Albrecht von Bussnang. Albrecht (Sohn von Ritter Konrad von Bussnang und von Krenkingen) gestorben am 12 Mai 1352 in Ilanz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 295. |  Pfalzgraf Walram II. (I.) von Thierstein-Pfeffingen Pfalzgraf Walram II. (I.) von Thierstein-Pfeffingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Gräfin Agnes von Aarberg-Aarberg. Agnes (Tochter von Graf Wilhelm von Aarberg-Aarberg und von Wädenswil) gestorben in spätestens 1345. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 296. |  Guta von Landau Guta von Landau Notizen: Name: Guta heiratete Albrecht von Aichelberg in 1350 in Aichelberg, Baden-Württrmberg, DE. Albrecht (Sohn von Graf Diepold II. von Aichelberg und Gräfin Agnes von Rechberg) wurde geboren in 1310 in Eichelberg, Östringen, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 15 Jun 1365 in Köngen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 297. |  Rudolf III. von Werdenberg-Sargans Rudolf III. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberg_(Adelsgeschlecht)#Grafen_von_Werdenberg-Sargans Familie/Ehepartner: Ursula von Vaz. Ursula (Tochter von Donat von Vaz und Guota (Imagina) von Ochsenstein) gestorben am 4 Apr 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 298. |  Burkhart von Uesenberg Burkhart von Uesenberg Familie/Ehepartner: von Hewen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 299. |  Diethelm von Toggenburg Diethelm von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Adelheid von Griessenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 300. |  Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf,_Count_Palatine_of_the_Rhine Adolf heiratete Prinzessin Irmengard von Oettingen in 1320. Irmengard (Tochter von Graf Ludwig VI. von Oettingen und Agnes von Württemberg) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 6 Nov 1389. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 301. |  Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Johann III. von Sponheim-Starkenburg in 1331. Johann (Sohn von Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg und Gräfin Loretta von Salm) wurde geboren in 1315; gestorben am 20 Dez 1398; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 302. |  Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde heiratete Herr Nikolaus II. zu Werle in nach 1308. Nikolaus (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in vor 1275; gestorben am 18 Feb 1316 in Pustow (Pustekow). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 303. |  Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia heiratete Herzog Magnus I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen) in 1327. Magnus (Sohn von Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen), der Fette und Herzogin Rixa von Werle) wurde geboren in 1304; gestorben in 1369. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 304. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Grubenhagen. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in cir 1289; gestorben in 1351. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 305. |  Mathilde (Mechthild) von Bayern Mathilde (Mechthild) von Bayern Notizen: Mathilde und Friedrich II. hatten neun Kinder, vier Töchter und fünf Söhne. Mathilde heiratete Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) in 1328 in Nürnberg, Bayern, DE. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) und Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk) wurde geboren am 30 Nov 1310 in Gotha; gestorben am 19 Nov 1349 in Wartburg, Thüringen, DE; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 306. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_V._(Bayern) Ludwig heiratete Margarete von Dänemark am 30 Nov 1324 in Königreich Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ am 10 Feb 1342 in Schloss Tirol. Margarete (Tochter von Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) und Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen)) wurde geboren in 1318 in Grafschaft Tirol; gestorben am 3 Okt 1369 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 307. |  Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stephan mit der Hafte (* 1319; † Mai 1375 in Landshut oder München) war von 1347 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Er war der zweite Sohn Kaiser Ludwigs des Bayern aus dessen erster Ehe mit Beatrix von Schlesien-Schweidnitz. Stephan heiratete Prinzessin Elisabeth (Isabel) von Sizilien (von Aragôn) am 27 Jun 1328 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 21 Mrz 1349 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Stephan heiratete Margarete von Nürnberg in 14 Feb1359 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 308. | Kurfürst Ludwig VI. von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VI._(Bayern) |
| 309. |  Gräfin Elisabeth von Bayern Gräfin Elisabeth von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Bayern_(1329–1402) (Jun 2018) Elisabeth heiratete Herr von Verona Cangrande II. della Scala (Scaliger) am 22 Nov 1350. Cangrande (Sohn von Herr Mastino II. della Scala (Scaliger) und Taddea von Carrara) wurde geboren am 7 Jun 1332; gestorben am 14 Dez 1359 in Verona; wurde beigesetzt in Scalinger-Grabmäler, Verona. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Ulrich von Württemberg in 1362. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner und Elisabeth von Henneberg-Schleusingen) wurde geboren in nach 1340; gestorben am 23 Aug 1388. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 310. |  Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Bayern) Albrecht heiratete Margarete von Liegnitz-Brieg am 19 Jul 1353 in Passau. Margarete (Tochter von Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg und Agnes von Glogau-Sagan) wurde geboren in 1342/43; gestorben in 1386. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 311. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Judith heiratete Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere in 1 Jan 1317 / 1 Feb 1319. Heinrich (Sohn von Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen und Adelheid von Hessen) wurde geboren in vor 1300; gestorben am 10 Sep 1347 in Schleusingen, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 312. |  Markgraf Johann V. von Brandenburg Markgraf Johann V. von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_V._(Brandenburg) Johann heiratete Katharina von Glogau in Datum unbekannt. Katharina (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 313. |  Mathilde von Brandenburg Mathilde von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Mathilde heiratete Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in 1292; gestorben am 22 Jan 1342 in Sagan, Lebus, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 314. | Elisabeth von Breslau (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Elisabeth und Konrad I. scheinen keine Kinder gehabt zu haben. Elisabeth heiratete Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) in 1322. Konrad (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in cir 1294; gestorben am 22 Dez 1366. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 315. |  Euphemia von Breslau Euphemia von Breslau Notizen: Euphemia und Bolko II. hatten sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Euphemia heiratete Herzog Bolko II. (Boleslaus) von Falkenberg (von Oppeln) in cir 1325. Bolko (Sohn von Herzog Bolko I. (Boleslaw) von Oppeln und Gremislawa (oder Agnes)) wurde geboren in ca 1290/1295; gestorben in ca 1362/1365; wurde beigesetzt in Sankt-Annen-Kapelle, Franziskanerkloster, Oppeln. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 316. |  Herzog Rudolf von Lothringen Herzog Rudolf von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_(Lothringen) Rudolf heiratete Marie von Châtillon (Blois) in 1334. Marie (Tochter von Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) und Marguerite (Margarete) von Valois (Kapetinger)) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Alienor von Bar-Scarponnois am 25 Jun 1329. Alienor (Tochter von Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois und Marie von Burgund) gestorben in 1333. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 317. |  Margarete von Österreich Margarete von Österreich Margarete heiratete Graf Meinhard III. von Tirol in Jun 1359 in Passau. Meinhard (Sohn von Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ ) wurde geboren in 1344 in Landshut, Bayern, DE; gestorben am 13 Jan 1363 in Schloss Tirol oder in Meran. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Markgraf Johann Heinrich von Luxemburg am 26 Feb 1364. Johann wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechien ; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 318. |  Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV._(Österreich) Rudolf heiratete Katharina von Luxemburg (von Böhmen) in Jul 1356. Katharina (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren in 1342 in Prag, Tschechien ; gestorben am 26 Apr 1395 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 319. |  Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_III._(Österreich) Albrecht heiratete Elisabeth von Luxemburg (von Böhmen) in 1366. Elisabeth (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Anna von Schweidnitz) wurde geboren am 19 Mrz 1358 in Prag, Tschechien ; gestorben in 04 od 19 Sept 1373 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Albrecht heiratete Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern) in 1375. Beatrix (Tochter von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) und Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner)) wurde geboren in 1355; gestorben in 1414. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 320. |  Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_III._von_Habsburg (Mai 2018) Leopold heiratete Herzogin Viridis Visconti in 1365 in Wien. Viridis (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in cir 1350; gestorben am 1 Mrz 1414; wurde beigesetzt in Kloster Sittich oder in der Familiengruft zu Mailand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 321. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Habsburg_(1320–1349) Katharina heiratete Herr Enguerrand VI. von Coucy in Nov 1338. Enguerrand (Sohn von Herr Guillaume I. von Coucy) wurde geboren in 1313; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 322. |  Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Name: Agnes heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in 1328. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 323. |  Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Fürst Albrecht II. von Anhalt-Zerbst-Köthen. Albrecht gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 324. |  Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_I._(Sachsen-Wittenberg) Wenzel heiratete Cäcilia (Siliola) von Carrara am 23 Jan 1376. Cäcilia (Tochter von Franz von Carrara und Fina di Pataro) wurde geboren in cir 1350; gestorben in cir 1435 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 325. |  König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Ungarn) Ludwig heiratete Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) in 1345. Margarethe (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren am 25 Mai 1335 in Prag, Tschechien ; gestorben am 7 Sep 1349 in Visegrád, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Königin Elisabeth von Bosnien. Elisabeth (Tochter von Stjepan II. Kotromanić von Bosnien und Elisabeth (Jelisaveta) von Kujawien) wurde geboren in 1340; gestorben am 16 Jan 1387; wurde beigesetzt in Ihr Leichnam wurde in einen Fluss geworfen oder sie verstarb in der Gefangenschaft. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 326. |  Jutta (Bonne) von Luxemburg Jutta (Bonne) von Luxemburg Notizen: Jutta und Johann hatten ab 1336 in zwölf Jahren elf Kinder, von denen sieben das Erwachsenenalter erreichten, vier Söhne und drei Töchter. Jutta heiratete König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute am 23 Jul 1332. Johann (Sohn von König Philipp VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Johanna von Burgund) wurde geboren am 16 Apr 1319 in Schloss Gué de Maulny, Le Mans; gestorben am 8 Apr 1364 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 327. |  Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: 1. Ehe: Karl IV. heiratete 1329 Blanca Margarete von Valois. Karl heiratete Prinzessin Blanca Margarete von Valois in 1323 in Paris, France. Blanca (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Mathilde von Châtillon (Blois)) wurde geboren in 1316/1317; gestorben am 1 Aug 1348 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Königin Anna von der Pfalz (Wittelsbacher) in Mrz 1349 in Burg Stahleck. Anna wurde geboren am 26 Sep 1329; gestorben am 2 Feb 1353 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Anna von Schweidnitz in 1353. Anna wurde geboren in 1339; gestorben am 11 Jul 1362 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Kaiserin Elisabeth von Pommern am 21 Mai 1363 in Krakau, Polen. Elisabeth (Tochter von Herzog Bogislaw V. von Pommern (Greifen) und Prinzessin Elisabeth von Polen) wurde geboren in cir 1345; gestorben am 14 Feb 1393 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 328. |  Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Liegnitz) Ludwig heiratete Agnes von Glogau-Sagan in zw 1341 und 1345. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) und Mathilde von Brandenburg) gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 329. |  Ursula von Vaz Ursula von Vaz Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Rudolf III. von Werdenberg-Sargans. Rudolf (Sohn von Rudolf II. von Werdenberg-Sargans und Adelheid von Burgau) gestorben am 27 Dez 1361 in Chiavenna, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 330. |  Johann III. von Sponheim-Starkenburg Johann III. von Sponheim-Starkenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Sponheim-Starkenburg) Johann heiratete Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) in 1331. Mechthild (Tochter von Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler und Prinzessin Mechthild von Nassau) wurde geboren in 1312; gestorben in 1375. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 331. |  Herr Rudolf III. von Neuenburg-Nidau Herr Rudolf III. von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Imier de Neuchâtel-Strassberg, (? - 03 mai 1364), comte de Strassberg. Conseiller du duc d'Autriche. Accablé de dettes il vend en 1327 son domaine de Balm à Rodolphe III de Neuchâtel-Nidau, puis quelque temps avant son décès il cède Büren à Rodolphe IV de Neuchâtel-Nidau. Familie/Ehepartner: Jonata von Neuenburg. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Verena (Varenne) von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont). Verena (Tochter von Herr Thiébaud IV. von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) und Agnes von Geroldseck am Wasichen (Ès-Vosges)) gestorben in 1372. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Gräfin Jeanne von Habsburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 332. | Propst Hartmann von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 333. |  Graf Imier von Neuenburg-Strassberg Graf Imier von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Imier de Neuchâtel-Strassberg, (? - 03 mai 1364), comte de Strassberg1,2. Conseiller du duc d'Autriche. Accablé de dettes il vend en 1327 son domaine de Balm à Rodolphe III de Neuchâtel-Nidau, puis quelque temps avant son décès il cède Büren à Rodolphe IV de Neuchâtel-Nidau. Familie/Ehepartner: Marguerite von Wolhusen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 334. |  Elisabeth von Truhendingen Elisabeth von Truhendingen Familie/Ehepartner: Graf Berthold V. von Graisbach (von Neifen). Berthold (Sohn von Graf Albert II. von Neuffen (Neifen) und Elisabeth von Graisbach) gestorben am 19 Feb 1342. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 335. |  Anna von Truhendingen Anna von Truhendingen Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Truhendingen_(Adelsgeschlecht) |
| 336. |  Ulrich III. von Hanau Ulrich III. von Hanau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_III._(Hanau) Ulrich heiratete Adelheid von Nassau in Datum unbekannt. Adelheid (Tochter von Graf Gerlach I von Nassau und Agnes von Hessen) gestorben am 8 Aug 1344. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 337. |  Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Eberhard_II,_Count_of_W%C3%BCrttemberg Eberhard heiratete Elisabeth von Henneberg-Schleusingen in vor 17 Sep 1342. Elisabeth (Tochter von Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere und Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel) wurde geboren in 1319; gestorben am 30 Mrz 1389. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 338. |  Prinzessin Irmengard von Oettingen Prinzessin Irmengard von Oettingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Irmengard_of_Oettingen Irmengard heiratete Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche in 1320. Adolf (Sohn von Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler und Prinzessin Mechthild von Nassau) wurde geboren am 27 Sep 1300 in Wolfratshausen; gestorben am 29 Jan 1327 in Neustadt an der Weinstraße; wurde beigesetzt in Zisterzienserkloster Schönau nahe Heidelberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 339. |  Herr Kraft III. von Hohenlohe-Weikersheim Herr Kraft III. von Hohenlohe-Weikersheim Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft_III._(Hohenlohe-Weikersheim) Kraft heiratete Landgräfin Anna von Leuchtenberg am 12 Mrz 1340. Anna (Tochter von Landgraf Ulrich I. von Leuchtenberg und Anna von Nürnberg) gestorben am 11 Jun 1390. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 340. |  Irmengard (Irmgard) von Hohenlohe-Weikersheim Irmengard (Irmgard) von Hohenlohe-Weikersheim Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_von_Nassau Familie/Ehepartner: Burggraf Konrad II. (IV.) von Nürnberg (von Zollern). Konrad (Sohn von Burggraf Friedrich IV. (Frederick) von Nürnberg (Hohenzollern) und Margarethe (Margareta) von Kärnten) gestorben in 1334. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Graf Gerlach I von Nassau. Gerlach (Sohn von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1258; gestorben am 7 Jan 1361 in Burg Sonnenberg; wurde beigesetzt in Kloster Klarenthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 341. |  Graf Diepold II. von Aichelberg Graf Diepold II. von Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Gräfin Agnes von Rechberg in Datum unbekannt. Agnes wurde geboren in 1270 in Rechberg, Schwäbisch Gmünd, DE . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 342. |  Markgraf Heinrich III. von Burgau Markgraf Heinrich III. von Burgau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._von_Burgau |
| 343. |  Elisabeth von Montfort Elisabeth von Montfort Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Montfort_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Eberhard Truchsess von Waldburg. Eberhard (Sohn von Otto Bertold Truchsess von Waldburg) gestorben am 30 Dez 1291. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 344. |  Graf Hugo IV. von Montfort zu Feldkirch Graf Hugo IV. von Montfort zu Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Anna von Veringen. Anna (Tochter von Graf Heinrich von Veringen (von Altveringen) und Verena von Klingen) wurde geboren in cir 1278; gestorben in 1320 in Neuburg, Oesterreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 345. |  Bischof Rudolf III. von Montfort-Feldkirch Bischof Rudolf III. von Montfort-Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._von_Montfort |
| 346. |  Ulrich II. von Montfort-Feldkirch Ulrich II. von Montfort-Feldkirch |
| 347. |  Johannes Truchsess von Waldburg Johannes Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Elisabeth von Habsburg-Laufenburg. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Katharina von Cilly. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Magdalena von Montfort. [Familienblatt] [Familientafel] Johannes heiratete Ursula von Abendsberg am 28 Feb 1395. Ursula (Tochter von Graf Ulrich IV. von Abensberg und Katharina von Lichtenstein) gestorben am 30 Jan 1422. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 348. |  Mathilde von Habsburg Mathilde von Habsburg Mathilde heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 24 Okt 1273 in Aachen, Deutschland. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 349. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(HRR) Albrecht heiratete Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) am 20 Nov 1274 in Wien. Elisabeth (Tochter von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1262 in München, Bayern, DE; gestorben am 28 Okt 1313 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Zuerst Kloster Königsfelden, 1770 in das Kloster St. Blasien, 1809 nach Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 350. |  Katharina von Habsburg Katharina von Habsburg Notizen: Katharina hatte mit Otto III. zwei Kinder, die Zwillinge Rudolf und Heinrich, die allerdings schon im Jahr ihrer Geburt, 1280, gestorben waren. Katharina heiratete König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) in cir 1279 in Wien. Otto (Sohn von Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren am 11 Feb 1261; gestorben am 9 Sep 1312 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 351. |  Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Notizen: Agnes hatte mit Albrecht II. sechs Kinder. Agnes heiratete Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1273. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) und Helene von Braunschweig) wurde geboren in cir 1250; gestorben am 25 Aug 1298 in Schlachtfeld bei Aken an der Elbe; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 352. | 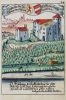 Klementia von Habsburg Klementia von Habsburg Notizen: Klementia und Karl Martell von Ungarn hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Klementia heiratete Karl Martell von Ungarn (von Anjou) am 11 Jan 1281 in Wien. Karl (Sohn von Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme und Maria von Ungarn) wurde geboren am 8 Sep 1271; gestorben am 19 Aug 1295 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 353. |  Graf Hartmann von Habsburg Graf Hartmann von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmann_von_Habsburg Familie/Ehepartner: Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt). Johanna (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren in 1272 in Schlachtfeld vor Akkon, Israel; gestorben am 23 Apr 1307 in Clare Castle, Suffolk; wurde beigesetzt in Augustinerpriorei Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 354. | 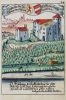 Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Österreich) Rudolf heiratete Agnes von Böhmen (Přemysliden) in 1289 in Prag, Tschechien . Agnes (Tochter von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren in 1269; gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 355. |  Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guta_von_Habsburg Guta heiratete König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) am 7 Feb 1285 in Prag, Tschechien . Wenzel (Sohn von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren am 27 Sep 1271; gestorben am 21 Jun 1305 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Kirche des Kloster Königsaal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 356. |  Otto III. von Ochsenstein Otto III. von Ochsenstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Lichtenberg. Kunigunde (Tochter von Heinrich II von Lichtenberg und Adelheid von Eberstein) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 357. |  Katharina von Ochsenstein Katharina von Ochsenstein Katharina heiratete Emich V. von Leiningen in Datum unbekannt. Emich (Sohn von Graf Emich IV. von Leiningen und Elisabeth) gestorben in 1289. [Familienblatt] [Familientafel] Katharina heiratete Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Heinrich I. von Sponheim-Starkenburg und Blancheflor von Jülich) wurde geboren in zw 1265 und 1270; gestorben in 22 Feb oder 29 Mrz 1324. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 358. |  Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg. Berthold (Sohn von Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg und Jeanne von Granges) gestorben in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 359. |  Graf Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Habsburg-Laufenburg) Rudolf heiratete Elisabeth von Rapperswil in 1296. Elisabeth (Tochter von Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) und Mechthild von Neifen) wurde geboren in ca 1251 oder 1261; gestorben in 1309 in Vermutlich Rapperswil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 360. |  Graf Werner I. (III.) von Homberg Graf Werner I. (III.) von Homberg Familie/Ehepartner: Kunigunde. Kunigunde gestorben in 20 Sep. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 361. |  Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I,_Duke_of_Bavaria Rudolf heiratete Prinzessin Mechthild von Nassau am 1 Sep 1294 in Nürnberg, Bayern, DE. Mechthild (Tochter von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1280; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 362. |  Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Fürst Otto II. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1288. Otto (Sohn von Herzog Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) und Liutgard von Holstein) wurde geboren in cir 1266; gestorben am 10 Apr 1330; wurde beigesetzt in Kloster St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 363. |  Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes heiratete Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) in 1303. Heinrich (Sohn von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren am 21 Mrz 1256; gestorben am 14 Feb 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Landgraf Heinrich von Hessen in 1290. Heinrich wurde geboren in 1264; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 364. |  Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(HRR) Ludwig heiratete Beatrix von Schlesien-Schweidnitz in cir 1308. Beatrix (Tochter von Herzog Bolko I. von Schlesien (von Schweidnitz) (Piasten) und Beatrix von Brandenburg) wurde geboren in cir 1290; gestorben am 24 Aug 1322 in München, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Margarethe von Hennegau (von Holland) am 25 Feb 1324 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Margarethe (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in ca 1307 / 1310 in Valenciennes ?; gestorben am 23 Jun 1356 in Quesnoy; wurde beigesetzt in Minoritenkirche zu Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 365. |  Anna von Habsburg Anna von Habsburg Notizen: Anna und Hermann (III.) der Lange hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange in 1295. Hermann (Sohn von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) wurde geboren in cir 1275; gestorben am 1 Feb 1308 in bei Lübz; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 18 Mrz 1294; gestorben am 24 Nov 1335; wurde beigesetzt in Klarissenkloster, Breslau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 366. |  Agnes von Habsburg (von Ungarn) Agnes von Habsburg (von Ungarn) Notizen: Über Kinder von Agnes mit Andreas III. ist nichts bekannt. Agnes heiratete König Andreas III. von Ungarn (Árpáden), der Venezianer am 13 Feb 1296 in Wien. Andreas (Sohn von Prinz Stephan von Slowenien (von Ungarn) (Árpáden) und Katharina Morosini (Morossini)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 14 Jan 1301. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 367. |  Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Böhmen) Rudolf heiratete Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) in 1300. Blanka (Tochter von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in cir 1285 in Paris, France; gestorben am 1 Mrz 1305 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen am 16 Okt 1306. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 368. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nancy und Friedrich IV. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Elisabeth heiratete Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur in 1307 in Nancy, FR. Friedrich (Sohn von Herzog Theobald II. von Lothringen und Isabelle de Rumigny) wurde geboren am 15 Apr 1282 in Gondreville; gestorben am 23 Aug 1328 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 369. |  Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Österreich) (Mai 2018) Albrecht heiratete Herzogin Johanna von Pfirt am 26 Mrz 1324 in Wien. Johanna (Tochter von Ulrich von Pfirt und Prinzessin Johanna von Mömpelgard) wurde geboren in 1300 in Basel, BS, Schweiz; gestorben am 15 Nov 1351 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 370. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(Habsburg) Leopold heiratete Prinzessin Katharina von Savoyen am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Katharina (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in zw 1297 und 1304 in Brabant; gestorben am 30 Sep 1336 in Rheinfelden, AG, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann 1770 Dom St. Blasien, dann 1806 Stift Spital Phyrn, dann 1809 Stiftskirchengruft Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 371. |  Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Sachsen-Wittenberg) Rudolf heiratete Jutta (Brigitte) von Brandenburg in 1298. Jutta (Tochter von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) gestorben am 9 Mai 1328 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Kunigunde von Polen am 28 Aug 1328. Kunigunde (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in cir 1293; gestorben in 1333/1335. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Agnes von Lindow-Ruppin in 1333. Agnes (Tochter von Graf Günther ? von Lindow-Ruppin) wurde geboren in cir 1300; gestorben am 9 Mai 1343 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 372. |  König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(Ungarn) Familie/Ehepartner: Maria von Oppeln (von Beuthen). Maria (Tochter von Herzog Kasimir I. von Oppeln (von Beuthen) (Piasten) und Helena N.) gestorben in 1317. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Königin Beatrix von Luxemburg am 24 Jun 1318. Beatrix (Tochter von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren in 1305; gestorben am 11 Nov 1319; wurde beigesetzt in Kathedrale von Varaždin. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Elisabeth von Polen am 6 Jul 1320. Elisabeth (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in 1305; gestorben am 29 Dez 1380 in Budapest. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 373. |  Herzog Johann von Schwaben Herzog Johann von Schwaben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Parricida |
| 374. |  König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_III._(Böhmen) (Feb 2022) Wenzel heiratete Viola Elisabeth von Teschen in 1305. Viola (Tochter von Herzog Mesko I. (Miezko) von Teschen) wurde geboren in 1290; gestorben am 21 Sep 1317. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 375. | Anna Přemyslovna Notizen: Annas Ehe mit Heinrich blieb kinderlos. Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner). Heinrich (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 2 Apr 1335 in Schloss Tirol. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 376. |  Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(Königin_von_Böhmen_1311–1330) (Apr 2018) Elisabeth heiratete König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde in 1310 in Speyer, Pfalz, DE. Johann (Sohn von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren am 10 Aug 1296 in Luxemburg; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 377. | Margarethe von Böhmen Margarethe heiratete Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) in vor 13 Jan 1303. Bolesław (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 23 Sep 1291; gestorben am 21 Apr 1351. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 378. |  Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Herzogin Anna von Teck in cir 1260. Anna (Tochter von Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere und Luitgard von Burgau) wurde geboren in cir 1240 in Teck, Owen, DE; gestorben in 1270 in Eichelberg, Östringen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 379. |  Albrecht von Aichelberg Albrecht von Aichelberg Notizen: Name: Albrecht heiratete Guta von Landau in 1350 in Aichelberg, Baden-Württrmberg, DE. Guta (Tochter von Eberhard III. von Landau und Guta von Gundelfingen) wurde geboren in 1330 in Binswangen, Dillingen an der Donau, Bayern, DE; gestorben am 1 Jun 1384. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 380. |  Johann von Werdenberg-Sargans Johann von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 381. |  von Uesenberg von Uesenberg Familie/Ehepartner: Heinrich von Blumenegg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 382. |  Klementa von Toggenburg Klementa von Toggenburg Familie/Ehepartner: Ulrich von Hohenklingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Heinrich von Hewen. Heinrich gestorben in 1368/69. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 383. |  Eberhard Truchsess von Waldburg Eberhard Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Agnes von Teck. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 384. |  Schweikhart Thumb von Neuburg Schweikhart Thumb von Neuburg Notizen: Name: Schweikhart heiratete Catharina von Erolzheim in 1325 in Untervaz, GR, Schweiz. Catharina wurde geboren in 1302 in Neuberg, Bludenz, Vorarlberg, Österreich; gestorben in cir 1356. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 385. |  Herzlaude von Tengen Herzlaude von Tengen Familie/Ehepartner: Walter V. von Hallwil (Hallwyl). Walter wurde geboren in cir 1320; gestorben in cir 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 386. |  Prinzessin Ingeborg von Schweden Prinzessin Ingeborg von Schweden Notizen: Ingeborg und Gerhard II. hatten vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Ingeborg heiratete Graf Gerhard II. von Holstein (von Plön), der Blinde am 12 Dez 1275. Gerhard (Sohn von Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe und Elisabeth von Mecklenburg) wurde geboren in 1254; gestorben am 28 Okt 1312. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 387. |  Richiza (Rixa) von Schweden Richiza (Rixa) von Schweden Notizen: Richiza und Przemysł II. hatten eine Tochter. Richiza heiratete Przemysł II. von Polen am 11 Okt 1285. Przemysł (Sohn von Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten) und Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten)) wurde geboren am 14 Okt 1257 in Posen; gestorben am 8 Feb 1296 in Rogoźno, Polen; wurde beigesetzt in Kathedrale, Posen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 388. |  Richsa von Dänemark Richsa von Dänemark Richsa heiratete Herr Nikolaus II. zu Werle in 1292. Nikolaus (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in vor 1275; gestorben am 18 Feb 1316 in Pustow (Pustekow). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 389. |  König Christoph II. von Dänemark König Christoph II. von Dänemark Notizen: Vor seiner Heirat hatte er eine Geliebte aus dem Geschlecht der Lunge und mit ihr zwei Kinder: Christoph heiratete Euphemia von Pommern in 1300. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Geliebte des Christoph II. von Dänemark, N. Lunge. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 390. |  Graf Johann III. von Holstein-Kiel (Schauenburg) Graf Johann III. von Holstein-Kiel (Schauenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Holstein-Kiel) (Aug 2023) Johann heiratete Katharina von Glogau in Datum unbekannt. Katharina (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Merislawa von Wittenburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 391. |  Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia heiratete Herzog Magnus I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen) in 1327. Magnus (Sohn von Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen), der Fette und Herzogin Rixa von Werle) wurde geboren in 1304; gestorben in 1369. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 392. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Grubenhagen. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in cir 1289; gestorben in 1351. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 393. | Elisabeth heiratete Landgraf Heinrich II von Hessen in 1321. Heinrich (Sohn von Otto I von Hessen und Adelheid von Ravensberg) wurde geboren in vor 1302; gestorben am 3/6 Jun 1376; wurde beigesetzt in Elisabethkirche, Marburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 394. |  Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Meißen) (Okt 2017) Friedrich heiratete Mathilde (Mechthild) von Bayern in 1328 in Nürnberg, Bayern, DE. Mathilde (Tochter von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Beatrix von Schlesien-Schweidnitz) wurde geboren in 1313; gestorben in 1346; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 395. |  Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Grubenhagen Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Grubenhagen Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Braunschweig-Grubenhagen) (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier). [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Helvis (Heilwig) von Ibelin in 1330. Helvis (Tochter von Philipp von Ibelin und Maria von Gibelet) wurde geboren in 1307; gestorben in nach 1347. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 396. |  Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen) Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen) Notizen: Adelheid hatte mit Heinrich zwei Kinder. Adelheid heiratete Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) am 15 Sep 1315 in Innsbruck, Österreich. Heinrich (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 2 Apr 1335 in Schloss Tirol. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 397. |  Fürst Ernst I. von Braunschweig-Grubenhagen Fürst Ernst I. von Braunschweig-Grubenhagen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_I._(Braunschweig-Grubenhagen) Ernst heiratete Adelheid von Everstein in 1335/36. Adelheid (Tochter von Graf Hermann III. von Everstein und Adelheid zur Lippe) wurde geboren in 1315; gestorben in nach 29 Sep 1373. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 398. |  Mathilde (Mechthild) von Braunschweig Mathilde (Mechthild) von Braunschweig Mathilde heiratete Herr Johann II. von Werle-Güstrow in 1311. Johann (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in nach 1250; gestorben am 27 Aug 1337; wurde beigesetzt in Doberaner Münster. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 399. |  Herzog Wacław von Płock Herzog Wacław von Płock Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wacław_von_Płock Wacław heiratete Elisabeth von Litauen in 1316. Elisabeth wurde geboren in 1302; gestorben in 1364. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 400. |  Herzog Johann von Schwaben Herzog Johann von Schwaben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Parricida |
| 401. |  König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_III._(Böhmen) (Feb 2022) Wenzel heiratete Viola Elisabeth von Teschen in 1305. Viola (Tochter von Herzog Mesko I. (Miezko) von Teschen) wurde geboren in 1290; gestorben am 21 Sep 1317. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 402. | Anna Přemyslovna Notizen: Annas Ehe mit Heinrich blieb kinderlos. Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner). Heinrich (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 2 Apr 1335 in Schloss Tirol. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 403. |  Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(Königin_von_Böhmen_1311–1330) (Apr 2018) Elisabeth heiratete König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde in 1310 in Speyer, Pfalz, DE. Johann (Sohn von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren am 10 Aug 1296 in Luxemburg; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 404. | Margarethe von Böhmen Margarethe heiratete Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) in vor 13 Jan 1303. Bolesław (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 23 Sep 1291; gestorben am 21 Apr 1351. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 405. |  Herzog Nikolaus II. von Troppau Herzog Nikolaus II. von Troppau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_II._(Troppau) Nikolaus heiratete Anna von Ratibor (von Oppeln) (Piasten) in 1318. Anna (Tochter von Herzog Primislaus (Przemko) von Ratibor (von Oppeln) (Piasten) und Anna von Masowien) gestorben in 1338/1340. [Familienblatt] [Familientafel]
Nikolaus heiratete Hedwig von Oels (von Glogau) in 1342/1345. Hedwig (Tochter von Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) und Euphemia von Beuthen (von Cosel) (Piasten)) gestorben in 1359. [Familienblatt] [Familientafel] Nikolaus heiratete Jutta von Falkenberg (von Oppeln) in 1360. Jutta (Tochter von Herzog Bolko II. (Boleslaus) von Falkenberg (von Oppeln) und Euphemia von Breslau) gestorben in nach 1378. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 406. |  Beatrix von Brandenburg Beatrix von Brandenburg Beatrix heiratete Herzog Bolko I. von Schlesien (von Schweidnitz) (Piasten) in 1286. Bolko (Sohn von Herzog Boleslaw II. von Schlesien (Piasten) und Hedwig von Anhalt) wurde geboren in cir 1253; gestorben am 9 Nov 1301; wurde beigesetzt in Fürstenkapelle des Kloster Grüssau. [Familienblatt] [Familientafel]
Beatrix heiratete Herzog Wladislaus von Beuthen (von Cosel) (Piasten) am 1308 oder später. Wladislaus (Sohn von Herzog Kasimir II. von Oppeln-Beuthen (von Cosel) (Piasten) und Helena) wurde geboren in ca 1277/1283; gestorben in 1352. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 407. |  Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_(Brandenburg) Hermann heiratete Anna von Habsburg in 1295. Anna (Tochter von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1275/80; gestorben in 1326, 1327 oder 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 408. |  Jutta (Brigitte) von Brandenburg Jutta (Brigitte) von Brandenburg Notizen: Geburt: Jutta heiratete Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1298. Rudolf (Sohn von Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg) wurde geboren in 1284 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; gestorben am 12 Mrz 1356 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; wurde beigesetzt in Schlosskirche, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 409. | Beatrix von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrix_von_Brandenburg Beatrix heiratete Herr Heinrich II. von Mecklenburg in 1292 in Burg Stargard. Heinrich (Sohn von Fürst Heinrich I. von Mecklenburg und Anastasia von Pommern (Greifen)) wurde geboren in nach 14 Apr 1266; gestorben am 21 Jan 1329 in Sternberg, Pommern. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 410. | Margarete von Brandenburg Notizen: Margarete und Przemysł hatten keine Kinder. Margarete heiratete Przemysł II. von Polen in 1291. Przemysł (Sohn von Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten) und Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten)) wurde geboren am 14 Okt 1257 in Posen; gestorben am 8 Feb 1296 in Rogoźno, Polen; wurde beigesetzt in Kathedrale, Posen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 411. |  Agnes von Limburg Agnes von Limburg Agnes heiratete Graf Eberhard I. von Isenberg-Limburg zu Styrum in cir 1289. Eberhard (Sohn von Dietrich (Diderik) von Isenberg (von Altena) und Adelheid von Sponheim-Starkenberg (von Sayn)) wurde geboren in 1252; gestorben am 17 Jun 1304. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 412. |  Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne) Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna von Navarra und Philippe IV. zeugten 7 Kinder, von denen 3 Söhne und eine Tochter das Erwachsenenalter erreichten Johanna heiratete König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne am 16 Aug 1284 in Paris, France. Philipp (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Königin Isabella von Aragón) wurde geboren in 1268 in Fontainebleau, Frankreich; gestorben am 29 Nov 1314 in Fontainebleau, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 413. |  Graf Henry Plantagenêt (Lancaster) Graf Henry Plantagenêt (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Plantagenet,_3._Earl_of_Lancaster (Apr 2018) Henry heiratete Maud (Matilda) de Chaworth in 1297. Maud (Tochter von Patrick von Chaworth und Isabella de Beauchamp) wurde geboren in cir 1282 in Chaworth; gestorben in cir 1322. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 414. |  Graf Philippe von Artois Graf Philippe von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippe_d’Artois_(Conches) (Nov 2018) Philippe heiratete Blanche (Blanka) von der Bretagne in Nov oder Dez 1281. Blanche (Tochter von Herzog Johann II. von der Bretagne und Prinzessin Beatrix von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1270; gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 415. |  Mathilde (Mahaut) von Artois Mathilde (Mahaut) von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_(Artois) Mathilde heiratete Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) in 1285. Otto (Sohn von Hugo von Chalon (Salins) und Adelheid von Meranien (von Andechs)) wurde geboren in cir 1238; gestorben am 26 Mrz 1303. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 416. |  Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_I._(Blois) Guy heiratete Marguerite (Margarete) von Valois (Kapetinger) am 6 Okt 1310. Marguerite (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Marguerite von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1295; gestorben in Jul 1342. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 417. |  Graf Johann von Châtillon-Saint-Pol (Haus Blois) Graf Johann von Châtillon-Saint-Pol (Haus Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Jeanne de Fiennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 418. |  Mathilde von Châtillon (Blois) Mathilde von Châtillon (Blois) Notizen: Mathilde und Karl I. hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Mathilde heiratete Karl I. von Valois (Kapetinger) in Jun 1308 in Poitiers. Karl (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Königin Isabella von Aragón) wurde geboren am 12 Mrz 1270 in Schloss Vincennes; gestorben am 05/06 Dez 1325 in Nogent-le-Roi, Frankreich; wurde beigesetzt in Kirche Saint-Jacques, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 419. |  Graf Johann III. von Brienne Graf Johann III. von Brienne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._von_Eu Familie/Ehepartner: Johanna von Guînes (von Gent). Johanna (Tochter von Herr Enguerrand V. (Balduin?) von Coucy (von Guînes-Gent)) gestorben in 1332. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 420. |  Isabelle von Brienne Isabelle von Brienne Notizen: Geburt: Isabelle heiratete Johann II. (Jean) von Dampierre in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre und Laura von Lothringen) gestorben in vor 1307. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 421. |  Herzog Johann II. von Brabant Herzog Johann II. von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Das einzige Kind von Johann II. und Margaret war Johann III. (1300–1355), Herzog von Brabant und Limburg. Johann heiratete Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt) am 9 Jul 1290 in Westminster Abbey, London, England. Margaret (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren am 11 Sep 1275; gestorben in 1333. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 422. |  Königin Margarete von Brabant Königin Margarete von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Brabant (Okt 2017) Margarete heiratete Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) in 1292. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich VI. von Luxemburg und Beatrix von Avesnes) wurde geboren in 1278/1279 in Valenciennes, Frankreich; gestorben am 24 Aug 1313 in Buonconvento bei Siena; wurde beigesetzt in Dom von Pisa. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 423. |  Maria (Marie) von Brabant Maria (Marie) von Brabant Maria heiratete Graf Amadeus V. von Savoyen in 1297. Amadeus (Sohn von Graf Thomas II. von Savoyen und Béatrice (Beatrix) dei Fieschi) wurde geboren in 1252/1253; gestorben am 16 Okt 1323 in Avignon, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 424. |  Elisabeth von Brabant-Arschot Elisabeth von Brabant-Arschot Elisabeth heiratete Graf Gerhard V. von Jülich in Datum unbekannt. Gerhard (Sohn von Graf Wilhelm IV von Jülich und Richarda von Geldern) wurde geboren in vor 1250; gestorben am 29 Jul 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 425. |  Graf Ludwig von Évreux Graf Ludwig von Évreux Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_(Évreux) Ludwig heiratete Margarete von Artois in Anfang 1301. Margarete (Tochter von Graf Philippe von Artois und Blanche (Blanka) von der Bretagne) wurde geboren in cir 1285; gestorben am 24 Apr 1311. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 426. |  Margarethe von Frankreich Margarethe von Frankreich Notizen: Margarethe und Eduard I. hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Margarethe heiratete König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer am 10 Sep 1299 in Canterbury. Eduard (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 17 Jun 1239 in Westminster; gestorben am 7 Jul 1307 in Burgh by Sands, Grafschaft Cumberland, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 427. | Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) Blanka heiratete Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) in 1300. Rudolf (Sohn von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1282; gestorben am 4 Jul 1307 in bei Horaschdowitz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 428. |  König Dionysius von Portugal König Dionysius von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_of_Portugal Dionysius heiratete Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal am 24 Jun 1282. Isabella (Tochter von König Peter III. von Aragón und Konstanze von Sizilien (Staufer)) wurde geboren am 4 Jan 1271 in Saragossa; gestorben am 4 Jul 1336 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Santa Clara-a-Velha in Coimbra, dann Kloster Santa Clara-a-Nova. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Aldonça Rodrigues Talha. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Grácia Froes. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Marinha Gomes. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 429. |  Herr Alfonso von Portugal Herr Alfonso von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_de_Portugal,_Senhor_de_Portalegre (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Violante Manuel von Kastilien. Violante (Tochter von Graf Manuel von Kastilien und Konstanze (Constance) von Aragón) wurde geboren in 1265; gestorben in 1306. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 430. |  Yolande (Violante) (Irene) von Montferrat (Aleramiden) Yolande (Violante) (Irene) von Montferrat (Aleramiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Yolande und Andronikos II. hatten vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Yolande heiratete Andronikos II. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) in 1284. Andronikos (Sohn von Kaiser Michael VIII. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) und Theodora Dukaina Komnene Palaiologina Batatzaina (Byzanz)) wurde geboren am 25 Mrz 1259 in Nikaia; gestorben am 13 Feb 1332 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 431. |  Prinzessin Isabella von Kastilien Prinzessin Isabella von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_von_Kastilien_(1283–1328) (Aug 2023) Isabella heiratete König Jakob II. von Aragón in 1291 in Soria, und geschieden in 1295. Jakob (Sohn von König Peter III. von Aragón und Konstanze von Sizilien (Staufer)) wurde geboren am 10 Aug 1267; gestorben am 2 Nov 1327 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 432. |  König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_IV._(Kastilien) (Okt 2017) Ferdinand heiratete Konstanze von Portugal in 1302. Konstanze (Tochter von König Dionysius von Portugal und Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal ) wurde geboren am 3 Jan 1290; gestorben am 18 Nov 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 433. |  Beatrix von Kastilien Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix von Kastilien hatte mit Alfons IV. sieben Kinder, drei Töchter und vier Söhne. Beatrix heiratete König Alfons IV. von Portugal, der Kühne in 1309. Alfons (Sohn von König Dionysius von Portugal und Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal ) wurde geboren am 8 Feb 1291 in Coimbra; gestorben am 28 Mai 1357 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 434. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Beatriz heiratete Herr Pedro Fernandes de Castro in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 435. |  Constança Manuel de Villena (Castilla) Constança Manuel de Villena (Castilla) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Constança_Manuel (Aug 2023) Constança heiratete König Alfons XI. von Kastilien in cir 1325, und geschieden in 1327. Alfons (Sohn von König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) und Konstanze von Portugal) wurde geboren am 13 Aug 1311 in Salamanca; gestorben am 26 Mrz 1350 in vor Gibraltar; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel] Constança heiratete König Peter I. von Portugal in 1339. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren am 8 Apr 1320 in Coimbra; gestorben am 18 Jan 1367 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 436. |  Juana Manuel de Villena Juana Manuel de Villena Familie/Ehepartner: Heinrich II. von Kastilien (Trastámara). Heinrich (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Leonor Núñez de Guzmán) wurde geboren am 13 Jan 1334 in Sevilla; gestorben am 29 Mai 1379 in Santo Domingo de la Calzada; wurde beigesetzt in Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 437. |  Guta von Gundelfingen Guta von Gundelfingen Notizen: Name: Guta heiratete Eberhard III. von Landau in 1330 in Burg Landau. Eberhard (Sohn von Eberhard II. von Grüningen-Landau und Irmgard von Pfirt) wurde geboren in cir 1306 in Burg Landau; gestorben in 1368. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 438. |  Graf Heinrich IV. von Fürstenberg Graf Heinrich IV. von Fürstenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 439. |  Margareta von Blumenegg Margareta von Blumenegg Familie/Ehepartner: Hermann V von Landenberg-Greifensee. Hermann (Sohn von Hermann IV von Landenberg-Greifensee und Elisabeth von Schellenberg) gestorben am 18 Jun 1387 in Thann i.E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 440. |  Ursula von Vaz Ursula von Vaz Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Rudolf III. von Werdenberg-Sargans. Rudolf (Sohn von Rudolf II. von Werdenberg-Sargans und Adelheid von Burgau) gestorben am 27 Dez 1361 in Chiavenna, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 441. |  Markgraf Wilhelm von Hachberg-Sausenberg Markgraf Wilhelm von Hachberg-Sausenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Hachberg-Sausenberg) Wilhelm heiratete Elisabeth von Montfort-Bregenz in cir 1425. Elisabeth (Tochter von Wilhelm VII. von Montfort-Bregenz) wurde geboren in 1390 er in Bregenz, Österreich; gestorben in 7 Jun 1457 oder 1458 in Konstanz, Baden, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 442. |  Verena von Altenklingen Verena von Altenklingen Notizen: 1371-1379 urkundlich bezeugt. Familie/Ehepartner: Ulrich von Landenberg-Greifensee. Ulrich (Sohn von Ulrich von Landenberg-Greifensee) wurde geboren in Zürich, ZH, Schweiz; gestorben am 24 Apr 1413. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 443. |  Klara von Bussnang Klara von Bussnang Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bussnang Familie/Ehepartner: Johannes Truchsess von Diessenhofen, der Ältere . Johannes (Sohn von Johannes Truchsess von Diessenhofen und Elisabeth von Reinach (Rinach)) gestorben in 1357/58. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 444. |  Graf Walram III. (II.) von Thierstein-Pfeffingen Graf Walram III. (II.) von Thierstein-Pfeffingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_von_Thierstein Familie/Ehepartner: Anna von Fürstenberg. [Familienblatt] [Familientafel] Walram heiratete Gisela von Kaisersberg (Kaysersberg) in vor 16 Aug 1380. Gisela gestorben am 22 Dez 1381. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: von Rappoltstein ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 445. |  Katharina von Thierstein-Pfeffingen Katharina von Thierstein-Pfeffingen Familie/Ehepartner: Markgraf Rudolf II. von Hachberg-Sausenberg. Rudolf (Sohn von Markgraf Rudolf I. von Hachberg-Sausenberg und Agnes von Rötteln) wurde geboren in 1301; gestorben in 1352. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 446. |  Anna von Aichelberg Anna von Aichelberg Notizen: Name: Anna heiratete Ritter Hans Thumb von Neuburg in 1382 in Köngen, Baden-Württemberg, DE. Hans (Sohn von Ritter Hans Thumb von Neuburg) wurde geboren in 1354 in Untervaz, GR, Schweiz; gestorben am 17 Jul 1401 in Neuburg, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 447. |  Johann von Werdenberg-Sargans Johann von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 448. |  von Uesenberg von Uesenberg Familie/Ehepartner: Heinrich von Blumenegg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 449. |  Klementa von Toggenburg Klementa von Toggenburg Familie/Ehepartner: Ulrich von Hohenklingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Heinrich von Hewen. Heinrich gestorben in 1368/69. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 450. |  Pfalzgraf Ruprecht II. von der Pfalz (Wittelsbacher) Pfalzgraf Ruprecht II. von der Pfalz (Wittelsbacher) Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_II,_Elector_Palatine Ruprecht heiratete Beatrix von Sizilien in 1345. Beatrix (Tochter von König Peter II. von Aragón (von Sizilien) und Elisabeth von Kärnten) wurde geboren in 1326; gestorben in 1364. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 451. |  Johann IV. von Sponheim-Starkenburg Johann IV. von Sponheim-Starkenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_IV._(Sponheim-Starkenburg) Johann heiratete Elisabeth von Sponheim-Kreuzach in 1346. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 452. |  Mathilde von Braunschweig-Wolfenbüttel Mathilde von Braunschweig-Wolfenbüttel Mathilde heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in cir 1343. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 453. |  Fürst Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel Fürst Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_II._(Braunschweig-Lüneburg) (Jul 2023) Magnus heiratete Katharina von Anhalt (von Bernburg) am 6 Okt 1356. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 454. |  Agnes von Braunschweig-Wolfenbüttel Agnes von Braunschweig-Wolfenbüttel Notizen: Geburt: Agnes heiratete Graf Heinrich VII. (V. / VIII.) von Honstein-Klettenberg (Hohnstein) in vor 5 Jan 1364. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich VI. von Honstein-Klettenberg (Hohnstein) und Mechthild von Weimar-Orlamünde) gestorben in 1408. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 455. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Elisabeth heiratete Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) in 1350. Friedrich (Sohn von Burggraf Johann II. von Nürnberg (Hohenzollern) und Gräfin Elisabeth von Henneberg) wurde geboren in 1333; gestorben am 21 Jan 1398. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 456. |  Markgraf Friedrich III. von Meissen (Wettiner) Markgraf Friedrich III. von Meissen (Wettiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(Meißen) Friedrich heiratete Katharina von Henneberg-Schleusingen in 1346. Katharina (Tochter von Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere und Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel) wurde geboren in cir 1334 in Schleusingen, Thüringen; gestorben am 15 Jul 1397 in Meissen, Sachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 457. |  Markgraf Balthasar von Meissen (Thüringen, Wettiner) Markgraf Balthasar von Meissen (Thüringen, Wettiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Balthasar_(Thüringen_und_Meißen) (Feb 2022) Balthasar heiratete Margaretha von Nürnberg in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Anna von Sachsen-Wittenberg. Anna (Tochter von Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Cäcilia (Siliola) von Carrara) gestorben am 18 Apr 1426. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 458. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Meißen) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Mähren. Elisabeth gestorben in 1400. [Familienblatt] [Familientafel] Wilhelm heiratete Anna von Braunschweig-Göttingen in vor 7 Mai 1402. Anna (Tochter von Herzog Otto I. von Braunschweig-Göttingen und Margarete von Berg) wurde geboren in 1387; gestorben am 27 Okt 1426. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 459. |  Graf Meinhard III. von Tirol Graf Meinhard III. von Tirol Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_III. (Sep 2023) Meinhard heiratete Margarete von Österreich in Jun 1359 in Passau. Margarete (Tochter von Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) und Herzogin Johanna von Pfirt) wurde geboren in 1346; gestorben in 1366. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 460. |  Herzog Stephan III. von Bayern (Wittelsbacher), der Prächtige Herzog Stephan III. von Bayern (Wittelsbacher), der Prächtige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_III._(Bayern) Stephan heiratete Taddea Visconti in 1367. Taddea (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in cir 1352; gestorben am 28 Sep 1381; wurde beigesetzt in Vielleicht in der Münchener Frauenkirche ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Stephan heiratete Elisabeth von Kleve am 17 Jan 1401 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Elisabeth (Tochter von Graf Adolf III von der Mark (von Kleve) und Margarethe von Berg) wurde geboren in cir 1378; gestorben in nach 1439 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE; wurde beigesetzt in Mauritiuskloster, Köln. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 461. |  Herzog Friedrich von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), der Weise Herzog Friedrich von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_(Bayern) Friedrich heiratete Anna von Neuffen am 16 Mai 1360. [Familienblatt] [Familientafel] Friedrich heiratete Maddalena Visconti am 2 Sep 1381. Maddalena (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in 1366; gestorben am 24 Aug 1404. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 462. |  Herzog Johann II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Johann II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johann II. von Bayern (* um 1341; † zwischen 14. Juni und 1. Juli 1397[1]) war seit 1375 Herzog von Bayern. Er war der jüngste Sohn Herzog Stephans II. und Elisabeths von Sizilien. Johann heiratete Katharina von Görz in 1372. Katharina (Tochter von Graf Meinhard VI. von Görz) gestorben in 1391. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Anna Pirsser. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 463. |  Graf Eberhard III. von Württemberg, der Milde Graf Eberhard III. von Württemberg, der Milde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Eberhard_III,_Count_of_W%C3%BCrttemberg Eberhard heiratete Antonia Visconti in 1380. Antonia (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) gestorben am 26 Mrz 1405. [Familienblatt] [Familientafel]
Eberhard heiratete Elisabeth von Nürnberg in 1406. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 464. |  Margarete von Bayern (Wittelsbacher) Margarete von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Margarete und Johann Ohnefurcht hatten acht Kinder, sieben Töchter und einen Sohn. Sieben der acht Kinder aus dieser Ehe erreichten das heiratsfähige Alter. Margarete heiratete Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht am 12 Apr 1385 in Cambrai. Johann (Sohn von Herzog Philipp II. von Burgund (Valois), der Kühne und Gräfin Margarete III. von Flandern) wurde geboren am 28 Mai 1371 in Dijon, Frankreich; gestorben am 10 Sep 1419 in Montereau-Fault-Yonne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 465. |  Johanna Sophie von Bayern (Wittelsbacher) Johanna Sophie von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Sophie_von_Bayern Johanna heiratete Reichsfürst Albrecht IV. von Österreich (Habsburg) am 24 Apr 1390 in Wien. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf und Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern)) wurde geboren am 19/20 Sep 1377 in Wien; gestorben in 25 Aug oder 14 Sep 1404 in bei Znaim oder auf dem Weg nach Wien; wurde beigesetzt in Fürstengruft des Stephansdoms in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 466. |  Elisabeth von Henneberg-Schleusingen Elisabeth von Henneberg-Schleusingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Henneberg-Schleusingen Elisabeth heiratete Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner in vor 17 Sep 1342. Eberhard (Sohn von Graf Ulrich III. von Württemberg und Sophia von Pfirt) wurde geboren in nach 1315; gestorben am 15 Mrz 1362 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 467. |  Katharina von Henneberg-Schleusingen Katharina von Henneberg-Schleusingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Henneberg Katharina heiratete Markgraf Friedrich III. von Meissen (Wettiner) in 1346. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) und Mathilde (Mechthild) von Bayern) wurde geboren am 14 Dez 1332 in Dresden, DE; gestorben am 21 Mai 1381 in Altenburg, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 468. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Sophie heiratete Burggraf Albrecht von Nürnberg (Hohenzollern), der Schöne in Herbst 1348. Albrecht (Sohn von Burggraf Friedrich IV. (Frederick) von Nürnberg (Hohenzollern) und Margarethe (Margareta) von Kärnten) wurde geboren in cir 1319; gestorben am 4 Apr 1361 in Baiersdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 469. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Henneberg |
| 470. |  Herzog Heinrich V. von Sagan (von Glogau), der Eiserne Herzog Heinrich V. von Sagan (von Glogau), der Eiserne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(Glogau-Sagan) (Feb 2022) Heinrich heiratete Anna von Płock in 1337. Anna (Tochter von Herzog Wacław von Płock und Elisabeth von Litauen) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 471. |  Agnes von Glogau-Sagan Agnes von Glogau-Sagan Agnes heiratete Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg in zw 1341 und 1345. Ludwig (Sohn von Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) und Margarethe von Böhmen) wurde geboren in zw 1313 und 1321; gestorben in 1398. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 472. | Notizen: Jutta hatte mit Nikolaus II. drei Kinder. Jutta heiratete Herzog Nikolaus II. von Troppau in 1360. Nikolaus (Sohn von Herzog Nikolaus I. von Troppau und Adelheid von Habsburg) wurde geboren in cir 1288; gestorben am 8 Dez 1365. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 473. |  Herzog Johann I. von Lothringen Herzog Johann I. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Lothringen) Johann heiratete Sophie von Württemberg am 16 Dez 1361 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. Sophie wurde geboren in 1343; gestorben in 1369. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 474. |  Reichsfürst Albrecht IV. von Österreich (Habsburg) Reichsfürst Albrecht IV. von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_IV._(Österreich) (Apr 2018) Albrecht heiratete Johanna Sophie von Bayern (Wittelsbacher) am 24 Apr 1390 in Wien. Johanna (Tochter von Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Liegnitz-Brieg) wurde geboren am 1373 oder 1377; gestorben am 28 Jul 1410 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 475. |  Herzog Wilhelm von Österreich (Habsburg) Herzog Wilhelm von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Österreich) (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Königin Hedwig (Jadwiga) von Polen (von Anjou), die Heilige . Hedwig (Tochter von König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse und Königin Elisabeth von Bosnien) wurde geboren am 3 Okt 1373 in Buda (Budapest); gestorben am 17 Jul 1399 in Krakau, Polen; wurde beigesetzt in Kirchenschiff der Wawel-Kathedrale zu Krakau. [Familienblatt] [Familientafel] Wilhelm heiratete Königin Johanna II. von Neapel (Anjou) in 1401. Johanna wurde geboren am 25 Jul 1373 in Neapel, Italien; gestorben am 2 Feb 1435 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 476. |  Erzherzog Ernst I. von Österreich (von Habsburg), der Eiserne Erzherzog Ernst I. von Österreich (von Habsburg), der Eiserne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_der_Eiserne Familie/Ehepartner: Margarethe von Pommern. Margarethe (Tochter von Herzog Bogislaw V. von Pommern (Greifen) und Adelheid von Braunschweig-Grubenhagen) wurde geboren in cir 1366; gestorben am 30 Apr 1407. [Familienblatt] [Familientafel] Ernst heiratete Cimburgis von Masowien in 1412 in Bruck an der Mur. Cimburgis (Tochter von Herzog Ziemowit (Siemowit) von Masowien und Prinzessin Alexandra von Litauen) wurde geboren am 1394 od 1397 in Warschau, Herzogtum Masowien; gestorben am 28 Sep 1429 in Türnitz, Niederösterreich; wurde beigesetzt in Stiftskirche Lilienfeld. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 477. |  Titularherzog Friedrich IV. von Österreich (von Habsburg) Titularherzog Friedrich IV. von Österreich (von Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_IV._(Tirol) (Feb 2022) Friedrich heiratete Prinzessin Elisabeth von der Pfalz (Wittelsbacher) in 1406. Elisabeth (Tochter von König Ruprecht III. von der Pfalz (Wittelsbacher) und Elisabeth von Hohenzollern (von Nürnberg)) wurde geboren in vor 27 Okt 1381 in Amberg, Bayern, DE; gestorben am 31 Dez 1408 in Innsbruck, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel] Friedrich heiratete Anna von Braunschweig in 1410. Anna (Tochter von Herzog Friedrich von Braunschweig-Lüneburg und Anna von Sachsen-Wittenberg) wurde geboren in 1390; gestorben am 10 Aug 1432. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 478. |  Herr Enguerrand VII. von Coucy Herr Enguerrand VII. von Coucy Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Enguerrand_VII._de_Coucy Enguerrand heiratete Prinzessin Isabella von England (Plantagenêt) in 1365. Isabella (Tochter von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 16 Jun 1332 in Woodstock Palace, Woodstock, Oxfordshire, England ; gestorben in vor 4 Mai 1379; wurde beigesetzt in Greyfriars Church, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Enguerrand heiratete Isabella von Lothringen in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 479. |  Katharina von Anhalt (von Bernburg) Katharina von Anhalt (von Bernburg) Notizen: Name: Katharina heiratete Fürst Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel am 6 Okt 1356. Magnus (Sohn von Herzog Magnus I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen) und Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier)) wurde geboren in 1324; gestorben am 25 Jul 1373 in Leveste am Deister. [Familienblatt] [Familientafel]
Katharina heiratete Albrecht von Sachsen-Wittenberg am 11 Mai 1374. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 480. |  Fürst Johann II. von Anhalt-Köthen Fürst Johann II. von Anhalt-Köthen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Elisabeth von Henneberg-Schleusingen in cir 1366. Elisabeth (Tochter von Graf Johann I. von Henneberg-Schleusingen und Elisabeth von Leuchtenberg) wurde geboren in 1351; gestorben am 24 Apr 1397. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 481. |  Herzog Rudolf III. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Rudolf III. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Sachsen-Wittenberg) (Feb 2022) Rudolf heiratete Anna von Meissen in 1387/1389. Anna (Tochter von Markgraf Balthasar von Meissen (Thüringen, Wettiner) und Margaretha von Nürnberg) gestorben am 4 Jul 1395. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Barbara von Liegnitz (Piasten) am 6 Mrz 1396. Barbara (Tochter von Herzog Ruprecht I. von Liegnitz (Piasten) und Prinzessin Hedwig von Sagan (von Glogau)) gestorben am 17 Mai 1435. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 482. |  Anna von Sachsen-Wittenberg Anna von Sachsen-Wittenberg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Sachsen-Wittenberg_(†_1426) Anna heiratete Herzog Friedrich von Braunschweig-Lüneburg in 1386. Friedrich wurde geboren in 1357/58; gestorben am 5 Jun 1400 in Hundsburgstraße, Kleinenglis, Hessen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgraf Balthasar von Meissen (Thüringen, Wettiner). Balthasar (Sohn von Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) und Mathilde (Mechthild) von Bayern) wurde geboren am 21 Dez 1336 in Weissenfels, Sachsen-Anhalt, DE; gestorben am 18 Mai 1406 in Wartburg, Thüringen, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 483. |  Königin Maria von Ungarn (von Anjou) Königin Maria von Ungarn (von Anjou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Ungarn) Maria heiratete König Sigismund von Luxemburg (von Ungarn) in 1385. Sigismund (Sohn von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Kaiserin Elisabeth von Pommern) wurde geboren am 15 Feb 1368 in Nürnberg, Bayern, DE; gestorben am 9 Dez 1437 in Znojmo (Znaim), Mähren; wurde beigesetzt in Dom von Großwardein (rum. Oradea, ung. Nagyvárad). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 484. |  Königin Hedwig (Jadwiga) von Polen (von Anjou), die Heilige Königin Hedwig (Jadwiga) von Polen (von Anjou), die Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hedwig_von_Anjou (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Herzog Wilhelm von Österreich (Habsburg). Wilhelm (Sohn von Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) und Herzogin Viridis Visconti) wurde geboren in cir 1370 in Wien; gestorben am 15 Jul 1406 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Hedwig heiratete Fürst Władysław II. Jagiełło von Polen, Jogaila in 1386. Władysław wurde geboren in vor 1362; gestorben am 1 Jun 1434 in Gródek; wurde beigesetzt in Krakau, Polen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 485. |  König Karl V. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Weise König Karl V. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_V._(Frankreich) Karl heiratete Johanna (Jeanne) von Bourbon am 8 Apr 1350 in Tain-l’Hermitage. Johanna (Tochter von Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon und Isabella von Valois) wurde geboren am 3 Feb 1338 in Schloss Vincennes; gestorben am 6 Feb 1378 in Paris, France; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 486. |  Ludwig I. von Anjou Ludwig I. von Anjou Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Anjou) (Okt 2017) Ludwig heiratete Marie von Châtillon (Blois) in 1360. Marie (Tochter von Karl (Charles) von Châtillon (Blois), der Selige und Gräfin von Penthièvre Johanna von der Bretagne (Dreux)) wurde geboren am 1343 od 1345; gestorben am 12 Nov 1404. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 487. |  Herzog Johann (Jean) von Valois (von Berry) Herzog Johann (Jean) von Valois (von Berry) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Valois,_duc_de_Berry Johann heiratete Jeanne von Armagnac am 24 Jun 1360 in Carcassonne. Jeanne (Tochter von Graf Jean I. von Armagnac und Béatrice von Clermont) gestorben am 15 Mrz 1387. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 488. |  Herzog Philipp II. von Burgund (Valois), der Kühne Herzog Philipp II. von Burgund (Valois), der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Begründer der Dynastie der Burgunderherzöge aus dem Hause Valois, die 1477 beim Tod seines Urenkels Karls des Kühnen erlosch. Philipp heiratete Gräfin Margarete III. von Flandern in 1369. Margarete (Tochter von Graf Ludwig II. von Flandern und Gräfin Margarete von Brabant) wurde geboren am 13 Apr 1350 in Male; gestorben am 16 Mrz 1405 in Arras, Frankreich; wurde beigesetzt in Lille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 489. |  Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) Johanna heiratete König Karl II. von Navarra, der Böse am 3 Nov 1353. Karl (Sohn von König Philipp III. von Évreux (von Navarra) und Königin Johanna II. von Frankreich (von Navarra)) wurde geboren in Okt 1332 in Évreux; gestorben am 1 Jan 1387 in Pamplona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 490. |  Maria von Frankreich (Valois) Maria von Frankreich (Valois) Maria heiratete Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois in 1364. Robert (Sohn von Graf Heinrich IV. von Bar-Scarponnois und Yolande de Dampierre) wurde geboren am 8 Nov 1344; gestorben am 12 Apr 1411; wurde beigesetzt in Kirche Saint-Maxe, Bar-le-Duc. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 491. |  Prinzessin Isabelle von Frankreich (von Valois) Prinzessin Isabelle von Frankreich (von Valois) Isabelle heiratete Gian Galeazzo Visconti in Jun 1360. Gian (Sohn von Galeazzo II. Visconti) wurde geboren am 16 Okt 1351 in Pavia, Italien; gestorben am 3 Sep 1402 in Melegnano. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 492. |  Katharina von Luxemburg (von Böhmen) Katharina von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Luxemburg Katharina heiratete Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) in Jul 1356. Rudolf (Sohn von Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) und Herzogin Johanna von Pfirt) wurde geboren am 1 Nov 1339 in Wien; gestorben am 27 Jul 1365 in Mailand. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 493. |  Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Margarethes kurze Ehe mit Ludwig I. blieb kinderlos. Margarethe heiratete König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse in 1345. Ludwig (Sohn von König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) und Prinzessin Elisabeth von Polen) wurde geboren am 5 Mrz 1326 in Visegrád, Ungarn; gestorben am 10 Sep 1382 in Trnava; wurde beigesetzt in Székesfehérvá. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 494. |  Elisabeth von Luxemburg (von Böhmen) Elisabeth von Luxemburg (von Böhmen) Notizen: Elisabeth und Albrecht III. hatten keine Kinder. Elisabeth starb bereits 1373 im 16. Lebensjahr. Elisabeth heiratete Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf in 1366. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) und Herzogin Johanna von Pfirt) wurde geboren in zw 18 Nov 1349 und 16 Mär 1350 in Hofburg, Wien, Österreich; gestorben am 28/29 Aug 1395 in Schloss Laxenburg; wurde beigesetzt in Herzogsgruft im Wiener Stephansdom. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 495. |  Anne von Luxemburg (von Böhmen) Anne von Luxemburg (von Böhmen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_von_Böhmen Anne heiratete König Richard II. von England (Plantagenêt) am 20 Jan 1382 in Westminster Abbey, London, England. Richard (Sohn von Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz und Joan von Kent) wurde geboren am 6 Jan 1367 in Bordeaux, Frankreich; gestorben am 14 Feb 1400 in Schloss Pontefract, Yorkshire; wurde beigesetzt in 1413 in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 496. |  König Sigismund von Luxemburg (von Ungarn) König Sigismund von Luxemburg (von Ungarn) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_(HRR) Sigismund heiratete Königin Maria von Ungarn (von Anjou) in 1385. Maria (Tochter von König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse und Königin Elisabeth von Bosnien) wurde geboren am 1370 oder 1371 in Ofen; gestorben am 17 Mai 1395. [Familienblatt] [Familientafel] Sigismund heiratete Barbara von Cilli in Dez 1405. Barbara (Tochter von Graf Hermann II. von Cilli und Gräfin Anna von Schaunberg) wurde geboren in cir 1390; gestorben am 11 Jul 1451 in Mělník; wurde beigesetzt in Königliche Gruft in Prag. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 497. |  Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) Margarethe heiratete Burggraf Johann III. von Nürnberg (Hohenzollern) in 1375. Johann (Sohn von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) und Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner)) wurde geboren in cir 1369; gestorben am 11 Jun 1420. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 498. |  Margarete von Liegnitz-Brieg Margarete von Liegnitz-Brieg Notizen: Name: Margarete heiratete Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) am 19 Jul 1353 in Passau. Albrecht (Sohn von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Margarethe von Hennegau (von Holland)) wurde geboren am 25 Jul 1336 in München, Bayern, DE; gestorben am 16 Dez 1404 in Den Haag, Holland; wurde beigesetzt in Hofkapelle in Den Haag. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 499. |  Hedwig von Liegnitz-Brieg Hedwig von Liegnitz-Brieg Notizen: Name: Hedwig heiratete Herzog Johann II. von Teschen-Auschwitz in vor 1367. Johann wurde geboren in vor 1350; gestorben in 1376. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 500. |  Graf Rudolf IV. von Neuenburg-Nidau Graf Rudolf IV. von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nidau |
| 501. | Elisabeth von Neuenburg-Strassberg |
| 502. |  Elisabeth von Graisbach Elisabeth von Graisbach Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herren_von_Neuffen Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Abensberg. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Abensberg) gestorben am 30 Aug 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 503. |  Ulrich IV. von Hanau Ulrich IV. von Hanau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_IV._(Hanau) Ulrich heiratete Elisabeth von Wertheim in 1366/1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 504. |  Elisabeth von Hanau Elisabeth von Hanau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Hanau_(Katzenelnbogen) Elisabeth heiratete Graf Wilhelm II von Katzenelnbogen in nach 22 Jun 1355. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen und Adelheid von Waldeck) wurde geboren in 1315; gestorben in vor 23 Okt 1385; wurde beigesetzt in Kloster Eberbach, Hessen, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 505. |  Ulrich von Württemberg Ulrich von Württemberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_du_Wurtemberg Ulrich heiratete Gräfin Elisabeth von Bayern in 1362. Elisabeth (Tochter von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Margarethe von Hennegau (von Holland)) wurde geboren in 1329; gestorben am 2 Aug 1402 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 506. |  Herr Kraft IV. von Hohenlohe-Weikersheim Herr Kraft IV. von Hohenlohe-Weikersheim Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft_IV._(Hohenlohe-Weikersheim) Kraft heiratete Agnes von Ziegenhain in vor 28 Okt 1370. Agnes gestorben am 23 Mrz 1374. [Familienblatt] [Familientafel] Kraft heiratete Elisabeth von Sponheim-Bolanden in vor 23 Mrz 1374. Elisabeth (Tochter von Graf Heinrich II. von Sponheim-Bolanden und Adelheid von Katzenelnbogen) gestorben in 1381. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 507. |  Herr Gottfried III. von Hohenlohe-Weikersheim Herr Gottfried III. von Hohenlohe-Weikersheim Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 508. |  Herr Ulrich von Hohenlohe-Weikersheim Herr Ulrich von Hohenlohe-Weikersheim Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beruf / Beschäftigung: |
| 509. |  Albrecht I. von Hohenlohe-Weikersheim Albrecht I. von Hohenlohe-Weikersheim Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Hohenlohe-Weikersheim) Albrecht heiratete Elisabeth von Hanau in 1413. Elisabeth wurde geboren in cir 1395; gestorben am 25 Mai 1475; wurde beigesetzt in Kloster Gnadental, Michelfeld, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 510. |  Anna von Hohenlohe-Weikersheim Anna von Hohenlohe-Weikersheim Anna heiratete Konrad II. von Hohenlohe-Brauneck in vor 15 Mrz 1388. Konrad (Sohn von Graf Konrad I. von Hohenlohe-Brauneck und Petrissa von Büdingen) gestorben in 1390. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Konrad IX. (VII.) von Weinsberg in 26 Aug / 11 Nov 1396. Konrad wurde geboren in vor 1391; gestorben am 18 Jan 1448. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 511. |  Albrecht von Aichelberg Albrecht von Aichelberg Notizen: Name: Albrecht heiratete Guta von Landau in 1350 in Aichelberg, Baden-Württrmberg, DE. Guta (Tochter von Eberhard III. von Landau und Guta von Gundelfingen) wurde geboren in 1330 in Binswangen, Dillingen an der Donau, Bayern, DE; gestorben am 1 Jun 1384. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 512. |  Johann Truchsess von Waldburg Johann Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Klara von Neuffen (Neifen). Klara (Tochter von Graf Albert II. von Neuffen (Neifen) und Elisabeth von Graisbach) gestorben in 1339. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 513. |  Anna von Montfort-Feldkirch Anna von Montfort-Feldkirch |
| 514. |  Friedrich III von Montfort-Feldkirch Friedrich III von Montfort-Feldkirch |
| 515. |  Elisabeth von Montfort-Feldkirch Elisabeth von Montfort-Feldkirch |
| 516. |  Sophie von Montfort-Feldkirch Sophie von Montfort-Feldkirch Sophie heiratete Ritter Friedrich Thumb von Neuburg in 1300 in Untervaz, GR, Schweiz. Friedrich (Sohn von Ritter Swiggerus Thumb von Neuburg und Anna von Ems) wurde geboren in 1265 in Untervaz, GR, Schweiz; gestorben in Mrz 1316 in Untervaz, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 517. |  Hugo VI von Montfort-Tosters Hugo VI von Montfort-Tosters |
| 518. |  Katharina von Montfort-Feldkirch Katharina von Montfort-Feldkirch Familie/Ehepartner: Heinrich V von Tengen. Heinrich (Sohn von Konrad II von Tengen) gestorben in 1350/52. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 519. |  Rudolf IV von Montfort-Feldkirch Rudolf IV von Montfort-Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 520. |  Waldburga Truchsess zu Waldburg Waldburga Truchsess zu Waldburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Waldburg Familie/Ehepartner: Hans von Klingenberg. Hans (Sohn von Kaspar von Klingenberg und Margareta Malterer) gestorben in 1462. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 521. |  Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I,_Duke_of_Bavaria Rudolf heiratete Prinzessin Mechthild von Nassau am 1 Sep 1294 in Nürnberg, Bayern, DE. Mechthild (Tochter von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1280; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 522. |  Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Fürst Otto II. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1288. Otto (Sohn von Herzog Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) und Liutgard von Holstein) wurde geboren in cir 1266; gestorben am 10 Apr 1330; wurde beigesetzt in Kloster St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 523. |  Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes heiratete Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) in 1303. Heinrich (Sohn von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren am 21 Mrz 1256; gestorben am 14 Feb 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Landgraf Heinrich von Hessen in 1290. Heinrich wurde geboren in 1264; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 524. |  Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(HRR) Ludwig heiratete Beatrix von Schlesien-Schweidnitz in cir 1308. Beatrix (Tochter von Herzog Bolko I. von Schlesien (von Schweidnitz) (Piasten) und Beatrix von Brandenburg) wurde geboren in cir 1290; gestorben am 24 Aug 1322 in München, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Margarethe von Hennegau (von Holland) am 25 Feb 1324 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Margarethe (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in ca 1307 / 1310 in Valenciennes ?; gestorben am 23 Jun 1356 in Quesnoy; wurde beigesetzt in Minoritenkirche zu Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 525. |  Anna von Habsburg Anna von Habsburg Notizen: Anna und Hermann (III.) der Lange hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange in 1295. Hermann (Sohn von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) wurde geboren in cir 1275; gestorben am 1 Feb 1308 in bei Lübz; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 18 Mrz 1294; gestorben am 24 Nov 1335; wurde beigesetzt in Klarissenkloster, Breslau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 526. |  Agnes von Habsburg (von Ungarn) Agnes von Habsburg (von Ungarn) Notizen: Über Kinder von Agnes mit Andreas III. ist nichts bekannt. Agnes heiratete König Andreas III. von Ungarn (Árpáden), der Venezianer am 13 Feb 1296 in Wien. Andreas (Sohn von Prinz Stephan von Slowenien (von Ungarn) (Árpáden) und Katharina Morosini (Morossini)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 14 Jan 1301. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 527. |  Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Böhmen) Rudolf heiratete Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) in 1300. Blanka (Tochter von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in cir 1285 in Paris, France; gestorben am 1 Mrz 1305 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen am 16 Okt 1306. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 528. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nancy und Friedrich IV. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Elisabeth heiratete Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur in 1307 in Nancy, FR. Friedrich (Sohn von Herzog Theobald II. von Lothringen und Isabelle de Rumigny) wurde geboren am 15 Apr 1282 in Gondreville; gestorben am 23 Aug 1328 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 529. |  Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Österreich) (Mai 2018) Albrecht heiratete Herzogin Johanna von Pfirt am 26 Mrz 1324 in Wien. Johanna (Tochter von Ulrich von Pfirt und Prinzessin Johanna von Mömpelgard) wurde geboren in 1300 in Basel, BS, Schweiz; gestorben am 15 Nov 1351 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 530. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(Habsburg) Leopold heiratete Prinzessin Katharina von Savoyen am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Katharina (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in zw 1297 und 1304 in Brabant; gestorben am 30 Sep 1336 in Rheinfelden, AG, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann 1770 Dom St. Blasien, dann 1806 Stift Spital Phyrn, dann 1809 Stiftskirchengruft Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 531. |  Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Sachsen-Wittenberg) Rudolf heiratete Jutta (Brigitte) von Brandenburg in 1298. Jutta (Tochter von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) gestorben am 9 Mai 1328 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Kunigunde von Polen am 28 Aug 1328. Kunigunde (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in cir 1293; gestorben in 1333/1335. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Agnes von Lindow-Ruppin in 1333. Agnes (Tochter von Graf Günther ? von Lindow-Ruppin) wurde geboren in cir 1300; gestorben am 9 Mai 1343 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 532. |  König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(Ungarn) Familie/Ehepartner: Maria von Oppeln (von Beuthen). Maria (Tochter von Herzog Kasimir I. von Oppeln (von Beuthen) (Piasten) und Helena N.) gestorben in 1317. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Königin Beatrix von Luxemburg am 24 Jun 1318. Beatrix (Tochter von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren in 1305; gestorben am 11 Nov 1319; wurde beigesetzt in Kathedrale von Varaždin. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Elisabeth von Polen am 6 Jul 1320. Elisabeth (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in 1305; gestorben am 29 Dez 1380 in Budapest. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 533. |  Guota (Imagina) von Ochsenstein Guota (Imagina) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Donat von Vaz. Donat (Sohn von Walter V. von Vaz und Luitgard (Liukarda) von Kirchberg) gestorben am 23 Apr 1337/38 in Churwalden, GR, Schweiz; wurde beigesetzt in Churwalden, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 534. |  Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Sponheim-Starkenburg) Heinrich heiratete Gräfin Loretta von Salm in Datum unbekannt. Loretta (Tochter von Johann I. von Salm und Jeanne von Joinville (von Geneville)) wurde geboren in 1300; gestorben in 1345/1346; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 535. |  Gertrude von Neuenburg-Strassberg Gertrude von Neuenburg-Strassberg Familie/Ehepartner: Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau. Rudolf (Sohn von Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau und Richenza) gestorben in 1308/1309. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 536. |  Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Marguerite von Freiburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 537. |  Graf Johann I. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Johann I. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Habsburg-Laufenburg) Familie/Ehepartner: Agnes von Werd. Agnes (Tochter von Sigismund von Werd) gestorben in nach 9 Feb 1354. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 538. |  Ita von Homberg Ita von Homberg Familie/Ehepartner: Friedrich IV. von Toggenburg. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich III. von Toggenburg und Klementa von Werdenberg) gestorben am 15 Nov 1315. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 539. |  Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf,_Count_Palatine_of_the_Rhine Adolf heiratete Prinzessin Irmengard von Oettingen in 1320. Irmengard (Tochter von Graf Ludwig VI. von Oettingen und Agnes von Württemberg) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 6 Nov 1389. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 540. |  Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Johann III. von Sponheim-Starkenburg in 1331. Johann (Sohn von Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg und Gräfin Loretta von Salm) wurde geboren in 1315; gestorben am 20 Dez 1398; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 541. |  Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde heiratete Herr Nikolaus II. zu Werle in nach 1308. Nikolaus (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in vor 1275; gestorben am 18 Feb 1316 in Pustow (Pustekow). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 542. |  Mathilde (Mechthild) von Bayern Mathilde (Mechthild) von Bayern Notizen: Mathilde und Friedrich II. hatten neun Kinder, vier Töchter und fünf Söhne. Mathilde heiratete Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) in 1328 in Nürnberg, Bayern, DE. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) und Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk) wurde geboren am 30 Nov 1310 in Gotha; gestorben am 19 Nov 1349 in Wartburg, Thüringen, DE; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 543. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_V._(Bayern) Ludwig heiratete Margarete von Dänemark am 30 Nov 1324 in Königreich Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ am 10 Feb 1342 in Schloss Tirol. Margarete (Tochter von Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) und Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen)) wurde geboren in 1318 in Grafschaft Tirol; gestorben am 3 Okt 1369 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 544. |  Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stephan mit der Hafte (* 1319; † Mai 1375 in Landshut oder München) war von 1347 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Er war der zweite Sohn Kaiser Ludwigs des Bayern aus dessen erster Ehe mit Beatrix von Schlesien-Schweidnitz. Stephan heiratete Prinzessin Elisabeth (Isabel) von Sizilien (von Aragôn) am 27 Jun 1328 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 21 Mrz 1349 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Stephan heiratete Margarete von Nürnberg in 14 Feb1359 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 545. | Kurfürst Ludwig VI. von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VI._(Bayern) |
| 546. |  Gräfin Elisabeth von Bayern Gräfin Elisabeth von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Bayern_(1329–1402) (Jun 2018) Elisabeth heiratete Herr von Verona Cangrande II. della Scala (Scaliger) am 22 Nov 1350. Cangrande (Sohn von Herr Mastino II. della Scala (Scaliger) und Taddea von Carrara) wurde geboren am 7 Jun 1332; gestorben am 14 Dez 1359 in Verona; wurde beigesetzt in Scalinger-Grabmäler, Verona. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Ulrich von Württemberg in 1362. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner und Elisabeth von Henneberg-Schleusingen) wurde geboren in nach 1340; gestorben am 23 Aug 1388. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 547. |  Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Bayern) Albrecht heiratete Margarete von Liegnitz-Brieg am 19 Jul 1353 in Passau. Margarete (Tochter von Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg und Agnes von Glogau-Sagan) wurde geboren in 1342/43; gestorben in 1386. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 548. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Judith heiratete Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere in 1 Jan 1317 / 1 Feb 1319. Heinrich (Sohn von Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen und Adelheid von Hessen) wurde geboren in vor 1300; gestorben am 10 Sep 1347 in Schleusingen, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 549. |  Markgraf Johann V. von Brandenburg Markgraf Johann V. von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_V._(Brandenburg) Johann heiratete Katharina von Glogau in Datum unbekannt. Katharina (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 550. |  Mathilde von Brandenburg Mathilde von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Mathilde heiratete Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in 1292; gestorben am 22 Jan 1342 in Sagan, Lebus, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 551. | Elisabeth von Breslau (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Elisabeth und Konrad I. scheinen keine Kinder gehabt zu haben. Elisabeth heiratete Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) in 1322. Konrad (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in cir 1294; gestorben am 22 Dez 1366. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 552. |  Euphemia von Breslau Euphemia von Breslau Notizen: Euphemia und Bolko II. hatten sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Euphemia heiratete Herzog Bolko II. (Boleslaus) von Falkenberg (von Oppeln) in cir 1325. Bolko (Sohn von Herzog Bolko I. (Boleslaw) von Oppeln und Gremislawa (oder Agnes)) wurde geboren in ca 1290/1295; gestorben in ca 1362/1365; wurde beigesetzt in Sankt-Annen-Kapelle, Franziskanerkloster, Oppeln. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 553. |  Herzog Rudolf von Lothringen Herzog Rudolf von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_(Lothringen) Rudolf heiratete Marie von Châtillon (Blois) in 1334. Marie (Tochter von Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) und Marguerite (Margarete) von Valois (Kapetinger)) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Alienor von Bar-Scarponnois am 25 Jun 1329. Alienor (Tochter von Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois und Marie von Burgund) gestorben in 1333. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 554. |  Margarete von Österreich Margarete von Österreich Margarete heiratete Graf Meinhard III. von Tirol in Jun 1359 in Passau. Meinhard (Sohn von Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ ) wurde geboren in 1344 in Landshut, Bayern, DE; gestorben am 13 Jan 1363 in Schloss Tirol oder in Meran. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Markgraf Johann Heinrich von Luxemburg am 26 Feb 1364. Johann wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechien ; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 555. |  Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV._(Österreich) Rudolf heiratete Katharina von Luxemburg (von Böhmen) in Jul 1356. Katharina (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren in 1342 in Prag, Tschechien ; gestorben am 26 Apr 1395 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 556. |  Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_III._(Österreich) Albrecht heiratete Elisabeth von Luxemburg (von Böhmen) in 1366. Elisabeth (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Anna von Schweidnitz) wurde geboren am 19 Mrz 1358 in Prag, Tschechien ; gestorben in 04 od 19 Sept 1373 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Albrecht heiratete Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern) in 1375. Beatrix (Tochter von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) und Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner)) wurde geboren in 1355; gestorben in 1414. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 557. |  Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_III._von_Habsburg (Mai 2018) Leopold heiratete Herzogin Viridis Visconti in 1365 in Wien. Viridis (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in cir 1350; gestorben am 1 Mrz 1414; wurde beigesetzt in Kloster Sittich oder in der Familiengruft zu Mailand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 558. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Habsburg_(1320–1349) Katharina heiratete Herr Enguerrand VI. von Coucy in Nov 1338. Enguerrand (Sohn von Herr Guillaume I. von Coucy) wurde geboren in 1313; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 559. |  Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Name: Agnes heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in 1328. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 560. |  Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Fürst Albrecht II. von Anhalt-Zerbst-Köthen. Albrecht gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 561. |  Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_I._(Sachsen-Wittenberg) Wenzel heiratete Cäcilia (Siliola) von Carrara am 23 Jan 1376. Cäcilia (Tochter von Franz von Carrara und Fina di Pataro) wurde geboren in cir 1350; gestorben in cir 1435 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 562. |  König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Ungarn) Ludwig heiratete Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) in 1345. Margarethe (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren am 25 Mai 1335 in Prag, Tschechien ; gestorben am 7 Sep 1349 in Visegrád, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Königin Elisabeth von Bosnien. Elisabeth (Tochter von Stjepan II. Kotromanić von Bosnien und Elisabeth (Jelisaveta) von Kujawien) wurde geboren in 1340; gestorben am 16 Jan 1387; wurde beigesetzt in Ihr Leichnam wurde in einen Fluss geworfen oder sie verstarb in der Gefangenschaft. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 563. |  Jutta (Bonne) von Luxemburg Jutta (Bonne) von Luxemburg Notizen: Jutta und Johann hatten ab 1336 in zwölf Jahren elf Kinder, von denen sieben das Erwachsenenalter erreichten, vier Söhne und drei Töchter. Jutta heiratete König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute am 23 Jul 1332. Johann (Sohn von König Philipp VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Johanna von Burgund) wurde geboren am 16 Apr 1319 in Schloss Gué de Maulny, Le Mans; gestorben am 8 Apr 1364 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 564. |  Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: 1. Ehe: Karl IV. heiratete 1329 Blanca Margarete von Valois. Karl heiratete Prinzessin Blanca Margarete von Valois in 1323 in Paris, France. Blanca (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Mathilde von Châtillon (Blois)) wurde geboren in 1316/1317; gestorben am 1 Aug 1348 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Königin Anna von der Pfalz (Wittelsbacher) in Mrz 1349 in Burg Stahleck. Anna wurde geboren am 26 Sep 1329; gestorben am 2 Feb 1353 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Anna von Schweidnitz in 1353. Anna wurde geboren in 1339; gestorben am 11 Jul 1362 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Kaiserin Elisabeth von Pommern am 21 Mai 1363 in Krakau, Polen. Elisabeth (Tochter von Herzog Bogislaw V. von Pommern (Greifen) und Prinzessin Elisabeth von Polen) wurde geboren in cir 1345; gestorben am 14 Feb 1393 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 565. |  Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Liegnitz) Ludwig heiratete Agnes von Glogau-Sagan in zw 1341 und 1345. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) und Mathilde von Brandenburg) gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 566. |  Graf Diepold II. von Aichelberg Graf Diepold II. von Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Gräfin Agnes von Rechberg in Datum unbekannt. Agnes wurde geboren in 1270 in Rechberg, Schwäbisch Gmünd, DE . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 567. |  Elisabeth von Werdenberg-Sargans Elisabeth von Werdenberg-Sargans Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Ulrich Eberhard von Hohensax. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 568. |  Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 569. |  Ritter Johann von Blumenegg Ritter Johann von Blumenegg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Blumegg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Margareta Malterer. Margareta (Tochter von Ritter Johannes Malterer und G. von Kaisersberg) gestorben in spätestens 1384. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 570. |  Johannes Truchsess von Waldburg Johannes Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Elisabeth von Habsburg-Laufenburg. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Katharina von Cilly. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Magdalena von Montfort. [Familienblatt] [Familientafel] Johannes heiratete Ursula von Abendsberg am 28 Feb 1395. Ursula (Tochter von Graf Ulrich IV. von Abensberg und Katharina von Lichtenstein) gestorben am 30 Jan 1422. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 571. |  Ritter Hans Thumb von Neuburg Ritter Hans Thumb von Neuburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 572. |  Sophia von Hallwil (Hallwyl) Sophia von Hallwil (Hallwyl) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Heinrich von Homburg. Heinrich wurde geboren in cir 1345. [Familienblatt] [Familientafel]
|