
| 1. | Hadaburg Familie/Ehepartner: Heimerich (Heinrich) (Babenberger/Popponen). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Poppo I. (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Popponen Familie/Ehepartner: (Hattonen). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Graf Heimerich (Babenberger/Popponen) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | (Christian?) (Babenberger/Popponen) ) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Heilwig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Graf Ratolf ? (Babenberger/Popponen) Graf Ratolf ? (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zizat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ratolf_(Sorbenmark) |
| 6. | princeps militiae Heinrich I. (Babenberger/Popponen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Popponen Familie/Ehepartner: Ingeltrud von Italien (von Friaul) (Unruochinger). Ingeltrud (Tochter von Markgraf Eberhard von Italien (von Friaul) (Unruochinger) und Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger)) gestorben in nach 2.4.870. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Markgraf Poppo II. (Babenberger/Popponen) ) Markgraf Poppo II. (Babenberger/Popponen) ) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Popponen Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Adalbert (Babenberger/Popponen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_von_Babenberg |
| 9. | Graf Adalhard (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 10. | Graf Heinrich (Babenberger/Popponen) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Hedwig (Hathui, Haduwig) (Babenberger/Popponen) Hedwig heiratete Herzog Otto I. von Sachsen (Liudolfinger) in cir 869. Otto (Sohn von Herzog Liudolf von Sachsen (Liudofinger) und Gräfin Oda Billung) wurde geboren in cir 836; gestorben am 30 Nov 912; wurde beigesetzt in Stift Gandersheim, Bad Gandersheim, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Graf Adalbert (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): |
| 13. |  Graf Poppo III. (Babenberger/Popponen) Graf Poppo III. (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Tochter von Poppo II. (Babenberger/Popponen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Popponen Familie/Ehepartner: Wilhelm I. von Weimar. Wilhelm gestorben am 16 Apr 963. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Graf Heinrich (Babenberger/Popponen) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Herzogin Baba in Sachsen Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Radenz und Rangau (Luitpoldinger). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_the_Fowler Heinrich heiratete Hatheburg von Merseburg in 906, und geschieden. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige in 909. Mathilde (Tochter von Graf Theoderich (Dietrich) von Sachsen und Gräfin Reinhilde in Friesland (von Dänemark)) wurde geboren in cir 890; gestorben am 14 Mrz 968. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Oda von Sachsen (Liudolfinger) Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Oda heiratete König Zwentibold (Svatopluk) von Kärnten in zw 27 Mär und 13 Jun 897. Zwentibold (Sohn von Römischer Kaiser Arnolf (Arnulf Arnold) von Kärnten und (Geliebte des Arnulf von Kärnten)) wurde geboren in 870/871; gestorben am 13 Aug 900 in Schlachtfeld Susteren; wurde beigesetzt in Abtei Susteren. [Familienblatt] [Familientafel] Oda heiratete Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) in 900. Gerhard (Sohn von Graf Adalhard II. von Metz (Matfriede) und (Matfriede)) wurde geboren in 870; gestorben am 22 Jun 926. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Graf Poppo IV. ? (Babenberger/Popponen) Notizen: Name: |
| 20. |  Graf Otto I. ? (Babenberger/Popponen) Graf Otto I. ? (Babenberger/Popponen) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Wilhelm II. von Weimar, der Grosse Wilhelm II. von Weimar, der Grosse Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Weimar) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Erzbischof Heinrich (Babenberger/Popponen) Erzbischof Heinrich (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Trier) |
| 23. |  Bischof Poppo I. (Babenberger/Popponen) Bischof Poppo I. (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppo_I._(Würzburg) |
| 24. |  Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Babenberger Familie/Ehepartner: Richenza (Richarda, Richwarda, Rikchard) von Sualafeldgau (Ernste). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. |  Herzogin Judith von Kärnten Herzogin Judith von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Kärnten Familie/Ehepartner: Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier). Otto (Sohn von Herzog Konrad von Lothringen, der Rote und Prinzessin Liutgard von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen)) wurde geboren in cir 948; gestorben am 4 Nov 1004. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Schweinfurt Familie/Ehepartner: Gräfin Eilika von Walbeck. Eilika (Tochter von Graf Liuthar von Walbeck und Gräfin Mathilde von Querfurt) gestorben am 19 Aug 1015; wurde beigesetzt in Kloster Schweinfurt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Thankmar von Sachsen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thankmar_(Liudolfinger) |
| 28. |  Kaiser Otto I. von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen), der Grosse Kaiser Otto I. von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen), der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(HRR) Otto heiratete Prinzessin Edith (Edgitha) von England in 929. Edith (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) wurde geboren in cir 910; gestorben am 26 Jan 946 in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Otto heiratete Kaiserin Adelheid von Burgund (Welfen) in Okt 951 in Pavia, Italien. Adelheid (Tochter von König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) und Königin Bertha von Schwaben (von Burgund)) wurde geboren in zw 931 und 932 in Hochburgund; gestorben am 16 Dez 999 in Kloster Selz, Elsass; wurde beigesetzt in nach 16 Dez 999 in Kloster Selz, Elsass. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. |  Prinzessin Gerberga von Sachsen Prinzessin Gerberga von Sachsen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberga_(Frankreich) Gerberga heiratete Herzog Giselbert von Lothringen in 928. Giselbert (Sohn von Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen und Alberada N.) wurde geboren in cir 890; gestorben am 2 Okt 939 in bei Andernach. [Familienblatt] [Familientafel]
Gerberga heiratete König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische in 939. Ludwig (Sohn von König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige und Prinzessin Edgiva (Eadgifu) von England) wurde geboren in zw 920 und 921; gestorben am 10 Sep 954 in Reims, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen) Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen) Notizen: Hadwig hatte mit Hugo sechs Kinder. Hadwig heiratete Herzog Hugo von Franzien, der Grosse in vor dem 14. Sept. 937. Hugo (Sohn von König Robert I. von Frankreich (von Neustrien) und Beatrix von Vermandois) wurde geboren in cir 895; gestorben am 16 Jun 956 in Burg Dourdan; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger) Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_I,_Duke_of_Bavaria Familie/Ehepartner: Judith von Bayern. Judith (Tochter von Herzog Arnulf I. von Bayern (Luitpoldinger), der Böse und Gräfin Judith von Friaul (Unruochinger)) wurde geboren in 925; gestorben in nach 985. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. |  Erzbischof Brun von Köln Erzbischof Brun von Köln Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Brun_(Köln) |
| 33. | Graf Gottfried von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey,_Count_Palatine_of_Lotharingia Familie/Ehepartner: Ermentrud von Frankreich. Ermentrud (Tochter von König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige und Frederuna (Immedinger ?)) wurde geboren in zw 908 und 909. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Uda (Oda) von Metz Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_of_Metz Familie/Ehepartner: Graf Gozelo im Bidgau (Wigeriche). Gozelo (Sohn von Pfalzgraf Wigerich von Lothringen (von Aachen) (Wigeriche) und Kunigunde (Cunégonde) von Frankreich) wurde geboren in cir 911; gestorben in 943. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. |  Graf Otto II. (Babenberger/Popponen) Graf Otto II. (Babenberger/Popponen) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. |  Wilhelm III. von Weimar Wilhelm III. von Weimar Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III._(Weimar) Familie/Ehepartner: Oda von Lausitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. |  Poppo I. von Weimar (von Istrien) Poppo I. von Weimar (von Istrien) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppo_I._(Istrien) Familie/Ehepartner: Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul. Hadamut (Tochter von Wergigand von Istrien-Friaul und Willibirg von Freising (von Ebersberg)) gestorben in nach 1040. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. |  Markgraf Heinrich I. von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Starke Markgraf Heinrich I. von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Starke Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Österreich) |
| 39. |  Judith von Österreich (Babenberger) Judith von Österreich (Babenberger) |
| 40. |  Herzog Ernst I. von Schwaben (Babenberger) Herzog Ernst I. von Schwaben (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_I._(Schwaben) Familie/Ehepartner: Kaiserin Gisela von Schwaben. Gisela (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren am 11 Nov 989; gestorben am 15 Feb 1043. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. |  Erzbischof Poppo von Österreich (Babenberger) Erzbischof Poppo von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 42. |  Markgraf Adalbert von Österreich (Babenberger), der Siegreiche Markgraf Adalbert von Österreich (Babenberger), der Siegreiche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_der_Siegreiche Adalbert heiratete Frowiza Orseolo in 1041. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. |  Erzbischof Luitpold I. von Österreich (Babenberger) Erzbischof Luitpold I. von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 44. |  Kunigunde von Österreich (Babenberger) Kunigunde von Österreich (Babenberger) |
| 45. |  Hemma von Österreich (Babenberger) Hemma von Österreich (Babenberger) |
| 46. |  Christine von Österreich (Babenberger) Christine von Österreich (Babenberger) |
| 47. |  Graf Heinrich von Speyer (Salier) Graf Heinrich von Speyer (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_(Salier) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Metz. Adelheid (Tochter von Graf Richard von Metz) gestorben in an einem 19 Mai zw 1040 und 1046. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | Papst Bruno (Gregor V.) von Kärnten Notizen: Geburtsname war Brun von Kärnten |
| 49. |  Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier) Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Kärnten) Familie/Ehepartner: Herzogin Mathilde von Schwaben. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren in cir 989; gestorben am 29 Jul 1032. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. |  Markgraf Heinrich von Schweinfurt Markgraf Heinrich von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Schweinfurt Heinrich heiratete Gräfin Gerberga in der Wetterau in vor 1003. Gerberga (Tochter von Graf Heribert in der Wetterau und Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau)) wurde geboren in cir 960; gestorben in cir 1036. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | 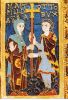 Herzog Liudolf von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) Herzog Liudolf von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Schwaben) Familie/Ehepartner: Ida (Ita) in der Wetterau (Konradiner). Ida (Tochter von Herzog Hermann I. in der Wetterau (Konradiner) und Herzogin Reginlinde (von Schwaben)) wurde geboren in cir 930; gestorben am 17 Mai 986. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. | Prinzessin Liutgard von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen) Liutgard heiratete Herzog Konrad von Lothringen, der Rote in 947. Konrad (Sohn von Werner V. im Worms- und Speyergau und Hicha von Schwaben) wurde geboren in cir 922; gestorben am 10 Aug 955 in Lechfeld; wurde beigesetzt in Dom zu Worms. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | Heinrich von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen) |
| 54. | Bruno Sachsen (Liudolfinger / Ottonen) Notizen: Gestorben: |
| 55. |  Äbtissin Mathilde von Quedlinburg (Liudolfinger / Ottonen) Äbtissin Mathilde von Quedlinburg (Liudolfinger / Ottonen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: NEUJAHRSBLATT der Gesellschaft zu Fraumünster auf das Jahr 2020 - Herausgegeben am 2 Jan 2020 - Seite35 |
| 56. |  Kaiser Otto II. von Deutschland (Liudolfinger / Ottonen) Kaiser Otto II. von Deutschland (Liudolfinger / Ottonen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._(HRR) Otto heiratete Kaiserin Theophanu Skleros am 14 Apr 972 in Rom, Italien. Theophanu (Tochter von Konstantin Skleros und Sophia Phokaina) wurde geboren in cir 956; gestorben am 15 Jun 991 in Nimwegen; wurde beigesetzt in Abteikirche St. Pantaleon, Köln. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. |  Herzogin Alberada von Lothringen Herzogin Alberada von Lothringen Notizen: Alberada und Rainald hatten vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Alberada heiratete Graf Rainald (Ragenold) von Roucy in cir 945. Rainald gestorben am 10 Mai 967; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Remi in Reims. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | Gerberga von Lothringen Gerberga heiratete Adalbert I. von Vermandois in 949. Adalbert (Sohn von Graf Heribert II. von Vermandois (Karolinger) und Gräfin Adele von Frankreich (von Neustrien)) wurde geboren in cir 915; gestorben am 8 Sep 987. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. |  König Lothar von Frankreich (Karolinger) König Lothar von Frankreich (Karolinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_(Frankreich) Familie/Ehepartner: Emma von Burgund (Bosoniden). Emma (Tochter von König Lothar II. von Italien (Bosoniden) und Kaiserin Adelheid von Burgund (Welfen)) gestorben in 988. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. | Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund) Familie/Ehepartner: Robert von Genf. Robert (Sohn von Konrad von Genf) gestorben in zw 1030 und 1032. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige in cir 964. Konrad (Sohn von König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) und Königin Bertha von Schwaben (von Burgund)) wurde geboren in 923; gestorben am 19 Okt 993. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | Herzog Karl von Niederlothringen Karl heiratete Adelheid N. in vor 979. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. |  König Hugo Capet (Kapetinger) König Hugo Capet (Kapetinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capet Familie/Ehepartner: Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien). Adelheid (Tochter von Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf und Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie) wurde geboren in cir 950; gestorben in 1004. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 63. | Beatrix von Frankreich Notizen: 987 urkundlich bezeugt. Beatrix heiratete Herzog Friedrich I. von Oberlothringen (von Bar) in 954. Friedrich (Sohn von Pfalzgraf Wigerich von Lothringen (von Aachen) (Wigeriche) und Kunigunde (Cunégonde) von Frankreich) wurde geboren in cir 912; gestorben am 18 Mai 978. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Quidam (Kuno?) von Burgund. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. |  Herzog Heinrich von Burgund, der Grosse Herzog Heinrich von Burgund, der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Asdendenz Ahnentafel Rübel-Blass, Tafel 251. Heinrich heiratete Gräfin Gerberga von Mâcon in cir 972. Gerberga (Tochter von Graf Liétald II. von Mâcon und Ermengarde von Dijon) gestorben in zw 986 und 991. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Gersende von Gascogne in Jun 992, und geschieden in 996. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Herrin von Donzy Mathilde (Mahaut) von Chalon (Autun) in 998. Mathilde (Tochter von Graf Lambert von Chalon (Autun) und Gräfin Adelheid von Vermandois) gestorben in zw 1005 und 1019. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | 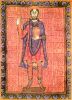 Heinrich II. von Bayern (Liudolfinger), der Zänker Heinrich II. von Bayern (Liudolfinger), der Zänker Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II,_Duke_of_Bavaria Heinrich heiratete Gisela von Burgund in 972. Gisela (Tochter von König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige und Adelana N.) wurde geboren in cir 950; gestorben am 21 Jul 1006 in Regensburg, DE; wurde beigesetzt in Kirche Niedermünster, Regensburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. |  Gerberga von Gandersheim Gerberga von Gandersheim Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberga_II._(Gandersheim) |
| 67. |  Herzogin Hadwig von Bayern Herzogin Hadwig von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hadwig_(Schwaben) Familie/Ehepartner: Burkhard III. (Burchard) von Schwaben. Burkhard (Sohn von Herzog Burkhard II. (Burchard) von Schwaben (Hunfriedinger / Burchardinger) und Herzogin Reginlinde (von Schwaben)) wurde geboren in cir 915; gestorben in 973; wurde beigesetzt in Kloster Reichenau, Insel Reichenau, Bodensee. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 68. | Herzog Gottfried I. von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_I,_Duke_of_Lower_Lorraine |
| 69. | Gerbirg (Gerberga) (von Jülich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Graf Meginoz von Geldern. Meginoz wurde geboren in cir 920; gestorben in 997. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. | Graf Gerhard II. von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 71. | Gebhard von Jülich (Matfriede) |
| 72. | Adalhard von Jülich (Matfriede) |
| 73. |  Graf Gottfried von Verdun (Wigeriche), der Gefangene Graf Gottfried von Verdun (Wigeriche), der Gefangene Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_I,_Count_of_Verdun Gottfried heiratete Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger) in cir 963. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann von Sachsen (Billunger) und Oda von Sachsen) wurde geboren in zw 935 und 945; gestorben am 25 Mai 1008; wurde beigesetzt in St. Peter in Gent. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbero_von_Reims |
| 75. |  Poppo V. (Babenberger/Popponen) Poppo V. (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 76. |  Graf Otto III. (Babenberger/Popponen) Graf Otto III. (Babenberger/Popponen) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. |  Otto I. von Weimar-Orlamünde Otto I. von Weimar-Orlamünde Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Weimar) Familie/Ehepartner: Adela von Brabant (Löwen). Adela (Tochter von Reginar von Löwen) gestorben in 1083. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. |  Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._(Istrien-Krain) Ulrich heiratete Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) in zw 1062 und 1063. Sophia (Tochter von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) gestorben am 18 Jun 1095. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 79. |  Leopold von Österreich (Babenberger) Leopold von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 80. |  Markgraf Ernst von Österreich (Babenberger), der Tapfere Markgraf Ernst von Österreich (Babenberger), der Tapfere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_(Österreich) Ernst heiratete Markgräfin Adelheid von Meissen (Wettinerin) in 1060. Adelheid (Tochter von Graf Dedo I. von Wettin (von Lausitz) und Oda von Lausitz) gestorben am 26 Jan 1071. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. |  Kaiser Konrad II. (Salier) Kaiser Konrad II. (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(HRR) Konrad heiratete Kaiserin Gisela von Schwaben in zw 1016 und 1017. Gisela (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren am 11 Nov 989; gestorben am 15 Feb 1043. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. | Konrad II. von Kärnten, der Jüngere Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(Kärnten) |
| 83. | von Kärnten (Salier) ? Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen. Heinrich (Sohn von Pfalzgraf Hermann I. von Lothringen und Gräfin Heylwig von Dillingen) gestorben am 20 Nov 1033; wurde beigesetzt in Brauweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. |  Herzog Otto III. von Schweinfurt (von Schwaben), der Weisse Herzog Otto III. von Schweinfurt (von Schwaben), der Weisse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_III,_Duke_of_Swabia Otto heiratete Prinzessin Mathilde von Polen in 1035 (Verlobt / Engaged / Fiancés). [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Irmgard (Arduine) von Turin (von Susa) in 1036. Irmgard (Tochter von Markgraf Olderich (Odelricus dictus Mainfredus) von Turin (Arduine) und Markgräfin Berta von Este) gestorben am 21 Jan 1078. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. |  Markgräfin Eilika von Schweinfurt Markgräfin Eilika von Schweinfurt Notizen: https://en.wikipedia.org/wiki/Eilika_of_Schweinfurt Eilika heiratete Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) in cir 1020. Bernhard (Sohn von Herzog Bernhard I. von Sachsen (Billunger) und Gräfin Hildegard von Stade) wurde geboren in cir 1000; gestorben am 29 Mai 1059. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 86. |  Herzogin Judith von Schweinfurt Herzogin Judith von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Judith und Břetislav I. hatten fünf Söhne. Judith heiratete Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) in zw 1021 und 1029 in Olmütz. Břetislav (Sohn von Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden) und Božena (Beatrice)) gestorben am 10 Jan 1055 in Chrudim; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prag. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. | 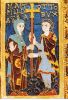 Otto I. von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) Otto I. von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) |
| 88. | 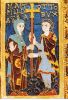 Mathilde von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) Mathilde von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) |
| 89. | Reginlint ? (Richilde) von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) Notizen: NICHT VERBÜRGT !! In der Forschung werden die Existenz und die Lebensdaten der Richhilde kontrovers diskutiert Familie/Ehepartner: Herzog Konrad I. (Kuno von Öhningen ?) von Schwaben. Konrad (Sohn von Graf Gebhard von Schwaben (im Ufgau) und (zweite Tochter von Heribert I.) von Vermandois) gestorben am 20 Aug 997. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. |  Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier) Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Kärnten) Familie/Ehepartner: Herzogin Judith von Kärnten. Judith (Tochter von Graf Heinrich von Radenz und Rangau (Luitpoldinger) und Herzogin Baba in Sachsen) gestorben in 991. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Otto III. von Deutschland (Liudolfinger / Ottonen) Otto III. von Deutschland (Liudolfinger / Ottonen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(HRR) |
| 92. |  Äbtissin Adelheid von Deutschland (Quedlinburg) Äbtissin Adelheid von Deutschland (Quedlinburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_I._(Quedlinburg) |
| 93. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_(Gandersheim) |
| 94. |  Prinzessin Mathilde von Deutschland Prinzessin Mathilde von Deutschland Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Schwester von Kaiser Otto III. Mathilde heiratete Pfalzgraf Ezzo von Lothringen in 992. Ezzo (Sohn von Pfalzgraf Hermann I. von Lothringen und Gräfin Heylwig von Dillingen) wurde geboren in 955; gestorben am 20 Apr 1034 in Saalfeld; wurde beigesetzt in Kloster Brauweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 95. |  Gräfin Ermentrud von Roucy Gräfin Ermentrud von Roucy Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Roucy_(Adelsgeschlecht) Ermentrud heiratete Graf Aubry II. von Mâcon in vor 14 Jan 971. Aubry (Sohn von Graf Liétald II. von Mâcon und Ermengarde von Dijon) wurde geboren in vor 942; gestorben in cir 981. [Familienblatt] [Familientafel] Ermentrud heiratete Graf Otto Wilhelm von Burgund in cir 982. Otto (Sohn von König Adalbert II. von Italien (von Ivrea) und Gräfin Gerberga von Mâcon) wurde geboren in cir 958; gestorben am 21 Sep 1026 in Dijon, Frankreich; wurde beigesetzt in Dijon, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 96. |  Graf Giselbert von Roucy Graf Giselbert von Roucy Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. |  Herbert III. von Vermandois Herbert III. von Vermandois Familie/Ehepartner: Ermengard N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. | König Ludwig V. von Frankreich (Karolinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_V._(Frankreich) Ludwig heiratete Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou in 982, und geschieden in 984. Adélaide (Tochter von Graf Fulko II. von Anjou, der Gute und Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden)) gestorben in 1026. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 99. | Mathilde von Burgund Notizen: Tochter der Mathilde von Burgund aus dem Hause der RUDOLFINGER (WELFEN) und einem namentlich unbekannten Gatten; Enkelin von König Konrad von Burgund Nach A. Wolf Tochter des Grafen Robert von Genf und der Mathilde von Burgund, Tochter von König Konrad. / Brandenburg Erich: Tafel 5 Seite 11 Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. |  König Rudolf III. von Burgund König Rudolf III. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Liste der Herrscher von Burgund: Familie/Ehepartner: Agiltrud. Agiltrud gestorben in Feb 1011. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Königin Irmingard von Burgund am 28 Jun 1011. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 101. | Prinzessin Gerberga von Burgund Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberga_von_Burgund Gerberga heiratete Graf Hermann I. von Werl in cir 978. Hermann gestorben in cir 985. [Familienblatt] [Familientafel]
Gerberga heiratete Herzog Hermann II. von Schwaben in cir 988. Hermann (Sohn von Herzog Konrad I. (Kuno von Öhningen ?) von Schwaben und Reginlint ? (Richilde) von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen)) gestorben in cir 4 Mai 1003. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. |  Bertha von Burgund Bertha von Burgund Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Burgund Bertha heiratete Graf Odo I. von Blois in cir 983/986. Odo (Sohn von Graf Theobald I. (Diebold) von Blois, der Betrüger und Gräfin Ledgard (Luitgard) von Vermandois) wurde geboren in cir 950; gestorben am 12.3.995 od 996. [Familienblatt] [Familientafel]
Bertha heiratete König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme in 996, und geschieden in 998. Robert (Sohn von König Hugo Capet (Kapetinger) und Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien)) wurde geboren am 27 Mrz 972; gestorben am 20 Jul 1031 in Melun. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 103. |  Gerberga von Niederlothringen Gerberga von Niederlothringen Familie/Ehepartner: Graf Lambert I. von Löwen (Hennegau), . Lambert (Sohn von Reginar III. von Hennegau, Langhals und Asela (Adelheid?) von Egisheim ?) gestorben am 12 Sep 1015 in Florennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. | Herzogin Irmentrud von Niederlothringen Notizen: 1012 urkundlich bezeugt. Familie/Ehepartner: Graf Albert I. von Namur. Albert (Sohn von Graf Robert I. von Namur und Ermengarde von Verdun) gestorben in vor 1011. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 105. | Prinzessin Hedwig von Frankreich (Kapetinger) Hedwig heiratete Reginar IV. von Hennegau in cir 996. Reginar (Sohn von Reginar III. von Hennegau, Langhals und Asela (Adelheid?) von Egisheim ?) wurde geboren in nach 947; gestorben in 1013. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. |  Prinzessin Gisla (Gisela) von Frankreich (Kapetinger) Prinzessin Gisla (Gisela) von Frankreich (Kapetinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Gisla heiratete Herr Hugo I. von Abbeville (von Ponthieu) in vor 987. Hugo (Sohn von Hugo von Ponthieu) gestorben in cir 1000. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 107. |  König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Frankreich) Robert heiratete Prinzessin Rozala Susanna von Italien in 988. Rozala (Tochter von König Berengar II. von Italien (von Ivrea) und Markgräfin Willa von Toscana (Bosoniden)) wurde geboren in zw 950 und 960; gestorben in 1003. [Familienblatt] [Familientafel] Robert heiratete Bertha von Burgund in 996, und geschieden in 998. Bertha (Tochter von König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige und Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund)) gestorben in nach 1010. [Familienblatt] [Familientafel] Robert heiratete Königin Konstanze von der Provence (von Arles) in 1003. Konstanze (Tochter von Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier und Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou) wurde geboren in 986; gestorben am 25 Jul 1034 in Melun oder Senlis; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 108. |  Herzog Dietrich von Oberlothringen (von Bar) Herzog Dietrich von Oberlothringen (von Bar) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_I._(Bar) Dietrich heiratete Gräfin Richilde (Richwara) von Lunéville? in cir 985. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. |  Graf Kuno von Rheinfelden Graf Kuno von Rheinfelden Familie/Ehepartner: von Genf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 110. |  Vizegraf Odo (Eudes) von Beaune Vizegraf Odo (Eudes) von Beaune Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 111. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II,_Holy_Roman_Emperor Familie/Ehepartner: Kunigunde von Luxemburg, die Heilige . Kunigunde (Tochter von Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) und Hedwig von Nordgau?) gestorben in 1033. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 112. | Brigida von Bayern Brigida heiratete Gerhard von Egisheim (im Nordgau) (Etichonen) in Datum unbekannt. Gerhard (Sohn von Hugo V. (Raucus) von Egisheim (im Nordgau) (Etichonen)) wurde geboren in cir 970; gestorben in vor 1004. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 113. |  Königin Gisela von Bayern Königin Gisela von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Gisela_of_Hungary Familie/Ehepartner: Grossfürst Stephan I. (Waik) von Ungarn (Árpáden), der Heilige . Stephan (Sohn von Grossfürst Géza (Geisa) von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Adelheid von Polen) wurde geboren in 969 in Esztergom; gestorben am 15 Aug 1038. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 114. | Gottfried von Geldern |
| 115. | Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau) Notizen: Irmentrud hatte mit Heribert vier Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Heribert in der Wetterau. Heribert (Sohn von Graf Udo I. in der Wetterau und Gräfin Kunigunde (oder Adela, Adele) von Vermandois) wurde geboren in cir 925; gestorben in 992. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 116. | Alvera von Geldern |
| 117. | Äbtissin Bertrada von Geldern |
| 118. | Äbtissin Adelheid von Geldern |
| 119. |  Herzog Gottfried von Verdun (von Niederlothringen) (Wigeriche), der Kinderlose Herzog Gottfried von Verdun (von Niederlothringen) (Wigeriche), der Kinderlose Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_II,_Duke_of_Lower_Lorraine |
| 120. |  Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Gothelo_I,_Duke_of_Lorraine Gozelo heiratete Ermengarde von Lothringen in cir 1002. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 121. |  Graf Friedrich von Verdun Graf Friedrich von Verdun |
| 122. |  Graf Hermann von Verdun (von Eenham Graf Hermann von Verdun (von Eenham |
| 123. |  Bischof Adalbero von Verdun Bischof Adalbero von Verdun |
| 124. |  Ermengarde von Verdun Ermengarde von Verdun Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmingard_von_Verdun Familie/Ehepartner: Graf Otto I. in der Wetterau (von Hammerstein). Otto (Sohn von Graf Heribert in der Wetterau und Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau)) wurde geboren in cir 975; gestorben am 5 Jun 1036. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 125. |  Regilla (Reginlind) von Verdun Regilla (Reginlind) von Verdun Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Filiation nicht gesichert ?? Familie/Ehepartner: Arnold II. (Adalbero) von Wels-Lambach. Arnold (Sohn von Graf Arnold I. von Formbach (zu Lambach) und Hiltiburg (Aribonen)) gestorben in 1055. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 126. |  Graf Poppo I. von Henneberg (von Würzburg) Graf Poppo I. von Henneberg (von Würzburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Hildegard von Thüringen (von Schauenburg) (Ludowinger). Hildegard (Tochter von Ludwig von Thüringen (von Schauenburg) (Ludowinger), der Bärtige und Cäcilie von Sangerhausen) gestorben in 1104. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 127. |  Graf Gotebold I. von Henneberg Graf Gotebold I. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 128. |  Domherr Bilis (Babenberger/Popponen?) Domherr Bilis (Babenberger/Popponen?) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 129. |  Adelheid von Weimar-Orlamünde Adelheid von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Weimar-Orlamünde Familie/Ehepartner: Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier). Adalbert (Sohn von Esico von Ballenstedt (Askanier) und Herzogin Mathilde von Schwaben) wurde geboren in cir 1030; gestorben in 1080. [Familienblatt] [Familientafel]
Adelheid heiratete Pfalzgraf Hermann II. von Lothringen in cir 1080. Hermann (Sohn von Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende und Mathilde von Niederlothringen) wurde geboren in cir 1049; gestorben am 20 Sep 1085 in Dalhem. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Heinrich II. von Laach (Gleiberg-Luxemburg). Heinrich wurde geboren in cir 1050; gestorben am 23 Okt 1095 in Burg Laach; wurde beigesetzt in Abtei Maria Laach. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 130. | Oda von Weimar-Orlamünde Familie/Ehepartner: Ekbert II. von Meissen (von Braunschweig)(Brunonen). Ekbert (Sohn von Ekbert I. von Meissen (von Braunschweig)(Brunonen) und Irmgard (Arduine) von Turin (von Susa)) wurde geboren in cir 1059/1061; gestorben in 3.Jul 1090 in Selketal, Harz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 131. |  Kunigunde von Weimar-Orlamünde Kunigunde von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Kunigunde hatte mit Kuno mindestens vier Kinder. Familie/Ehepartner: Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow. Jaropolk (Sohn von Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) und Prinzessin Gertrud von Polen) wurde geboren in vor 1050; gestorben in 22 Nov 1086 od 1087 in Swenigorod; wurde beigesetzt in Dmitrij-Kloster in der St. Petri-Kirche, Kiew. [Familienblatt] [Familientafel]
Kunigunde heiratete Graf Kuno von Northeim (von Beichlingen) in 1088. Kuno (Sohn von Otto von Northeim und Herzogin Richenza von Schwaben ?) wurde geboren in 1050/1060; gestorben in 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgraf Wiprecht II. von Groitzsch, der Ältere . Wiprecht (Sohn von Gaugraf Wiprecht I. vom Balsamgau (von Groitzsch) und Sigena von Leinungen) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 22 Mai 1124 in Kloster St. Jacob in Pegau; wurde beigesetzt in Kirche St. Laurentius, Pegau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 132. |  Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppo_II._(Istrien) Familie/Ehepartner: Gräfin Richardis (Richarda) von Spanheim. Richardis (Tochter von Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) und Hadwig (Hedwig) von Sachsen) gestorben in cir 1130. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 133. | Richgard von Weimar-Orlamünde (von Krain) Notizen: Richgard und Ekkehard I. hatten drei Söhne, Familie/Ehepartner: Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher). Ekkehard (Sohn von Otto I. von Scheyern (Wittelsbacher) und Haziga (Hadegunde) von Diessen) gestorben in vor 11 Mai 1091. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 134. |  Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_II._(Österreich) Familie/Ehepartner: Ida (Itha) von Österreich. Ida gestorben in nach 1101 in Heraklea. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 135. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(HRR) Heinrich heiratete Gräfin Agnes von Poitou am 21 Nov 1043. Agnes (Tochter von Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse und Gräfin Agnes von Burgund) wurde geboren in cir 1025; gestorben am 13 Dez 1077. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 136. | Mathilde von Franken (Salier) Notizen: Heinrich I. und Mathilde waren einander versprochen. Zur Heirat kam es nicht, da Mathilde früh verstarb. Familie/Ehepartner: Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger). Heinrich (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in 1008; gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 137. |  Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Lothringen Familie/Ehepartner: Mathilde von Niederlothringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 138. |  Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige . Berchtold (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)) wurde geboren in cir 1000; gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 139. | Berta von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 140. |  Gisela von Schwaben Gisela von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweinfurt_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Arnold von Reichenbeuren (von Diessen). Arnold (Sohn von Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen) und Irmgard von Gilching) wurde beigesetzt in Kloster Benediktbeuren. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 141. | Judith von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 142. | Äbtissin Eilika von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 143. | Beatrix von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 144. | Herzogin Ida von Sachsen? Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ida_de_Saxe Ida heiratete Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen) in cir 1055. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich von Luxemburg und Gräfin Irmtrud (Irmintrud) in der Wetterau) wurde geboren in cir 1005; gestorben am 28 Aug 1065. [Familienblatt] [Familientafel] Ida heiratete Graf Albert III. von Namur in cir 1065. Albert (Sohn von Graf Albert II. von Namur und Herzogin Reginlinde von Niederlothringen) gestorben am 22 Jun 1102. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 145. | Gertrude Billung (von Sachsen) Notizen: Gertrude und Florens I. hatten acht Kinder, davon vier Söhne, zwei Töchter und zwei unbekannt. Gertrude heiratete Graf Robert I. von Flandern, der Friese in 1063. Robert (Sohn von Balduin V. von Flandern, der Fromme und Adela von Frankreich, die Heilige ) wurde geboren in cir 1033; gestorben in zw 12 und 13 Okt 1093. [Familienblatt] [Familientafel]
Gertrude heiratete Graf Florens I. von Holland (Gerulfinger) in 1050. Florens (Sohn von Graf Dietrich III. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger), der Jerusalemer und Othelendis von Sachsen) wurde geboren in cir 1020; gestorben am 18 Jun 1061. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 146. |  Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ordulf_(Sachsen) Familie/Ehepartner: Wulfhild von Norwegen. Wulfhild (Tochter von König Olav II. Haraldsson von Norwegen und Astrid von Schweden) gestorben am 24 Mai 1071. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 147. | Hadwig (Hedwig) von Sachsen Notizen: Achtung: Die Herkunft von Hadwig ist nicht direkt nachweisbar. Sie wurde als Hadwig Billung, Tochter des Bernhard II. von Sachsen identifiziert,wird aber in neueren Forschungen (Hausmann 1994) einem Geschlechte aus Friaul zugeordnet! Familie/Ehepartner: Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim). Engelbert (Sohn von Graf Siegfried I. von Spanheim (Sponheim) und Gräfin Richardis (Richgard) von Lavant (Sieghardinger)) gestorben am 1 Apr 1096 in St. Paul im Lavanttal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 148. | 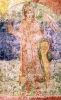 König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II. (Okt 2017) Vratislaw heiratete Prinzessin Adelheid von Ungarn (Árpáden) in 1058. Adelheid (Tochter von König Andreas I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Anastasia von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1040; gestorben am 27 Jan 1062. [Familienblatt] [Familientafel]
Vratislaw heiratete Königin Swatawa von Polen in 1062. Swatawa (Tochter von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew) wurde geboren in vor 1050; gestorben am 1 Sep 1126. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 149. | Judith (Jutta) von Öhningen (von Rheinfelden) Judith heiratete Graf Adalbert II. im Saargau, von Metz (Matfriede) in vor 979. Adalbert (Sohn von Graf Gerhard von Metz (Matfriede)) gestorben in 1033. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 150. | Herzog Hermann II. von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Schwaben) Hermann heiratete Prinzessin Gerberga von Burgund in cir 988. Gerberga (Tochter von König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige und Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund)) wurde geboren in zw 965 und 970; gestorben in 1017. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 151. |  Graf Heinrich von Speyer (Salier) Graf Heinrich von Speyer (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_(Salier) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Metz. Adelheid (Tochter von Graf Richard von Metz) gestorben in an einem 19 Mai zw 1040 und 1046. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 152. | Papst Bruno (Gregor V.) von Kärnten Notizen: Geburtsname war Brun von Kärnten |
| 153. |  Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier) Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Kärnten) Familie/Ehepartner: Herzogin Mathilde von Schwaben. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren in cir 989; gestorben am 29 Jul 1032. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 154. | 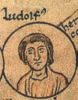 Herr Liudolf (Ludolf) von Brauweiler (von Lothringen) (Ezzonen) Herr Liudolf (Ludolf) von Brauweiler (von Lothringen) (Ezzonen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Ezzonen) Familie/Ehepartner: Mathilde von Zutphen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 155. |  Erzbischof Hermann II. von Lothringen Erzbischof Hermann II. von Lothringen |
| 156. |  Pfalzgraf Otto von Lothringen Pfalzgraf Otto von Lothringen |
| 157. |  Pfalzgräfin Richenza von Lothringen Pfalzgräfin Richenza von Lothringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richeza_(Polen) Richenza heiratete König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) in 1013. Miezislaus (Sohn von König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) und Prinzessin Eminilde von Westslawien) wurde geboren in 990; gestorben am 25 Mrz 1034. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 158. |  Theophanu von Lothringen Theophanu von Lothringen Notizen: Ehrung: |
| 159. |  Mathilde von Burgund Mathilde von Burgund Notizen: Mathilde und Llandry hatten Söhne, darunter: Mathilde heiratete Graf Landry (Landerich) von Nevers (Monceaux) in ca 989/995. Landry (Sohn von Herr Bodo de Monceaux) gestorben am 11 Mai 1028. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 160. |  Gerberga von Burgund Gerberga von Burgund Gerberga heiratete Graf Wilhelm II. von der Provence, der Fromme in cir 1002. Wilhelm (Sohn von Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier und Arsenda von Comminges (Couserans)) wurde geboren in cir 987; gestorben in vor 30 Mai 1018; wurde beigesetzt in Abtei Montmajour bei Arles. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 161. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_I._(Burgund) Rainold heiratete Herzogin Adelheid (Judith) von der Normandie am 1 Sep 1016. Adelheid (Tochter von Herzog Richard II. von der Normandie (Rolloniden), der Gute und Gräfin Judith von Rennes) wurde geboren in cir 1000. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 162. |  Gräfin Agnes von Burgund Gräfin Agnes von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Burgund_(Herzogin_von_Aquitanien) (Okt 2017) Agnes heiratete Gottfried II. von Anjou, Martel (der Hammer) am 1 Jan 1032. Gottfried (Sohn von Graf Fulko III. von Anjou und Hildegard von Sundgau ?) wurde geboren am 14. Oktober 1006/1007; gestorben am 14 Nov 1060. [Familienblatt] [Familientafel] Agnes heiratete Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse in 1018. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm IV. von Poitou (Ramnulfiden), Eisenarm und Gräfin Emma von Blois) wurde geboren in cir 969; gestorben am 31 Jan 1030 in Kloster Maillezais. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 163. |  Graf Ebles I. (Ebal) von Roucy Graf Ebles I. (Ebal) von Roucy Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Roucy_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Beatrix von Hennegau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 164. |  Judith von Roucy Judith von Roucy Familie/Ehepartner: Manasses I. von Rethel ?. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Hermann von Grand-Pré. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 165. |  Otto (Eudes) von Vermandois Otto (Eudes) von Vermandois Familie/Ehepartner: Pavia N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 166. | von Genf Notizen: Schwester der Bertha von Genf Familie/Ehepartner: Graf Kuno von Rheinfelden. Kuno (Sohn von Pfalzgraf Quidam (Kuno?) von Burgund und Beatrix von Frankreich) gestorben in 1026. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 167. |  Graf Hermann II. von Werl Graf Hermann II. von Werl Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Hermann II. von Werl Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Hermann heiratete Godila von Rothenburg in 1007. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 168. |  Rudolf (Ludolf) von Werl Rudolf (Ludolf) von Werl Notizen: Rudolf von Werl (auch Ludolf) Rudolf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 169. |  Bernhard I. von Werl Bernhard I. von Werl Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Bernhard I. von Werl Bernhard heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 170. |  Herzogin Mathilde von Schwaben Herzogin Mathilde von Schwaben Notizen: Mathilde hatte mit ihrem ersten Gatten, Konrad I. zwei Söhne und eine Tochter. Familie/Ehepartner: Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier). Konrad (Sohn von Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier) und Herzogin Judith von Kärnten) gestorben in 1011. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Herzog Friedrich II. von Oberlothringen (von Bar) in zw 1011 und 1015. Friedrich (Sohn von Herzog Dietrich von Oberlothringen (von Bar) und Gräfin Richilde (Richwara) von Lunéville?) wurde geboren in cir 995; gestorben in 1026. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Esico von Ballenstedt (Askanier). Esico (Sohn von Vogt Adalbert von Ballenstedt und Hidda von der sächsischen Ostmark) wurde geboren in ca 990 / 1000; gestorben in cir 1060. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 171. |  Kaiserin Gisela von Schwaben Kaiserin Gisela von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gisela_von_Schwaben Gisela heiratete Kaiser Konrad II. (Salier) in zw 1016 und 1017. Konrad (Sohn von Graf Heinrich von Speyer (Salier) und Gräfin Adelheid von Metz) wurde geboren in cir 990; gestorben am 4 Jun 1039; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
Gisela heiratete Brun I. von Braunschweig in cir 1002. Brun wurde geboren in 96o-980; gestorben in cir 1014. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzog Ernst I. von Schwaben (Babenberger). Ernst (Sohn von Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte und Richenza (Richarda, Richwarda, Rikchard) von Sualafeldgau (Ernste)) wurde geboren in vor 994; gestorben am 31 Mai 1015. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 172. | Beatrix (Brigitta) von Schwaben Familie/Ehepartner: Markgraf Adalbert I. (Adalbero) von Eppenstein (von Kärnten). Adalbert (Sohn von Markgraf Markwart III. von Eppenstein und Hadamut (Hadamuod) von Ebersberg) wurde geboren in cir 980; gestorben am 28 Nov 1039 in Ebersberg, Bayern, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 173. |  Graf Odo II. von Blois Graf Odo II. von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Odo_II._(Blois) (Okt 2017) Odo heiratete Mathilde von der Normandie am 1003 oder 1004. Mathilde (Tochter von Herzog Richard I. von der Normandie (Rolloniden), der Furchtlose und Cunnora de Crépon (von Dänemark)) gestorben in 1005. [Familienblatt] [Familientafel]
Odo heiratete Ermengarde von Auvergne in 1005. Ermengarde (Tochter von Graf Wilhelm IV. von Auvergne) gestorben in nach 1042. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 174. |  Lambert II. von Löwen Lambert II. von Löwen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Lambert_II._(Löwen) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Oda von Verdun. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 175. |  Mathilde von Löwen (Hennegau) Mathilde von Löwen (Hennegau) Familie/Ehepartner: Eustach I. von Boulogne. Eustach wurde geboren in 1010; gestorben in 1049. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 176. |  Reginar von Löwen Reginar von Löwen Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 177. |  Graf Albert II. von Namur Graf Albert II. von Namur Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_II._(Namur) Familie/Ehepartner: Herzogin Reginlinde von Niederlothringen. Reginlinde (Tochter von Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse und Ermengarde von Lothringen) wurde geboren in 1007; gestorben in 1064. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 178. | Luitgard von Namur Notizen: Im Bericht von Albert I. von Namur wird Luitgard nicht erwähnt? Familie/Ehepartner: Graf Otto von Loon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 179. |  Graf Reginar V. von Mons (Hennegau) Graf Reginar V. von Mons (Hennegau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Reginar_V. (Okt 2017) Reginar heiratete Mathilde von Verdun in cir 1015. Mathilde (Tochter von Graf Hermann von Verdun (von Eenham) (Wigeriche)) gestorben in nach 1039. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 180. |  Beatrix von Hennegau Beatrix von Hennegau Familie/Ehepartner: Graf Ebles I. (Ebal) von Roucy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 181. |  Graf Enguerrand I. von Ponthieu Graf Enguerrand I. von Ponthieu Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Enguerrand_I._(Ponthieu) Enguerrand heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Adelvie (Aleida) von Westfriesland (Gerulfinger). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 182. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Adele heiratete Graf Rainald I. von Nevers (Monceaux) in 1028. Rainald (Sohn von Graf Landry (Landerich) von Nevers (Monceaux) und Mathilde von Burgund) wurde geboren in cir 1000; gestorben am 29 Mai 1040 in Seignelay; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Germain, Auxerre. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 183. |  Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Frankreich) Familie/Ehepartner: Mathilde von Franken (Salier). Mathilde (Tochter von Kaiser Konrad II. (Salier) und Kaiserin Gisela von Schwaben) gestorben in 1034; wurde beigesetzt in Dom zu Worms. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Mathilde von Friesland in cir 1034. Mathilde (Tochter von Liudolf von Braunschweig (von Friesland) und Gertrud von Braunschweig, die Ältere ) wurde geboren in cir 1024; gestorben in 1044. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Anna von Kiew (Rurikiden) am 19 Mai 1051. Anna (Tochter von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden) wurde geboren in zw 1024 und 1035. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 184. | Adela von Frankreich, die Heilige Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adela_von_Frankreich Adela heiratete Herzog Richard III. von der Normandie (Rolloniden) am 23 Aug 1026 (Verlobt). Richard (Sohn von Herzog Richard II. von der Normandie (Rolloniden), der Gute und Gräfin Judith von Rennes) wurde geboren in cir 1001; gestorben am 6 Aug 1027. [Familienblatt] [Familientafel] Adela heiratete Balduin V. von Flandern, der Fromme in 1028 in Paris, France. Balduin (Sohn von Graf Balduin IV. von Flandern und Otgiva von Luxemburg) wurde geboren in 1012 in Arras; gestorben in 1067 in Lille; wurde beigesetzt in Im Zentrum des Chors der Kirche Saint-Pierre in Lille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 185. |  Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Liste der Herrscher von Burgund: Familie/Ehepartner: Helie von Semur. Helie (Tochter von Damas I. von Semur) gestorben in nach 1055. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Ermengarde von Anjou. Ermengarde (Tochter von Graf Fulko III. von Anjou und Hildegard von Sundgau ?) wurde geboren in ? 1018; gestorben am 18 Mrz 1076 in Fleurey-sur-Ouche. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 186. |  Adelheid (Adele) von Oberlothringen (von Bar) Adelheid (Adele) von Oberlothringen (von Bar) Familie/Ehepartner: Graf Walram I. von Arlon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 187. |  Herzog Friedrich II. von Oberlothringen (von Bar) Herzog Friedrich II. von Oberlothringen (von Bar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Bar) Friedrich heiratete Herzogin Mathilde von Schwaben in zw 1011 und 1015. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren in cir 989; gestorben am 29 Jul 1032. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 188. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_of_Rheinfelden Rudolf heiratete Prinzessin Mathilde von Deutschland (von Weiblingen) in 1059. Mathilde wurde geboren in 1045; gestorben am 12 Mai 1060 in Goslar. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzogin Adelheid von Turin (von Maurienne). Adelheid (Tochter von Graf Otto von Savoyen (von Maurienne) und Markgräfin Adelheid (Arduine) von Susa (von Turin)) gestorben in 1079. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 189. |  Herrin Elisabeth von Beaune (Vergy) Herrin Elisabeth von Beaune (Vergy) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth de Vergy († apr. 1115), dame de VergyN 4. Début xiie (charte non datée) elle donne des biens à Cîteaux. En 1120 ou 1124, elle redonne à Saint-Étienne de Dijon la manse de la "villa…Modeliacus", futur Meuilleymdlnds 16 (ce qui sous-entend clairement qu'un de sa famille l'avait volé des moines en premier lieu) ; elle autorise les moines de Saint-Germain-des-Prés à donner à Cîteaux des terres "apud Gilliacum" acquises de "Aimonem et conjugem eius Waronem...et Widonem filios eiusdem" (Aimon et sa conjointe Waro... et leur fils Wido). Familie/Ehepartner: Herr Savary (Savaricus, Severicus) de Châtel-Censoir. Savary gestorben am 1120 oder später. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 190. | Hedwig von Egisheim (im Nordgau) (Etichonen) Hedwig heiratete Graf Eberhard I. (V.) (Eppo) von Nellenburg (Eberhardinger) in Datum unbekannt. Eberhard (Sohn von Manegold I. im Zürichgau) wurde geboren in cir 980/990; gestorben in cir 1030/34. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 191. | Notizen: In der römisch-katholischen Kirche wird er als Heiliger verehrt. |
| 192. | 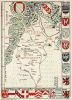 Gräfin Gerberga in der Wetterau Gräfin Gerberga in der Wetterau Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Gerberga heiratete Markgraf Heinrich von Schweinfurt in vor 1003. Heinrich (Sohn von Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt und Gräfin Eilika von Walbeck) wurde geboren in vor 980; gestorben am 18 Sep 1017. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 193. | G. in der Wetterau |
| 194. | Gräfin Irmtrud (Irmintrud) in der Wetterau Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmtrud_von_der_Wetterau Familie/Ehepartner: Graf Friedrich von Luxemburg. Friedrich (Sohn von Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) und Hedwig von Nordgau?) wurde geboren in cir 965; gestorben am 6 Okt 1019. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 195. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Hammerstein Familie/Ehepartner: Ermengarde von Verdun. Ermengarde (Tochter von Graf Gottfried von Verdun (Wigeriche), der Gefangene und Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger)) wurde geboren in cir 975; gestorben in 1042. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 196. |  Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_III,_Duke_of_Lower_Lorraine Familie/Ehepartner: Oda (Doda). [Familienblatt] [Familientafel]
Gottfried heiratete Beatrix von Oberlothringen (von Bar) in 1054. Beatrix (Tochter von Herzog Friedrich II. von Oberlothringen (von Bar) und Herzogin Mathilde von Schwaben) wurde geboren in cir 1017; gestorben am 18 Apr 1076. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 197. |  Herzog Gozelo II. von Niederlothringen (von Verdun) Herzog Gozelo II. von Niederlothringen (von Verdun) |
| 198. |  Papst Friedrich von Niederlothringen (von Verdun) Papst Friedrich von Niederlothringen (von Verdun) |
| 199. |  Oda von Verdun Oda von Verdun Familie/Ehepartner: Lambert II. von Löwen. Lambert (Sohn von Graf Lambert I. von Löwen (Hennegau), und Gerberga von Niederlothringen) gestorben am 19 Jun 1054. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 200. |  Mathilde von Niederlothringen Mathilde von Niederlothringen Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende . Heinrich (Sohn von Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen und von Kärnten (Salier) ?) gestorben am 7 Mrz 1061 in Kloster Echternach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 201. |  Herzogin Reginlinde von Niederlothringen Herzogin Reginlinde von Niederlothringen Notizen: 1064 urkundlich bezeugt. Familie/Ehepartner: Graf Albert II. von Namur. Albert (Sohn von Graf Albert I. von Namur und Herzogin Irmentrud von Niederlothringen) wurde geboren in 1000; gestorben in zw 1063 und 1064. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 202. | Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herr Liudolf (Ludolf) von Brauweiler (von Lothringen) (Ezzonen). Liudolf (Sohn von Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und Prinzessin Mathilde von Deutschland) gestorben am 11 Apr 1031. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 203. | Markgraf Gottfried von Kärnten (von Lambach) Notizen: "Adalbero Bischof von Würzburg" Den Sohn Gottfried bezeichnet die Vita Adalberonis als "virum strenuum et fortem, virum rebus bellicus aptissimum, crebris preliorum successibus fortunatum". In Urkunden begegnet uns Gottfried mehrere Male. In einer Urkunde Kaiser HEINRICHS III., ausgestellt in Speyer am 2. Mai 1041, werden einem gewissen Engelschalk Lehen im Enns- und Paltental gegeben "in comitatu Gotefridi comitis positos" Nach einer weiteren Urkunde vom 8. November 1042 schenkt HEININRICH III. "nostri fideli Gotifredo marchioni" 2 Königshufen zu Gösting oder in der Nachbarschaft mit 4 namentlich genannten Hörigen. Ferner liegen in einer Urkunde vom 7. Dezember 1045 Leitersdorf in der Grafschaft des Markgrafen Gottfried, und ebenso in einer Urkunde vom 2. Oktober 1048 Rottenmann im Paltental "in comitatu Gotefridi marchionis" In den drei letzt angeführten Urkunden ist Gottfried als Markgraf bezeichnet. Wie wir oben gesehen haben, war sein Vater Arnold II. nach der Absetzung der EPPENSTEINER zum Markgrafen der Steiermark erhoben worden. Nun finden wir noch zu Lebzeiten seines Vaters auch Gottfried als Markgrafen der Karantanischen Mark. Ob er vielleicht einen besonderen Teil dieser Mark verwaltete oder die Amtsgeschäfte seines Vaters daselbst versah, ist eine Frage, über die uns die Geschichtsquellen keine nähere Auskunft geben. Gottfried ist nicht nur als Markgraf, sondern auch als Kriegsheld in die Geschichte eingegangen. Als 1042 HEINRICH IIII. zur Kaiserkrönung in Italien weilte, benutzten die Ungarn die Abwesenheit des Kaisers, um wieder einmal einen Einfall in die Karantanische Mark zu wagen. Hier machten sie nicht nur große Beute, sondern schleppten auch viele Gefangene mit sich fort. Doch Markgraf Gottfried gelang es, schnell ein Heer zusammenzubringen, mit dem er sofort die Ungarn verfolgte; bei Pettau im Drautale schlug er die Ungarn vernichtend. Die Altaicher Jahrbücher berichten uns zum Jahre 1042 von dieser Heldentat Gottfrieds, und wie die von den Ungarn Gefangenen und jetzt wieder Befreiten "jubelnd" in die Heimat zurückgekehrt sind. Dieser Sieg Gottfrieds war von solcher Entscheidung, dass auch zwei andere ungarische Heere, die gleichzeitig weiter nnördlich eingefallen waren, nunmehr den Rückzug antreten mussten. So hatte sich Markgraf Gottfried in Abwesenheit des Kaisers den Ruhm treuester Lehenspflicht und glänzender Tapferkeit erworben. Markgraf Gottfried besaß auch die Burg Pütten bei Wiener-Neustadt. Wie er dieselbe erworben hat, ob durch Heirat oder Schenkung oder sonst wie, ist unbekannt. Strandt und andere österreichische Historiker halten Gottfried überhaupt für den Gründer von Pütten. Über den Tod Gottfrieds berichten die Altaicher Jahrbücher zum Jahre 1050: "Tum marchio Gotefridus, ab iniquis circumventus, innocens occiditur". Danach dürften Feinde in Abwesenheit Arnolds II. und Gottfrieds die väterliche Stammburg Lambach überfallen und die Mutter Reginlinde, den Bruder Arnold III. und dessen Gemahlin Hazecha erschlagen haben. Nach dem Lambacher Nekrolog haben nämlich diese drei denselben Todestag, nämlich den 1. Februar. Als auf die Nachricht von diesen Ereignissen Gottfried herbeieilte, umringten ihn die Feinde und töteten auch ihn. Als sein Todestag gilt der 8. Februar. Markgraf Arnold, der auf die Schreckensnachricht auch herbeikam, fand alles zerstört. Er überlebte diesen schweren Schlag nur noch kurze Zeit. Gottfried, dessen Gattin unbekannt ist, hinterließ keine männlichen Nachkommen, sondern nur eine Tochter Mechthild, die den aus dem FORMBACHER Hause stammenden Grafen Ekbert I., Graf im Quinziggau, heiratete. Lechner Karl: Seite 70,73,176 Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 204. | Willibirg von Wels-Lambach Familie/Ehepartner: Otakar V. Oci (Traungauer). Otakar gestorben in 1020. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 205. |  Adalbero von Würzburg Adalbero von Würzburg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbero_von_Würzburg |
| 206. |  Graf Gotebold II. von Henneberg (von Würzburg) Graf Gotebold II. von Henneberg (von Würzburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Godebold_II. Familie/Ehepartner: Luitgard von Hohenberg. Luitgard (Tochter von Bertold I. von Hohenberg, der Ältere und Liutgard) gestorben in ca 1144/1145. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 207. |  Poppo II. von Würzburg Poppo II. von Würzburg Notizen: Name: |
| 208. |  Graf Otto von Ballenstedt (Askanier), der Reiche Graf Otto von Ballenstedt (Askanier), der Reiche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_(Ballenstedt) Familie/Ehepartner: Gräfin Eilika von Sachsen. Eilika (Tochter von Magnus von Sachsen (Billunger) und Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden)) wurde geboren in cir 1081; gestorben am 16 Jan 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 209. |  Mechthild von Beichlingen (von Wolhynien und Turow) Mechthild von Beichlingen (von Wolhynien und Turow) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Mechthild heiratete Graf Günther I. von Kevernburg (Käfernburg) in nach 1087. Günther gestorben in 1109. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 210. |  Luitgard von Northeim (von Beichlingen) Luitgard von Northeim (von Beichlingen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Luitgard heiratete Graf Wilhelm von Luxemburg (von Gleiberg) in 1105. Wilhelm (Sohn von Graf Konrad I. von Luxemburg und Clementia von Poitou (Poitiers)) wurde geboren in 1081; gestorben in 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 211. |  Kunigunde von Northeim (von Beichlingen) Kunigunde von Northeim (von Beichlingen) Familie/Ehepartner: Wiprecht III. von Groitzsch, der Jüngere . Wiprecht (Sohn von Markgraf Wiprecht II. von Groitzsch, der Ältere und Judith von Böhmen) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 22 Mai 1124 in Pegau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 212. |  Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 213. |  Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: Otto V. von Scheyern, nach anderer Zählart Otto IV. von Scheyern, (* 1083/1084; † 4. August 1156) stammt aus dem Geschlecht der Grafen von Scheyern, deren Name sich durch die Umsiedlung auf die Burg Wittelsbach in Grafen von Wittelsbach änderte. Er war Sohn von Ekkehardt I. von Scheyern und Richgard von Krain-Orlamünde. Er ist in dem Kloster Ensdorf, das von ihm gegründet wurde, begraben.[1] Familie/Ehepartner: Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe. Heilika (Tochter von Graf Friedrich III. von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe und Helwic von Schwaben ?) wurde geboren in cir 1103; gestorben am 14 Sep 1170 in Lengenfeld; wurde beigesetzt in Kloster Engsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 214. |  Markgräfin Elisabeth von Österreich (Babenberger) Markgräfin Elisabeth von Österreich (Babenberger) Familie/Ehepartner: Markgraf Ottokar II. von Steiermark. Ottokar (Sohn von Markgraf Ottokar I. von Steiermark und Willibirg von Eppenstein (von Kärnten)) gestorben am 28 Nov 1122. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 215. |  Leopold III. von Österreich (Babenberger), der Heilige Leopold III. von Österreich (Babenberger), der Heilige Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_III._(Österreich) Leopold heiratete Adelheid von Perg, Machland in vor 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
Leopold heiratete Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen) in 1106. Agnes (Tochter von Kaiser Heinrich IV. (Salier) und Gräfin Berta von Savoyen (von Maurienne)) wurde geboren in cir 1073; gestorben am 24 Sep 1143; wurde beigesetzt in Klosterneuburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 216. |  Sophie von Österreich (Babenberger) Sophie von Österreich (Babenberger) Sophie heiratete Herzog Heinrich III. von Kärnten (von Eppenstein) in nach 1103. Heinrich (Sohn von Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) und Liutberge von Plain) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 4 Dez 1122. [Familienblatt] [Familientafel] Sophie heiratete Graf Sieghard X. von Tengling (Sieghardinger) in 1108. Sieghard (Sohn von Graf Sieghard IX. von Tengling (Sieghardinger) und Ida von Süpplingenburg (Sachsen)) gestorben am 19 Jun 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 217. |  Kaiser Heinrich IV. (Salier) Kaiser Heinrich IV. (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(HRR) Heinrich heiratete Gräfin Berta von Savoyen (von Maurienne) am 13 Jul 1066 in Würzburg und Tribur. Berta (Tochter von Graf Otto von Savoyen (von Maurienne) und Markgräfin Adelheid (Arduine) von Susa (von Turin)) wurde geboren am 21 Sep 1051; gestorben am 27 Dez 1087. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Adelheid (Jewspraksija, Praxedis) von Kiew am 14 Aug 1089, und geschieden in 1095. Adelheid (Tochter von Wsewolod I. Jaroslawitsch von Kiew (Rurikiden) und Anna von Polowzen) wurde geboren in 1067/1070; gestorben am 20 Jul 1109 in Kiew. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 218. | Judith (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Judith und Salomon hatten eine Tochter. Judith heiratete König Salomon von Ungarn (Árpáden) in zw 1063 und 1066. Salomon (Sohn von König Andreas I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Anastasia von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1053; gestorben in 1087. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) in 1088. Władysław (Sohn von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew) wurde geboren in 1043; gestorben am 4 Jun 1102 in Płock. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 219. |  Pfalzgraf Hermann II. von Lothringen Pfalzgraf Hermann II. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Lothringen) Hermann heiratete Adelheid von Weimar-Orlamünde in cir 1080. Adelheid (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben am 28 Mrz 1100; wurde beigesetzt in Springiersbach. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 220. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stammvater der Linie der Markgrafen von Baden. Familie/Ehepartner: Judith. Judith gestorben in 1091 in Salerno, Kampanien, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 221. |  Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_II,_Duke_of_Swabia Berthold heiratete Herzogin Agnes von Rheinfelden in 1079. Agnes (Tochter von Herzog Rudolf von Rheinfelden (von Schwaben) und Herzogin Adelheid von Turin (von Maurienne)) wurde geboren in cir 1065 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 19 Dez 1111; wurde beigesetzt in Kloster St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 222. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liutgard_von_Zähringen_(Tochter_Berthold_I.) Familie/Ehepartner: Diepold II. von Vohburg (von Giengen). Diepold (Sohn von Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen)) gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Ernst I. von Grögling. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 223. |  Richinza von Zähringen Richinza von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Rudolf ? von Frickingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Ludwig I. von Sigmaringen, der Ältere . Ludwig gestorben in vor 1092. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 224. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_II._(Andechs) Familie/Ehepartner: Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar). Sophie (Tochter von Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) und Gräfin Richardis (Richarda) von Spanheim) gestorben in 1132. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Gräfin Kunigunde (Hedwig) von Pütten. Kunigunde (Tochter von Graf Eckbert II. von Formbach von Pütten (Pitten) und Markgräfin Wilibirg von Steiermark) gestorben am 15 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 225. | Gebhard von Diessen Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Richgard N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 226. | Ida von Namur |
| 227. | Alix von Namur Familie/Ehepartner: Otto II. von Chiny. Otto gestorben in Dez 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 228. | Bischof Friedrich von Namur |
| 229. |  Gottfried von Namur Gottfried von Namur Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_I,_Count_of_Namur Gottfried heiratete Sibylla von Château-Porcien in cir 1087, und geschieden in cir 1104. [Familienblatt] [Familientafel] Gottfried heiratete Ermensinde von Luxemburg in nach 1098. Ermensinde (Tochter von Graf Konrad I. von Luxemburg und Clementia von Poitou (Poitiers)) wurde geboren in cir 1075; gestorben am 24 Jun 1143. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 230. | Albert von Namur |
| 231. | Graf Heinrich I. von Namur |
| 232. |  Graf Robert II. von Flandern (von Jerusalem) Graf Robert II. von Flandern (von Jerusalem) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Flandern) Familie/Ehepartner: Klementina (Clémence) von Burgund. Klementina (Tochter von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) gestorben in cir 1133. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 233. |  Königin Adela von Flandern Königin Adela von Flandern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adela_von_Flandern Adela heiratete König Knut IV. von Dänemark, der Heilige in 1080 in Odense. Knut (Sohn von König Sven Estridsson von Dänemark und Aussereheliche Beziehungen) wurde geboren in cir 1043; gestorben am 10 Jul 1086 in Odense. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzog Roger Borsa von Apulien. Roger wurde geboren in 1061; gestorben am 22 Feb 1111. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 234. |  Gertrude von Flandern Gertrude von Flandern Familie/Ehepartner: Heinrich III. von Löwen. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich II. von Löwen und Adelheid von Betuwe) wurde geboren in 1060; gestorben in Februar oder März 1095 in Tournai. [Familienblatt] [Familientafel] Gertrude heiratete Herzog Dietrich II. von Oberlothringen (Haus Châtenois) in 1096. Dietrich (Sohn von Herzog Gerhard von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois) und Hedwig von Namur) wurde geboren in vor 1065; gestorben am 23 Jan 1115; wurde beigesetzt in Châtenoi. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 235. | Philipp von Loo |
| 236. | Ogiva von Flandern |
| 237. |  Graf Dietrich V. von Holland (Gerulfinger) Graf Dietrich V. von Holland (Gerulfinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_V. Familie/Ehepartner: Prinzessin Othehilde von Sachsen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 238. |  Bertha von Holland Bertha von Holland Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Holland Familie/Ehepartner: Philipp I. von Frankreich (Kapetinger). Philipp (Sohn von Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) und Anna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren am 23 Mai 1052; gestorben am 29. od. 30.7.1108 in Melun. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 239. |  Magnus von Sachsen (Billunger) Magnus von Sachsen (Billunger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_(Sachsen) Magnus heiratete Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) in 1070/1071. Sophia (Tochter von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) gestorben am 18 Jun 1095. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 241. |  Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_(Kärnten) Familie/Ehepartner: Uta von Passau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 242. | Prinzessin Judith von Böhmen Judith heiratete Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) in cir 1080. Władysław (Sohn von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew) wurde geboren in 1043; gestorben am 4 Jun 1102 in Płock. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 243. |  Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vladislav_I. (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 244. | Judith von Böhmen Notizen: Judith und Wiprecht hatten mindestens eine Tochter und zwei Söhne. Judith heiratete Markgraf Wiprecht II. von Groitzsch, der Ältere in cir 1085. Wiprecht (Sohn von Gaugraf Wiprecht I. vom Balsamgau (von Groitzsch) und Sigena von Leinungen) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 22 Mai 1124 in Kloster St. Jacob in Pegau; wurde beigesetzt in Kirche St. Laurentius, Pegau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 245. | Ita von Lothringen (Matfriede) Notizen: Jüngeres Haus von Lothringen, spätere Habsburger. Familie/Ehepartner: Graf Radbot (Habsburger). Radbot (Sohn von Graf Lanzelin (Landolt) (Habsburger) und Gräfin Liutgard von Nellenburg (von Thurgau)) wurde geboren in cir 985; gestorben in 1045; wurde beigesetzt in Klosterkirche Muri. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 246. | Graf Gerhard II. im Elsass (Matfriede) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Matfriede Familie/Ehepartner: Gisela von Oberlothringen ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 247. |  Herzogin Mathilde von Schwaben Herzogin Mathilde von Schwaben Notizen: Mathilde hatte mit ihrem ersten Gatten, Konrad I. zwei Söhne und eine Tochter. Familie/Ehepartner: Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier). Konrad (Sohn von Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier) und Herzogin Judith von Kärnten) gestorben in 1011. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Herzog Friedrich II. von Oberlothringen (von Bar) in zw 1011 und 1015. Friedrich (Sohn von Herzog Dietrich von Oberlothringen (von Bar) und Gräfin Richilde (Richwara) von Lunéville?) wurde geboren in cir 995; gestorben in 1026. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Esico von Ballenstedt (Askanier). Esico (Sohn von Vogt Adalbert von Ballenstedt und Hidda von der sächsischen Ostmark) wurde geboren in ca 990 / 1000; gestorben in cir 1060. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 248. |  Kaiserin Gisela von Schwaben Kaiserin Gisela von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gisela_von_Schwaben Gisela heiratete Kaiser Konrad II. (Salier) in zw 1016 und 1017. Konrad (Sohn von Graf Heinrich von Speyer (Salier) und Gräfin Adelheid von Metz) wurde geboren in cir 990; gestorben am 4 Jun 1039; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
Gisela heiratete Brun I. von Braunschweig in cir 1002. Brun wurde geboren in 96o-980; gestorben in cir 1014. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzog Ernst I. von Schwaben (Babenberger). Ernst (Sohn von Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte und Richenza (Richarda, Richwarda, Rikchard) von Sualafeldgau (Ernste)) wurde geboren in vor 994; gestorben am 31 Mai 1015. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 249. | Beatrix (Brigitta) von Schwaben Familie/Ehepartner: Markgraf Adalbert I. (Adalbero) von Eppenstein (von Kärnten). Adalbert (Sohn von Markgraf Markwart III. von Eppenstein und Hadamut (Hadamuod) von Ebersberg) wurde geboren in cir 980; gestorben am 28 Nov 1039 in Ebersberg, Bayern, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 250. |  Kaiser Konrad II. (Salier) Kaiser Konrad II. (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(HRR) Konrad heiratete Kaiserin Gisela von Schwaben in zw 1016 und 1017. Gisela (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren am 11 Nov 989; gestorben am 15 Feb 1043. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 251. | Konrad II. von Kärnten, der Jüngere Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(Kärnten) |
| 252. | von Kärnten (Salier) ? Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen. Heinrich (Sohn von Pfalzgraf Hermann I. von Lothringen und Gräfin Heylwig von Dillingen) gestorben am 20 Nov 1033; wurde beigesetzt in Brauweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 253. |  Adelheid von Brauweiler Adelheid von Brauweiler Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Gottschalk von Zutphen (von Twente). Gottschalk (Sohn von Hermann von Nifterlake) gestorben in cir 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 254. |  Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) Notizen: Genannt Odnowiciel (= der Erzerneuerer) Kasimir heiratete Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew in 1043. Dobronega gestorben in 1087. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 255. | Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen Notizen: 1052 urkundlich bezeugt. Richenza heiratete König Béla I. von Ungarn (Árpáden) in zw 1039 und 1042. Béla (Sohn von Fürst Vazul (Wasul) von Ungarn (Árpáden) und Anastasia N.) wurde geboren in zw 1015 und 1020; gestorben in 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 256. | Prinzessin Gertrud von Polen Gertrud heiratete Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) in 1043. Isjaslaw (Sohn von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden) wurde geboren in 1024; gestorben am 3 Okt 1078; wurde beigesetzt in Kiew. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 257. |  Graf Rainald I. von Nevers (Monceaux) Graf Rainald I. von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_I._(Nevers) (Jul 2023) Rainald heiratete Prinzessin Adele (Hadwig) von Frankreich in 1028. Adele (Tochter von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in cir 1003; gestorben in 5 Jun nach 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 258. |  Graf Gottfried I. von der Provence Graf Gottfried I. von der Provence Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_I._(Provence) (Apr 2018) Familie/Ehepartner: Stefanie (Dulcia) von Marseille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 259. | Notizen: Wilhelm heiratete Stephanie von Vienne (von Longwy?) in zw 1049 und 1057. Stephanie gestorben in nach 1088. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 260. |  Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_VIII._(Aquitanien) (Okt 2017) Wilhelm heiratete Anna von Périgord in cir 1044, und geschieden in 1058. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Mathilde de La Marche. [Familienblatt] [Familientafel]
Wilhelm heiratete Hildegard von Burgund am 1068 / 1069. Hildegard (Tochter von Herzog Robert I. von Burgund (Kapetinger), der Alte und Ermengarde von Anjou) gestorben in cir 1120. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 261. |  Herzog Peter Wilhelm VII. von Poitou (Ramnulfiden) Herzog Peter Wilhelm VII. von Poitou (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/William_VII,_Duke_of_Aquitaine Peter heiratete Gräfin Ermensind von Longwy in cir 1045. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 262. |  Gräfin Agnes von Poitou Gräfin Agnes von Poitou Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Poitou Agnes heiratete Kaiser Heinrich III. (Salier) am 21 Nov 1043. Heinrich (Sohn von Kaiser Konrad II. (Salier) und Kaiserin Gisela von Schwaben) wurde geboren am 28 Okt 1017; gestorben am 5 Okt 1056 in Bodfeld im Harz; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 263. |  Alix (Adelheid, Adèle) von Roucy Alix (Adelheid, Adèle) von Roucy Familie/Ehepartner: Graf Hilduin IV. von Ramerupt (Montdidier). Hilduin (Sohn von Herr Hilduin III. von Ramerupt (Montdidier) und Lessaline von Dammartin) gestorben in 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 264. |  Graf Heszelin II. (Heinrich) von Grand-Pré Graf Heszelin II. (Heinrich) von Grand-Pré Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Irmtrud von Grandson. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 265. |  Heribert IV. von Vermandois Heribert IV. von Vermandois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_IV._(Vermandois) Heribert heiratete Adele von Valois in vor 1068. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 266. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_of_Rheinfelden Rudolf heiratete Prinzessin Mathilde von Deutschland (von Weiblingen) in 1059. Mathilde wurde geboren in 1045; gestorben am 12 Mai 1060 in Goslar. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzogin Adelheid von Turin (von Maurienne). Adelheid (Tochter von Graf Otto von Savoyen (von Maurienne) und Markgräfin Adelheid (Arduine) von Susa (von Turin)) gestorben in 1079. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 267. |  Graf Bernhard II. von Werl Graf Bernhard II. von Werl Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_II._(Werl) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 268. |  Graf Hermann III. von Werl Graf Hermann III. von Werl Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Hermann III. von Werl Familie/Ehepartner: Herzogin Richenza von Schwaben ?. Richenza wurde geboren in cir 1025; gestorben in vor 1083. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 269. | Ida von Werl (von Hövel) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Lauffen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 270. |  Beatrix von Oberlothringen (von Bar) Beatrix von Oberlothringen (von Bar) Notizen: Beatrix hatte mit Bonifatius IV. drei Kinder. Beatrix heiratete Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige in 1054. Gottfried (Sohn von Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse und Ermengarde von Lothringen) gestorben am 21/30 Dez 1069 in Verdun, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] Beatrix heiratete Bonifatius IV. von Canossa in cir 1037. Bonifatius (Sohn von Theobald von Canossa) wurde geboren in cir 985; gestorben am 6 Mai 1052 in San Martino dell’Argine. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 271. |  Gräfin Sophie von Oberlothringen (von Bar) Gräfin Sophie von Oberlothringen (von Bar) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_(Bar) Sophie heiratete Graf Ludwig von Mousson-Scarponnois in cir 1038. Ludwig (Sohn von Graf Richwin (Ricuin) von Scarponna und Gräfin Hildegard von Egisheim) gestorben in zw 1073 und 1076; wurde beigesetzt in Bar (Priorat Notre-Dame). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 272. |  Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier) Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_II._(Ballenstedt) Familie/Ehepartner: Adelheid von Weimar-Orlamünde. Adelheid (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben am 28 Mrz 1100; wurde beigesetzt in Springiersbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 273. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(HRR) Heinrich heiratete Gräfin Agnes von Poitou am 21 Nov 1043. Agnes (Tochter von Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse und Gräfin Agnes von Burgund) wurde geboren in cir 1025; gestorben am 13 Dez 1077. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 274. | Mathilde von Franken (Salier) Notizen: Heinrich I. und Mathilde waren einander versprochen. Zur Heirat kam es nicht, da Mathilde früh verstarb. Familie/Ehepartner: Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger). Heinrich (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in 1008; gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 275. | Liudolf von Braunschweig (von Friesland) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Friesland) Familie/Ehepartner: Gertrud von Braunschweig, die Ältere . Gertrud (Tochter von Graf Dietrich III. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger), der Jerusalemer und Othelendis von Sachsen) gestorben am 21 Jul 1077. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 276. |  Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Markwart_IV. Familie/Ehepartner: Liutberge von Plain. Liutberge (Tochter von Liutold von Plain) gestorben in vor 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 277. |  Willibirg von Eppenstein (von Kärnten) Willibirg von Eppenstein (von Kärnten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eppensteiner Familie/Ehepartner: Markgraf Ottokar I. von Steiermark. Ottokar (Sohn von Otakar V. Oci (Traungauer) und Willibirg von Wels-Lambach) gestorben in cir 29 Mrz 1075 in Rom, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 278. |  Agnes von Blois Agnes von Blois Notizen: Es besteht keine Gewissheit ob Agnes tatsächlich die Tochter von Odo II. ist. Familie/Ehepartner: Gottfried II. von Anjou, Martel (der Hammer) . Gottfried (Sohn von Graf Fulko III. von Anjou und Hildegard von Sundgau ?) wurde geboren am 14. Oktober 1006/1007; gestorben am 14 Nov 1060. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 279. |  Theobald III. von Blois Theobald III. von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_I._(Champagne) Theobald heiratete Gersende (Garsende) von Maine (Zweites Haus) in cir 1044, und geschieden in 1048. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Gundrade (Gondrée) N.. [Familienblatt] [Familientafel]
Theobald heiratete Adélaide von Valois (von Vexin) in vor 1061. Adélaide (Tochter von Rudolf III. (IV.) von Valois (von Vexin) und Adele von Bar-sur-Aube) gestorben am 12 Mai 1193/1200. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 280. |  Stephan II. von Blois (von Champagne) Stephan II. von Blois (von Champagne) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_II._(Champagne) |
| 281. |  Bertha von Blois Bertha von Blois Bertha heiratete Hugo IV. von Maine (Zweites Haus) in 1046. Hugo (Sohn von Graf Herbert I. von Maine (Zweites Haus)) wurde geboren in 1018; gestorben am 26 Mrz 1051. [Familienblatt] [Familientafel]
Bertha heiratete Alain III. von der Bretagne in 1018. Alain (Sohn von Herzog Gottfried I. von der Bretagne und Hawise (Havoise) von der Normandie) wurde geboren in 997; gestorben am 1 Okt 1040. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 282. |  Graf Heinrich II. von Löwen Graf Heinrich II. von Löwen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Löwen) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Adelheid von Betuwe. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 283. |  Graf Eustach II. von Boulogne Graf Eustach II. von Boulogne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eustach_II._(Boulogne) Familie/Ehepartner: Guda (Goda, Godgifu) von England. Guda (Tochter von König Æthelred II. von England und Emma (Imma, Elgiva) von der Normandie) wurde geboren in 1004; gestorben in cir 1047. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Ida von Lothringen (Boulogne). Ida (Tochter von Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige und Oda (Doda)) wurde geboren in cir 1040 in Bouillon; gestorben am 13 Apr 1113. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 284. |  Bischof Gottfried von Boulogne Bischof Gottfried von Boulogne Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 285. |  Lambert von Lens (von Boulogne) Lambert von Lens (von Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lambert_von_Lens Familie/Ehepartner: Adelheid von der Normandie (Rolloniden). Adelheid (Tochter von Herzog Robert I. von der Normandie (Rolloniden), der Teufel und Herleva (Arlette) de Crey) wurde geboren in 1030; gestorben in 1082. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 286. |  Gerberga von Boulogne Gerberga von Boulogne Familie/Ehepartner: Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen). Friedrich (Sohn von Graf Friedrich von Luxemburg und Gräfin Irmtrud (Irmintrud) in der Wetterau) wurde geboren in cir 1005; gestorben am 28 Aug 1065. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 287. |  Adela von Brabant (Löwen) Adela von Brabant (Löwen) Notizen: Adela hatte mit Otto I. drei Töchter. Familie/Ehepartner: Otto I. von Weimar-Orlamünde. Otto (Sohn von Wilhelm III. von Weimar und Oda von Lausitz) gestorben in 1067. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Dedo I. von Wettin (von Lausitz). Dedo (Sohn von Graf Dietrich I. von Wettin (von Lausitz) und Mathilde von Meissen) wurde geboren in cir 1010; gestorben in Okt 1075. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 288. |  Graf Albert III. von Namur Graf Albert III. von Namur Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_III,_Count_of_Namur Albert heiratete Herzogin Ida von Sachsen? in cir 1065. Ida (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) wurde geboren in cir 1035; gestorben am 31 Jul 1102. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 289. | Graf Heinrich von Namur |
| 290. |  Hedwig von Namur Hedwig von Namur Familie/Ehepartner: Herzog Gerhard von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois). Gerhard (Sohn von Graf Gerhard II. im Elsass (Matfriede) und Gisela von Oberlothringen ?) wurde geboren in cir 1030; gestorben in 06 Mär od 14 Apr 1070 in Remiremont; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Pierre de Remiremont. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 291. |  Graf Giselbert von Loon Graf Giselbert von Loon Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Erlende de Jodoigne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 292. |  Graf Hugo II. von Ponthieu Graf Hugo II. von Ponthieu Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_II._(Ponthieu) Hugo heiratete Bertha von Aumale in cir 1035. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 293. |  Graf Wilhelm I. von Nevers (Monceaux) Graf Wilhelm I. von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Nevers) Familie/Ehepartner: Ermengarde von Tonnerre. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 294. |  Robert von Nevers (Monceaux) Robert von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_I._de_Craon (Jul 2023) Robert heiratete Avoie (Avoise) von Maine in Datum unbekannt. Avoie (Tochter von Geoffroy von Maine) gestorben in vor 1070. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 295. | 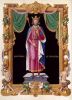 Philipp I. von Frankreich (Kapetinger) Philipp I. von Frankreich (Kapetinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_I._(Frankreich) Familie/Ehepartner: Bertha von Holland. Bertha (Tochter von Graf Florens I. von Holland (Gerulfinger) und Gertrude Billung (von Sachsen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben am 15 Okt 1094 in Montreuil-sur-Mer. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Königin Bertrada von Montfort. Bertrada wurde geboren in cir 1060; gestorben am 1115 od 1116 in Abtei Hautes-Bruyères, Saint-Rémy-l’Honoré. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 296. |  Hugo von Vermandois (von Frankreich) Hugo von Vermandois (von Frankreich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Vermandois Hugo heiratete Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger) in 1078. Adelheid (Tochter von Heribert IV. von Vermandois und Adele von Valois) wurde geboren in 1065; gestorben am 28 Sep 1120/1124. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 297. |  Balduin VI. von Flandern, der Gute Balduin VI. von Flandern, der Gute Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_VI._(Flandern) Balduin heiratete Gräfin Richhilde von Hennegau in 1051. Richhilde gestorben am 15 Mrz 1087 in Mesen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 298. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_von_Flandern Mathilde heiratete König Wilhelm I. von England (von der Normandie), der Eroberer in 1053. Wilhelm (Sohn von Herzog Robert I. von der Normandie (Rolloniden), der Teufel und Herleva (Arlette) de Crey) wurde geboren in zw 1027 und 1028; gestorben am 9 Sep 1087 in Rouen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 299. |  Graf Robert I. von Flandern, der Friese Graf Robert I. von Flandern, der Friese Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_I._(Flandern) Robert heiratete Gertrude Billung (von Sachsen) in 1063. Gertrude (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) gestorben in zw 1089 und 1093. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 300. |  Heinrich von Burgund (Kapetinger) Heinrich von Burgund (Kapetinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Bourgogne_(1035-1066) (Mai 2018) Familie/Ehepartner: Sibylla von Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 301. |  Konstanze von Burgund (Kapetinger) Konstanze von Burgund (Kapetinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanze_von_Burgund Familie/Ehepartner: Hugo II. von Chalon-sur-Saône. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: König Alfons VI. von León (von Kastilien). Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von León, der Große und Sancha von León) wurde geboren in 1037; gestorben am 1 Jul 1109 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Abtei Santos Facundo y Primitivo (später San Benito) in Sahagún. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 302. |  Robert von Burgund (Kapetinger) Robert von Burgund (Kapetinger) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Sibylle von Sizilien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 303. | Hildegard von Burgund Hildegard heiratete Wilhelm VIII. (Guido Gottfried) von Poitou (von Burgund, von Aquitanien) (Ramnulfiden) am 1068 / 1069. Wilhelm (Sohn von Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse und Gräfin Agnes von Burgund) wurde geboren in cir 1025; gestorben am 25 Sep 1086. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 304. | Graf Walram II. von Arlon Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_II._(Arlon) Familie/Ehepartner: Judith von Niederlothringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 305. | Fulco von Arlon Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 306. | Herzog Berthold von Rheinfelden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Rheinfelden |
| 307. | Adelheid von Rheinfelden (von Schwaben) Notizen: Adelheid und Ladislaus I. sollen drei Töchter gehabt haben. Familie/Ehepartner: Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige . Ladislaus (Sohn von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) wurde geboren in 1048 in Polen; gestorben am 29 Jul 1095 in Neutra. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 308. |  Herzogin Agnes von Rheinfelden Herzogin Agnes von Rheinfelden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Rheinfelden Agnes heiratete Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen in 1079. Berthold (Sohn von Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige und Gräfin Richwara (von Lothringen) ?) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 12 Apr 1111. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 309. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Stein_(Rheinfelden) Familie/Ehepartner: Graf Ulrich X. von Bregenz. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich von Bregenz) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 27 Okt 1097; wurde beigesetzt in Mehrerau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 310. | Otto von Rheinfelden (von Schwaben) Notizen: Gestorben: |
| 311. | Bruno von Rheinfelden (von Schwaben) |
| 312. |  Simon de Vergy Simon de Vergy Familie/Ehepartner: Elisabeth ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 313. |  Graf Eberhard II. (VI.) von Nellenburg (Eberhardinger) Graf Eberhard II. (VI.) von Nellenburg (Eberhardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Eberhard heiratete Ita von Kirchberg in Datum unbekannt. Ita wurde geboren in 1015; gestorben am 26 Feb 1106. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 314. |  Herzog Otto III. von Schweinfurt (von Schwaben), der Weisse Herzog Otto III. von Schweinfurt (von Schwaben), der Weisse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_III,_Duke_of_Swabia Otto heiratete Prinzessin Mathilde von Polen in 1035 (Verlobt / Engaged / Fiancés). [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Irmgard (Arduine) von Turin (von Susa) in 1036. Irmgard (Tochter von Markgraf Olderich (Odelricus dictus Mainfredus) von Turin (Arduine) und Markgräfin Berta von Este) gestorben am 21 Jan 1078. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 315. |  Markgräfin Eilika von Schweinfurt Markgräfin Eilika von Schweinfurt Notizen: https://en.wikipedia.org/wiki/Eilika_of_Schweinfurt Eilika heiratete Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) in cir 1020. Bernhard (Sohn von Herzog Bernhard I. von Sachsen (Billunger) und Gräfin Hildegard von Stade) wurde geboren in cir 1000; gestorben am 29 Mai 1059. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 316. |  Herzogin Judith von Schweinfurt Herzogin Judith von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Judith und Břetislav I. hatten fünf Söhne. Judith heiratete Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) in zw 1021 und 1029 in Olmütz. Břetislav (Sohn von Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden) und Božena (Beatrice)) gestorben am 10 Jan 1055 in Chrudim; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prag. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 317. |  Heinrich II. von Luxemburg (IV. von Bayern) Heinrich II. von Luxemburg (IV. von Bayern) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VII._(Bayern) |
| 318. |  Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen) Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._von_Luxemburg Familie/Ehepartner: Gerberga von Boulogne. Gerberga (Tochter von Eustach I. von Boulogne und Mathilde von Löwen (Hennegau)) gestorben in cir 1049. [Familienblatt] [Familientafel]
Friedrich heiratete Herzogin Ida von Sachsen? in cir 1055. Ida (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) wurde geboren in cir 1035; gestorben am 31 Jul 1102. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 319. |  Graf Giselbert von Salm (von Luxemburg) Graf Giselbert von Salm (von Luxemburg) Notizen: Sein Bruder Heinrich wurde Herzog von Bayern; ein anderer Bruder, Adalbert, Bischof von Metz. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 320. |  Imiza (Irmtrud) von Luxemburg (von Gleiberg) Imiza (Irmtrud) von Luxemburg (von Gleiberg) Familie/Ehepartner: Welf II. von Altdorf (Welfen). Welf (Sohn von Graf Konrad I. (Welfen) und Gräfin Adelheid (Aelis) von Tours) gestorben am 10 Mrz 1030. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 321. |  Otgiva von Luxemburg Otgiva von Luxemburg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otgiva_von_Luxemburg Otgiva heiratete Graf Balduin IV. von Flandern in cir 1012. Balduin (Sohn von Markgraf Arnulf II. von Flandern, der Jüngere und Prinzessin Rozala Susanna von Italien) wurde geboren in cir 980; gestorben am 30 Mai 1035 in Gent. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 322. | Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herr Liudolf (Ludolf) von Brauweiler (von Lothringen) (Ezzonen). Liudolf (Sohn von Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und Prinzessin Mathilde von Deutschland) gestorben am 11 Apr 1031. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 323. |  Herzog Gottfried IV. von Niederlothringen, der Bucklige Herzog Gottfried IV. von Niederlothringen, der Bucklige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_IV,_Duke_of_Lower_Lorraine Familie/Ehepartner: Markgräfin Mathilde von Tuszien. Mathilde (Tochter von Bonifatius IV. von Canossa und Beatrix von Oberlothringen (von Bar)) wurde geboren in cir 1046; gestorben am 24 Jul 1115 in Bondeno di Roncore; wurde beigesetzt in Kloster San Benedetto di Polirone in San Benedetto Po. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 324. |  Ida von Lothringen (Boulogne) Ida von Lothringen (Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_of_Lorraine Familie/Ehepartner: Graf Eustach II. von Boulogne. Eustach (Sohn von Eustach I. von Boulogne und Mathilde von Löwen (Hennegau)) wurde geboren in cir 1020; gestorben in cir 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 325. |  Wiltrud von Niederlothringen Wiltrud von Niederlothringen Notizen: Herzogtum Lothringen: Familie/Ehepartner: Graf Adalbert II. von Calw. Adalbert (Sohn von Graf Adalbert I. von Calw und Adelheid ? von Egisheim) gestorben in 1099. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 326. | Markgräfin Mathilde von Lambach (von Pitten) Notizen: Markgräfin der kärntischen Mark, 1094 urkundlich bezeugt. Mathilde heiratete Graf Eckbert I. von Formbach (im Quinziggau) in cir 1065. Eckbert (Sohn von Bruno von Formbach (im Quinziggau)) gestorben in am 24. August ? 1109. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 327. | Markgraf Ottokar I. von Steiermark Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ottokar_I._(Steiermark) Familie/Ehepartner: Willibirg von Eppenstein (von Kärnten). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 328. |  Graf Poppo IV. von Henneberg Graf Poppo IV. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Irmgard von Stade (Udonen). Irmgard (Tochter von Lothar-Udo III. von Stade (der Nordmark) (Udonen) und Irmgard von Plötzkau) gestorben in 1178. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 329. |  Burggraf Bertold I. von Henneberg Burggraf Bertold I. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Henneberg Familie/Ehepartner: Bertha von Putelendorf (von Goseck). Bertha (Tochter von Pfalzgraf Friedrich IV. von Goseck und Agnes von Limburg) gestorben am 2 Jul 1190; wurde beigesetzt in Kloster Trostadt, Thüringen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 330. |  Bischof Gebhard von Würzburg Bischof Gebhard von Würzburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat ais: https://de.wikipedia.org/wiki/Gebhard_von_Henneberg |
| 331. |  Bischof Günther von Würzburg Bischof Günther von Würzburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Günther_von_Henneberg |
| 332. |  Hildegard von Henneberg Hildegard von Henneberg Familie/Ehepartner: Heinrich II. von Katzenelnbogen. Heinrich wurde geboren in vor 1124; gestorben in zw 1160 und 1168. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 333. |  Bischof Otto von Würzburg Bischof Otto von Würzburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Henneberg |
| 334. |  Markgraf Albrecht I. von Brandenburg (von Ballenstedt) (Askanier), der Bär Markgraf Albrecht I. von Brandenburg (von Ballenstedt) (Askanier), der Bär Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Brandenburg) Albrecht heiratete Markgräfin Sophie von Winzenburg in 1125. Sophie (Tochter von Graf Hermann I. von Winzenburg (von Formbach) und Hedwig von Krain-Istrien) wurde geboren in 1105 in Winzenburg, Hannover; gestorben in 06 / 07 Jul 1160 in Mark (Kurfürstentum) Brandenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 335. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sizzo_III._(Schwarzburg-Käfernburg) Sizzo heiratete Gisela von Berg in cir 1120. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 336. |  Adda von Kevernburg (Käfernburg) Adda von Kevernburg (Käfernburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Reginboto von Giech. Reginboto gestorben in vor 1142. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 337. | Graf Konrad II. von Luxemburg (von Gleiberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(Luxemburg) |
| 338. |  Graf Wilhelm von Gleiberg Graf Wilhelm von Gleiberg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Gleiberg#Grafen_von_Gleiberg Familie/Ehepartner: Salomone (Salome) von Isenburg (von Giessen). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 339. | Luitgard von Luxemburg (von Gleiberg) |
| 340. |  Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Andechs) Bertold heiratete Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Hedwig (Tochter von Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) und Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe) gestorben am 16 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Luccardis (Liutgarde) von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 341. | Otto VI. von Andechs (von Diessen) |
| 342. | Familie/Ehepartner: Graf Diepold von Berg-Schelklingen. Diepold (Sohn von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) gestorben in spätestens 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 343. |  Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto I. der Rotkopf (* um 1117 wohl in Kelheim; † 11. Juli 1183 in Pfullendorf) aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war der Sohn des Pfalzgrafen Otto V. von Scheyern († 1156) und dessen Frau Heilika von Lengenfeld. Er war 1156 als Otto VI. Pfalzgraf von Bayern und von 1180 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Mit seinem Aufstieg zum Herzog begann die Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern, die erst im Jahre 1918 endete. Otto heiratete Agnes von Loon und Rieneck in 1169 in Kelheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 344. |  Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach Hedwig heiratete Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Bertold (Sohn von Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen) und Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar)) wurde geboren in 1110/1115; gestorben am 14 Dez 1188; wurde beigesetzt in Kloster Diessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 345. | Leopold I. von Steiermark, der Tapfere, der Starke |
| 346. |  Markgräfin Wilibirg von Steiermark Markgräfin Wilibirg von Steiermark Familie/Ehepartner: Graf Eckbert II. von Formbach von Pütten (Pitten). Eckbert (Sohn von Graf Eckbert I. von Formbach (im Quinziggau) und Markgräfin Mathilde von Lambach (von Pitten)) gestorben in 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 347. | Kunigunde von Steiermark |
| 348. |  Adalbert von Österreich (Babenberger), der Andächtige Adalbert von Österreich (Babenberger), der Andächtige Notizen: Adalbert soll eine erste Frau gehabt haben. Familie/Ehepartner: Hedvig (Sophia) von Ungarn (von Kroatien). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 349. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Österreich) (Okt 2017) Heinrich heiratete Gertrud (Gertraud) von Sachsen (von Süpplingenburg) am 1 Mai 1142. Gertrud (Tochter von Kaiser Lothar III. von Sachsen (von Süpplingenburg) und Kaiserin Richenza von Northeim) wurde geboren am 18 Apr 1115; gestorben am 18 Apr 1143; wurde beigesetzt in Grablege der Babenberger im Kapitelsaal des Stiftes Heiligenkreuz. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen) in Dez 1149. Theodora (Tochter von Prinz Andronikos Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Irene (Eirene) Aineiadissa) wurde geboren in cir 1134 in Konstantinopel; gestorben am 2 Jan 1184 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 350. |  Agnes von Österreich (Babenberger) Agnes von Österreich (Babenberger) Notizen: Agnes hatte mit Władysław eine Tochter und drei Söhne. Agnes heiratete Władysław von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Vertriebene in cir 1126. Władysław (Sohn von Herzog Boleslaw III. von Polen (Piasten), Schiefmund und Prinzessin Zbysława von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1105 in Krakau, Polen; gestorben am 30 Mai 1159 in Altenburg, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 351. |  Judith von Österreich (Babenberger) Judith von Österreich (Babenberger) Notizen: Judith hatte mit Wilhelm V. mind. acht Kinder. Familie/Ehepartner: Markgraf Wilhelm V. von Montferrat (Aleramiden). Wilhelm (Sohn von Markgraf Rainer von Montferrat (Aleramiden) und Gisela von Burgund) gestorben in 1191. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 352. |  Gertrud von Österreich (Babenberger) Gertrud von Österreich (Babenberger) Gertrud heiratete Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) in 1140. Vladislav (Sohn von Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?)) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 18 Jan 1174 in Meerane. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 353. |  Graf Heinrich III. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Graf Heinrich III. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 354. |  Graf Sieghard XI. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Graf Sieghard XI. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 355. |  König Konrad III. von Italien (Salier) König Konrad III. von Italien (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_(III.)_(HRR) |
| 356. |  Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen) Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen) Notizen: Gestorben als die letzte Salierin. Familie/Ehepartner: Herzog Friedrich I. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren). Friedrich (Sohn von Friedrich von Büren und Hildegard von Egisheim (von Schlettstadt)) wurde geboren in 1050; gestorben am 20 Jan 1105; wurde beigesetzt in Kloster Lorch. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Leopold III. von Österreich (Babenberger), der Heilige in 1106. Leopold (Sohn von Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne und Ida (Itha) von Österreich) wurde geboren in 1073 in Gars am Kamp (oder Melk); gestorben am 15 Nov 1136 in Klosterneuburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 357. |  König Heinrich V. (Salier) König Heinrich V. (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(HRR) Heinrich heiratete Kaiserin Matilda von England in 1114. Matilda (Tochter von König Heinrich I. (Henry Beauclerc) von England und Königin Matilda (Edith) von England (von Schottland)) wurde geboren am 7 Feb 1102; gestorben am 10 Sep 1167 in Rouen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 358. | Adelajda (Adelheid) von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelajda_von_Polen Adelajda heiratete Diepold III. von Vohburg in vor 1118. Diepold (Sohn von Diepold II. von Vohburg (von Giengen) und Liutgard von Zähringen) wurde geboren in 1075; gestorben am 8 Apr 1146. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 359. |  Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Markgraf Hermann II. von Baden (* um 1060; † 7. Oktober 1130) begründete erstmals den Titel Markgraf von Baden durch die Titulierung nach dem neuen Herrschaftszentrum auf Burg Hohenbaden (Altes Schloss) in der heutigen Stadt Baden-Baden. Hermann heiratete Judith von Backnang (Hessonen) in cir 1111. Judith (Tochter von Hesso II. von Backnang (Hessonen), der Jüngere und Judith) wurde geboren in cir 1080; gestorben in cir 1123 in Backnang, Baden-Württemberg, DE ; wurde beigesetzt in Grablege im Augustiner-Chorherrenstift in Backnang. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 360. | Luitgard von Breisgau |
| 361. |  Graf Rudolf II. von Zähringen Graf Rudolf II. von Zähringen |
| 362. |  Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Zähringen) Familie/Ehepartner: Sofie von Bayern (Welfen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 363. |  Herzog Konrad I. von Zähringen Herzog Konrad I. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_I,_Duke_of_Z%C3%A4hringen Konrad heiratete Clementia von Namur in cir 1130. Clementia (Tochter von Gottfried von Namur und Ermensinde von Luxemburg) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 28 Dez 1158; wurde beigesetzt in St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 364. |  Agnes von Zähringen Agnes von Zähringen |
| 365. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen |
| 366. |  Petrissa von Zähringen Petrissa von Zähringen Petrissa heiratete Graf Friedrich I. von Bar-Mümpelgard (von Pfirt) in 1111. Friedrich (Sohn von Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois und Gräfin Ermentrud von Burgund) gestorben in Aug 1160. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 367. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Familie/Ehepartner: Gottfried II. von Calw. Gottfried (Sohn von Graf Adalbert II. von Calw und Wiltrud von Niederlothringen) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 6 Feb 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 368. |  Judith von Zähringen Judith von Zähringen Familie/Ehepartner: Graf Ulrich II. von Gammertingen (Gammertinger). Ulrich (Sohn von Graf Ulrich I. von Gammertingen (Gammertinger) und Adelheid von Kyburg (von Dillingen)) gestorben am 18 Sep 1150 in Kloster Zwiefalten, Zwiefalten, Reutlingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Judith heiratete Egino von Zollern-Urach in Datum unbekannt. Egino (Sohn von Graf Friedrich I. von Zollern und Udilhild von Urach) wurde geboren in cir 1098; gestorben in nach 1134. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 369. |  Diepold III. von Vohburg Diepold III. von Vohburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Diepold III. von Vohburg Diepold heiratete Adelajda (Adelheid) von Polen in vor 1118. Adelajda (Tochter von Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) und Judith (Salier)) wurde geboren in 1090/91; gestorben in 1127. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Kunigunde von Beichlingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Sophia von Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 370. |  Konrad von Württemberg (von Giengen) Konrad von Württemberg (von Giengen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Giengen_an_der_Brenz Familie/Ehepartner: Hedwig von Spitzenberg-Sigmatingen ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Werntrud. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 371. |  Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?). Heinrich (Sohn von Graf Poppo von Berg (Schelklingen?)) gestorben am 11 Dez 1127?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 372. | Ludwig II. von Sigmaringen (von Spitzenberg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 373. |  Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Andechs) Bertold heiratete Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Hedwig (Tochter von Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) und Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe) gestorben am 16 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Luccardis (Liutgarde) von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 374. | Otto VI. von Andechs (von Diessen) |
| 375. | Familie/Ehepartner: Graf Diepold von Berg-Schelklingen. Diepold (Sohn von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) gestorben in spätestens 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 376. | Mathilde von Andechs (von Diessen) |
| 377. | Euphemia von Andechs (von Diessen) |
| 378. | Kunigunde von Andechs (von Diessen) |
| 379. | Graf Engelbert von Wasserburg (Andechs) Familie/Ehepartner: Hedwig von Formbach. Hedwig gestorben in 1170. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adeleid N.. Adeleid gestorben in 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 380. | Ida von Chiny Notizen: Es ist nicht klar welche der zwei Gattinen des Otto II.die Mutter von Ida ist. Ida heiratete Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige in cir 1105. Gottfried (Sohn von Graf Heinrich II. von Löwen und Adelheid von Betuwe) wurde geboren in cir 1063; gestorben am 25 Jan 1139; wurde beigesetzt in Affligem. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 381. |  Albert von Namur Albert von Namur |
| 382. |  Clementia von Namur Clementia von Namur Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Namur Clementia heiratete Herzog Konrad I. von Zähringen in cir 1130. Konrad (Sohn von Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen und Herzogin Agnes von Rheinfelden) wurde geboren in cir 1090; gestorben am 8 Jan 1152 in Konstanz, Baden, DE; wurde beigesetzt in Kloster Sankt Peter. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 383. |  Graf Heinrich IV. von Luxemburg (von Namur), der Blinde Graf Heinrich IV. von Luxemburg (von Namur), der Blinde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV,_Count_of_Luxembourg Heinrich heiratete Laurette von Elsass (von Flandern) in 1157, und geschieden in 1163. Laurette (Tochter von Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) und Swanhild) gestorben in 1170. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Agnes von Geldern in 1171. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 384. |  Alice von Namur Alice von Namur Alice heiratete Graf Balduin IV. von Hennegau in 1130. Balduin (Sohn von Graf Balduin III. von Hennegau und Jolante von Wasserberg) wurde geboren in 1088; gestorben in 1120. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 385. |  Beatrix von Namur Beatrix von Namur Familie/Ehepartner: Graf Günther (Gonthier, Withier) von Rethel (Haus de Vitri). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 386. |  Graf Balduin VII. von Flandern (von Jerusalem), mit dem Beil Graf Balduin VII. von Flandern (von Jerusalem), mit dem Beil Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_VII._(Flandern) Balduin heiratete Havise (Hedwig) von der Bretagne in 1105. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 387. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Wurde 1884 von der westlichen Kirche heiliggesprochen. Karl heiratete Margarete von Clermont in vor 1117. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 388. | Ingegerd (Ingegärd) Knutsdotter von Dänemark Ingegerd heiratete Folke, der Dicke in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 389. |  Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Elsass Familie/Ehepartner: Swanhild. [Familienblatt] [Familientafel]
Dietrich heiratete Sibylle von Anjou-Château-Landon in 1134. Sibylle (Tochter von Graf Fulko V. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) und Gräfin Erembuge de La Flèche) wurde geboren in cir 1112; gestorben in 1165 in Bethanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 390. |  Graf Florens II. von Holland (Gerulfinger), der Dicke Graf Florens II. von Holland (Gerulfinger), der Dicke Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Florens_II._(Holland) Florens heiratete Petronilla (Gertrud) von Oberlothringen (Billunger) in cir 1110. Petronilla (Tochter von Herzog Dietrich II. von Oberlothringen (Haus Châtenois) und Gräfin Hedwig von Formbach) wurde geboren in 1082; gestorben am 23 Mai 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 391. | Konstanze von Frankreich Notizen: Auf seiner Reise durch Europa gewann Bohemund I. 1106 die Hand von Konstanze, der Tochter des französischen Königs Philipp I. Familie/Ehepartner: Fürst Bohemund I. von Antiochia. Bohemund (Sohn von Herzog Robert Guiskard und Alberada von Buonalbergo) wurde geboren in 1051/52; gestorben am 7 Mrz 1111. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 392. |  König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VI._(Frankreich) (Okt 2017) Ludwig heiratete Lucienne von Rochefort (Montlhéry) in 1104, und geschieden in 1107. Lucienne (Tochter von Graf Guido von Rochefort (Montlhéry) und Herrin Adélais (Adélaide, Adelheid) von Crécy) wurde geboren in cir 1090; gestorben am 6.5.1137 oder später. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Marie de Breuillet. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Königin Adelheid von Maurienne (Savoyen) in 1115. Adelheid (Tochter von Humbert II. von Maurienne (Savoyen), der Dicke und Gisela von Burgund) wurde geboren in cir 1092; gestorben am 18 Nov 1154 in Kloster Montmartre, Paris, Frankreich; wurde beigesetzt in Abteikirche St-Pierre de Montmartre, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 393. | Notizen: Wulfhild hatte mit Heinrich IX. sieben Kinder. Wulfhild heiratete Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze in zw 1095 und 1100. Heinrich (Sohn von Herzog Welf IV. von Bayern (Welfen) und Judith (Jutka) von Flandern) wurde geboren in 1075; gestorben am 13 Dez 1126 in Ravensburg, Oberschwaben, DE; wurde beigesetzt in Kloster Weingarten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 394. |  Gräfin Eilika von Sachsen Gräfin Eilika von Sachsen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eilika_(Sachsen) Familie/Ehepartner: Graf Otto von Ballenstedt (Askanier), der Reiche . Otto (Sohn von Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier) und Adelheid von Weimar-Orlamünde) wurde geboren in cir 1070; gestorben am 9 Feb 1123; wurde beigesetzt in Benediktinerkloster St. Pancratius und Abundus. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 395. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._von_Schwarzenburg |
| 396. | Notizen: Name: Familie/Ehepartner: aus der Steiermark. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 397. |  Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 398. |  Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._(Kärnten) (Mai 2020) Familie/Ehepartner: Judith von Baden (von Verona). Judith (Tochter von Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) und Judith von Backnang (Hessonen)) gestorben in 1162. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 399. |  Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten) Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Spanheim) Familie/Ehepartner: Mathilde von Sulzbach. Mathilde (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)) gestorben in 1165. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 400. |  Ida (Adelheid) von Spanheim (von Kärnten) Ida (Adelheid) von Spanheim (von Kärnten) Familie/Ehepartner: Graf Wilhelm III. von Nevers (Monceaux). Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm II. von Nevers (Monceaux) und Adelheid N.) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 21 Nov 1161; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Germain, Auxerre. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 401. |  Graf Rapoto I. von Ortenburg Graf Rapoto I. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ortenburg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Sulzbach. Elisabeth (Tochter von Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach und Mathilde von Bayern (Welfen)) gestorben am 23 Jan 1206; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 402. |  Gräfin Mathilde von Spanheim (von Kärnten) Gräfin Mathilde von Spanheim (von Kärnten) Notizen: Mathilde hatte mit Theobald II. elf Kinder. Mathilde heiratete Graf Theobald II. (IV.) (Diebold) von Champagne (Blois) in 1123. Theobald (Sohn von Stephan II. (Heinrich) von Blois und Adela von England (von der Normandie)) wurde geboren in 1093; gestorben am 10 Jan 1152. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 403. |  Herzog Boleslaw III. von Polen (Piasten), Schiefmund Herzog Boleslaw III. von Polen (Piasten), Schiefmund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bolesław_III._Schiefmund Familie/Ehepartner: Prinzessin Zbysława von Kiew (Rurikiden). Zbysława (Tochter von Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in zw 1085 und 1090; gestorben in zw 1112 und 1114. [Familienblatt] [Familientafel]
Boleslaw heiratete Gräfin Salome von Berg (Schelklingen?) in 1115. Salome (Tochter von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) wurde geboren in 1093 in Ehingen, Donau; gestorben am 27 Jul 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 404. |  Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II. (Okt 2017) Vladislav heiratete Gertrud von Österreich (Babenberger) in 1140. Gertrud (Tochter von Leopold III. von Österreich (Babenberger), der Heilige und Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen)) wurde geboren in cir 1120; gestorben am 8 Apr 1150. [Familienblatt] [Familientafel]
Vladislav heiratete Judith von Thüringen in 1153. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 405. |  Bertha von Groitzsch (von Morungen) Bertha von Groitzsch (von Morungen) Notizen: Erbin der Wiprechtsburg Groitzsch Familie/Ehepartner: Graf Dedo IV. von Wettin. Dedo (Sohn von Thimo von Wettin und Ida von Northeim) gestorben am 16 Dez 1124. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 406. | Wiprecht III. von Groitzsch, der Jüngere Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiprecht_III._von_Groitzsch Familie/Ehepartner: Kunigunde von Northeim (von Beichlingen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 407. |  Graf Werner I. (II.) (Habsburger) Graf Werner I. (II.) (Habsburger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_I._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Gräfin Reginlinde von Baden (von Nellenburg?). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 408. |  Richenza (Habsburger) Richenza (Habsburger) Familie/Ehepartner: Graf Ulrich II. von Lenzburg-Baden. Ulrich (Sohn von Ulrich I. von Schänis (von Lenzburg), der Reiche ) gestorben in 1081. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 409. |  Herzog Gerhard von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois) Herzog Gerhard von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_(Lothringen) Familie/Ehepartner: Hedwig von Namur. Hedwig (Tochter von Graf Albert II. von Namur und Herzogin Reginlinde von Niederlothringen) gestorben am 28 Jan 1075/1080. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 410. | Konrad II. von Kärnten, der Jüngere Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(Kärnten) |
| 411. | von Kärnten (Salier) ? Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen. Heinrich (Sohn von Pfalzgraf Hermann I. von Lothringen und Gräfin Heylwig von Dillingen) gestorben am 20 Nov 1033; wurde beigesetzt in Brauweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 412. |  Beatrix von Oberlothringen (von Bar) Beatrix von Oberlothringen (von Bar) Notizen: Beatrix hatte mit Bonifatius IV. drei Kinder. Beatrix heiratete Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige in 1054. Gottfried (Sohn von Herzog Gozelo I. von Niederlothringen (von Verdun), der Grosse und Ermengarde von Lothringen) gestorben am 21/30 Dez 1069 in Verdun, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] Beatrix heiratete Bonifatius IV. von Canossa in cir 1037. Bonifatius (Sohn von Theobald von Canossa) wurde geboren in cir 985; gestorben am 6 Mai 1052 in San Martino dell’Argine. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 413. |  Gräfin Sophie von Oberlothringen (von Bar) Gräfin Sophie von Oberlothringen (von Bar) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_(Bar) Sophie heiratete Graf Ludwig von Mousson-Scarponnois in cir 1038. Ludwig (Sohn von Graf Richwin (Ricuin) von Scarponna und Gräfin Hildegard von Egisheim) gestorben in zw 1073 und 1076; wurde beigesetzt in Bar (Priorat Notre-Dame). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 414. |  Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier) Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_II._(Ballenstedt) Familie/Ehepartner: Adelheid von Weimar-Orlamünde. Adelheid (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben am 28 Mrz 1100; wurde beigesetzt in Springiersbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 415. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(HRR) Heinrich heiratete Gräfin Agnes von Poitou am 21 Nov 1043. Agnes (Tochter von Herzog Wilhelm V. von Poitou (Ramnulfiden), der Grosse und Gräfin Agnes von Burgund) wurde geboren in cir 1025; gestorben am 13 Dez 1077. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 416. | Mathilde von Franken (Salier) Notizen: Heinrich I. und Mathilde waren einander versprochen. Zur Heirat kam es nicht, da Mathilde früh verstarb. Familie/Ehepartner: Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger). Heinrich (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in 1008; gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 417. | Liudolf von Braunschweig (von Friesland) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Friesland) Familie/Ehepartner: Gertrud von Braunschweig, die Ältere . Gertrud (Tochter von Graf Dietrich III. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger), der Jerusalemer und Othelendis von Sachsen) gestorben am 21 Jul 1077. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 418. |  Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Markwart_IV. Familie/Ehepartner: Liutberge von Plain. Liutberge (Tochter von Liutold von Plain) gestorben in vor 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 419. |  Willibirg von Eppenstein (von Kärnten) Willibirg von Eppenstein (von Kärnten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eppensteiner Familie/Ehepartner: Markgraf Ottokar I. von Steiermark. Ottokar (Sohn von Otakar V. Oci (Traungauer) und Willibirg von Wels-Lambach) gestorben in cir 29 Mrz 1075 in Rom, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 420. |  Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Lothringen Familie/Ehepartner: Mathilde von Niederlothringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 421. |  Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige . Berchtold (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)) wurde geboren in cir 1000; gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 422. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Zutphen Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Judith von Arnstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 423. |  Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Władysław_I._Herman Władysław heiratete Prinzessin Judith von Böhmen in cir 1080. Judith (Tochter von König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) und Prinzessin Adelheid von Ungarn (Árpáden)) wurde geboren in cir 1057; gestorben am 25 Dez 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
Władysław heiratete Judith (Salier) in 1088. Judith (Tochter von Kaiser Heinrich III. (Salier) und Gräfin Agnes von Poitou) wurde geboren in 1054 in Goslar; gestorben in an einem 14 Mär zw 1092 und 1096. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 424. | 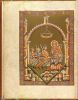 Königin Swatawa von Polen Königin Swatawa von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Swatawa war die erste böhmische Königin. Swatawa heiratete König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) in 1062. Vratislaw (Sohn von Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Herzogin Judith von Schweinfurt) wurde geboren in 1035; gestorben am 14 Jan 1092. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 425. |  König Géza I. (Geisa) von Ungarn (Árpáden) König Géza I. (Geisa) von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Géza_I. Familie/Ehepartner: Sophie von Looz. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Synadena Synadenos (von Byzanz). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 426. |  Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_von_Ungarn Sophia heiratete Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) in zw 1062 und 1063. Ulrich (Sohn von Poppo I. von Weimar (von Istrien) und Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul) gestorben am 5 Mrz 1070. [Familienblatt] [Familientafel]
Sophia heiratete Magnus von Sachsen (Billunger) in 1070/1071. Magnus (Sohn von Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) und Wulfhild von Norwegen) wurde geboren in cir 1045; gestorben am 23 Aug 1106 in Ertheneburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 427. |  Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Im Jahre 1192 wurde Ladislaus von Papst Coelestin III. heiliggesprochen, Patrozinium ist am 27. Juni. Familie/Ehepartner: Gisela N.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Rheinfelden (von Schwaben). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 428. |  Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden) Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Swjatopolk_II._(Kiew) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 429. | 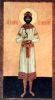 Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jaropolk_Isjaslawitsch Familie/Ehepartner: Kunigunde von Weimar-Orlamünde. Kunigunde (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben in nach 20.3.1117. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 430. |  Graf Wilhelm I. von Nevers (Monceaux) Graf Wilhelm I. von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Nevers) Familie/Ehepartner: Ermengarde von Tonnerre. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 431. |  Robert von Nevers (Monceaux) Robert von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_I._de_Craon (Jul 2023) Robert heiratete Avoie (Avoise) von Maine in Datum unbekannt. Avoie (Tochter von Geoffroy von Maine) gestorben in vor 1070. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 432. |  Markgraf Bertrand II. von der Provence Markgraf Bertrand II. von der Provence Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bertrand_II._(Provence) Bertrand heiratete Mathilde N. in Feb 1061. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 433. |  Gräfin Gerberga von der Provence Gräfin Gerberga von der Provence Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gerberga und Gilbert hatten zwei Töchter. Gerberga heiratete Graf Gilbert von Gévaudan in 1073. Gilbert wurde geboren in cir 1055; gestorben in 1107. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 434. |  von der Provence von der Provence Notizen: Geburt: heiratete Graf Raimund IV. von Toulouse (Raimundiner) in cir 1066, und geschieden in 1076. Raimund (Sohn von Graf Pons von Toulouse (Raimundiner) und Almodis de la Marche) wurde geboren in 1041/1042 in Toulouse; gestorben am 28 Feb 1105 in Burg Mons Peregrinus, Tripolis. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 435. |  Odo (Eudes) von Burgund Odo (Eudes) von Burgund |
| 436. |  Graf Rainald II. von Burgund Graf Rainald II. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_II._(Burgund) Familie/Ehepartner: Regina von Oltigen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 437. |  Wilhelm von Burgund Wilhelm von Burgund |
| 438. |  Graf Stephan I. von Burgund, Tollkopf Graf Stephan I. von Burgund, Tollkopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_I._(Mâcon) Familie/Ehepartner: Beatrix von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 439. |  Graf Raimund von Burgund Graf Raimund von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raimund_von_Burgund (Okt 2017) Raimund heiratete Königin Urraca Alfónsez von León in 1091. Urraca (Tochter von König Alfons VI. von León (von Kastilien) und Konstanze von Burgund (Kapetinger)) wurde geboren in cir 1080; gestorben am 8 Mrz 1126 in Saldaña, Provinz Palencia; wurde beigesetzt in Abtei San Isidoro in León. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 440. |  Hugo von Burgund Hugo von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 441. |  Papst Kalixt II. Guido von Burgund Papst Kalixt II. Guido von Burgund |
| 442. |  Stephanie (Étiennette) von Burgund Stephanie (Étiennette) von Burgund Familie/Ehepartner: Lambert François de Royans. Lambert gestorben in nach 1119. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 443. |  Sibylle von Burgund Sibylle von Burgund Sibylle heiratete Herzog Odo I. von Burgund, Borel in 1080. Odo (Sohn von Heinrich von Burgund (Kapetinger) und Sibylla von Barcelona) wurde geboren in cir 1058; gestorben in 1102 in Tarsos. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 444. |  Gräfin Ermentrud von Burgund Gräfin Ermentrud von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stifterin von Froidefontaine; Schwester von Papst Kalixst II. Ermentrud heiratete Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois in cir 1076. Dietrich (Sohn von Graf Ludwig von Mousson-Scarponnois und Gräfin Sophie von Oberlothringen (von Bar)) wurde geboren in cir 1045; gestorben am 2 Jan 1105; wurde beigesetzt in Kathedrale von Autun. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 445. |  Gisela von Burgund Gisela von Burgund Familie/Ehepartner: Humbert II. von Maurienne (Savoyen), der Dicke . Humbert (Sohn von Graf Amadeus II. von Savoyen (Maurienne) und Johanna von Genf) wurde geboren in cir 1060 in Carignano; gestorben am 14 Okt 1103 in Moûtiers; wurde beigesetzt in Cathédrale Saint-Pierre de Moûtiers. [Familienblatt] [Familientafel]
Gisela heiratete Markgraf Rainer von Montferrat (Aleramiden) in cir 1105. Rainer (Sohn von Markgraf Wilhelm IV. von Montferrat (Aleramiden) und Otta d'Agliè) wurde geboren in 1084; gestorben in cir 1136. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 446. |  Klementina (Clémence) von Burgund Klementina (Clémence) von Burgund Familie/Ehepartner: Graf Robert II. von Flandern (von Jerusalem). Robert (Sohn von Graf Robert I. von Flandern, der Friese und Gertrude Billung (von Sachsen)) wurde geboren in 1065; gestorben am 5 Okt 1111 in Meaux, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
Klementina heiratete Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige in cir 1125. Gottfried (Sohn von Graf Heinrich II. von Löwen und Adelheid von Betuwe) wurde geboren in cir 1063; gestorben am 25 Jan 1139; wurde beigesetzt in Affligem. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 447. | Bertha (Burgund oder Tuskien) Notizen: Im Bericht über Ihren Gatten, Alfons VI., soll sie aus Tuskien stammen. Bertha heiratete König Alfons VI. von León (von Kastilien) in 1094. Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von León, der Große und Sancha von León) wurde geboren in 1037; gestorben am 1 Jul 1109 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Abtei Santos Facundo y Primitivo (später San Benito) in Sahagún. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 448. |  Agnes von Aquitanien (von Poitou) Agnes von Aquitanien (von Poitou) Agnes heiratete König Alfons VI. von León (von Kastilien) in 1069, und geschieden in vor 1079. Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von León, der Große und Sancha von León) wurde geboren in 1037; gestorben am 1 Jul 1109 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Abtei Santos Facundo y Primitivo (später San Benito) in Sahagún. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 449. |  Herzog Wilhelm VII. (IX.) Aquitanien Aquitanien (von Poitou) Herzog Wilhelm VII. (IX.) Aquitanien Aquitanien (von Poitou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_IX._(Aquitanien) (Okt 2017) Wilhelm heiratete Emengarde von Anjou-Château-Landon in 1089, und geschieden in 1092. Emengarde (Tochter von Graf Fulko IV. von Anjou-Château-Landon und Hildegarde de Beaugency) wurde geboren in 1068; gestorben am 1 Jun 1146 in Jerusalem; wurde beigesetzt in Abtei Redon. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Gräfin Philippa von Toulouse (Raimundiner). Philippa (Tochter von Graf Wilhelm IV. von Toulouse (Raimundiner) und Emma von Mortain) wurde geboren in cir 1073; gestorben am 28 Nov 1118 in Abbaye Fontevrault. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 450. |  Hugo von Poitou (Burgund, Aquitanien) Hugo von Poitou (Burgund, Aquitanien) |
| 451. |  Agnes von Poitou (von Burgund) (von Aquitanien) Agnes von Poitou (von Burgund) (von Aquitanien) Agnes heiratete Peter I. von Aragón (Jiménez) in Jan 1086 in Jaca. Peter (Sohn von Sancho I. (Ramírez) von Aragón (von Navarra) (Jiménez) und Isabella von Urgell) wurde geboren in cir 1068; gestorben am 27./28. September 1104; wurde beigesetzt in Kloster San Juan de la Peña. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 452. |  Beatrix von León (von Poitou?) Beatrix von León (von Poitou?) Notizen: Geburt: Beatrix heiratete König Alfons VI. von León (von Kastilien) in 1108. Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von León, der Große und Sancha von León) wurde geboren in 1037; gestorben am 1 Jul 1109 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Abtei Santos Facundo y Primitivo (später San Benito) in Sahagún. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 453. |  Clementia von Poitou (Poitiers) Clementia von Poitou (Poitiers) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Clementia_of_Aquitaine Familie/Ehepartner: Graf Konrad I. von Luxemburg. Konrad (Sohn von Graf Giselbert von Salm (von Luxemburg)) wurde geboren in cir 1040; gestorben am 8 Aug 1086 in Königreich Italien; wurde beigesetzt in Lützelburg (Kloster Münster). [Familienblatt] [Familientafel]
Clementia heiratete Graf Gerhard III. von Geldern (von Wassenberg) Flamenses in nach 1086. Gerhard (Sohn von Dietrich I. (Flamenses) Hennegau) wurde geboren in cir 1068; gestorben am 16 Okt 1129. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 454. |  Prinzessin Agnes von Poitou (Ramnulfiden) Prinzessin Agnes von Poitou (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_de_Poitiers_(1052-1089) Agnes heiratete König Ramiro I. von Aragón (von Navarra) (Haus Jiménez) in cir 1054. Ramiro (Sohn von König Sancho III. von Navarra (Jiménez), der Große und Sancha von Aybar) wurde geboren in cir 1000; gestorben am 8 Mai 1063 in Graus; wurde beigesetzt in Abtei San Juan de la Peña. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Graf Peter I. von Savoyen (von Maurienne). Peter (Sohn von Graf Otto von Savoyen (von Maurienne) und Markgräfin Adelheid (Arduine) von Susa (von Turin)) wurde geboren in cir 1048; gestorben in 1078. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 455. |  Kaiser Heinrich IV. (Salier) Kaiser Heinrich IV. (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(HRR) Heinrich heiratete Gräfin Berta von Savoyen (von Maurienne) am 13 Jul 1066 in Würzburg und Tribur. Berta (Tochter von Graf Otto von Savoyen (von Maurienne) und Markgräfin Adelheid (Arduine) von Susa (von Turin)) wurde geboren am 21 Sep 1051; gestorben am 27 Dez 1087. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Adelheid (Jewspraksija, Praxedis) von Kiew am 14 Aug 1089, und geschieden in 1095. Adelheid (Tochter von Wsewolod I. Jaroslawitsch von Kiew (Rurikiden) und Anna von Polowzen) wurde geboren in 1067/1070; gestorben am 20 Jul 1109 in Kiew. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 456. | Judith (Salier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Judith und Salomon hatten eine Tochter. Judith heiratete König Salomon von Ungarn (Árpáden) in zw 1063 und 1066. Salomon (Sohn von König Andreas I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Anastasia von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1053; gestorben in 1087. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) in 1088. Władysław (Sohn von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew) wurde geboren in 1043; gestorben am 4 Jun 1102 in Płock. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 457. |  Herr Andreas von Ramerupt (Montdidier) Herr Andreas von Ramerupt (Montdidier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Montdidier Familie/Ehepartner: Adèle. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Guisemode. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 458. |  Ebles II. (Ebal) von Roucy (Montdidier) Ebles II. (Ebal) von Roucy (Montdidier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ebles_II._(Roucy) Ebles heiratete Sibylle von Hauteville (von Apulien) in vor 1082. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 459. |  Béatrice (Beatrix) von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Béatrice (Beatrix) von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Béatrice heiratete Graf Gottfried (Geoffrey) II. von Le Perche (von Nogent) in Datum unbekannt. Gottfried (Sohn von Graf Rotrou II. von Nogent (Mortagne und Châteaudun)) gestorben in Okt 1100. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 460. |  Margarete (Marguerite) von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Margarete (Marguerite) von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Familie/Ehepartner: Graf Hugo I. (Hugues) von Clermont (von Creil). Hugo (Sohn von Rainald I. (Renaud) von Creil (Clermont) und Ermengarde von Clermont) wurde geboren in 1035; gestorben in 1101. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 461. |  Adelheid von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Adelheid von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Familie/Ehepartner: Falko (Kuno) von Grandson. Falko (Sohn von Adalbert von Grandson) gestorben in 1114. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 462. |  Felicia von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Felicia von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier) Familie/Ehepartner: Sancho I. (Ramírez) von Aragón (von Navarra) (Jiménez). Sancho (Sohn von König Ramiro I. von Aragón (von Navarra) (Haus Jiménez) und Gilberga (Ermensinde) von Foix (von Carcassonne)) wurde geboren in 1045/46; gestorben am 4 Jun 1094 in vor Huesca; wurde beigesetzt in Mönchsburg Montearagón, dann Abtei San Juan de la Peña. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 463. |  Alis (Adelheid) von Grand-Pré Alis (Adelheid) von Grand-Pré Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Gottfried von Durbuy. Gottfried gestorben in spätestens 1124. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Gottfried von Esch. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 464. |  Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger) Adelheid (Adélaide) von Valois (von Vermandois) (Karolinger) Adelheid heiratete Hugo von Vermandois (von Frankreich) in 1078. Hugo (Sohn von Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) und Anna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1057; gestorben am 18 Okt 1101. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Rainald II. von Clermont. Rainald (Sohn von Graf Hugo I. (Hugues) von Clermont (von Creil) und Margarete (Marguerite) von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier)) wurde geboren in 1070; gestorben in vor 1162. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 465. | Herzog Berthold von Rheinfelden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Rheinfelden |
| 466. | Adelheid von Rheinfelden (von Schwaben) Notizen: Adelheid und Ladislaus I. sollen drei Töchter gehabt haben. Familie/Ehepartner: Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige . Ladislaus (Sohn von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) wurde geboren in 1048 in Polen; gestorben am 29 Jul 1095 in Neutra. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 467. |  Herzogin Agnes von Rheinfelden Herzogin Agnes von Rheinfelden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Rheinfelden Agnes heiratete Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen in 1079. Berthold (Sohn von Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige und Gräfin Richwara (von Lothringen) ?) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 12 Apr 1111. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 468. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Stein_(Rheinfelden) Familie/Ehepartner: Graf Ulrich X. von Bregenz. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich von Bregenz) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 27 Okt 1097; wurde beigesetzt in Mehrerau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 469. | Otto von Rheinfelden (von Schwaben) Notizen: Gestorben: |
| 470. | Bruno von Rheinfelden (von Schwaben) |
| 471. |  Graf Konrad II. von Werl-Arnsberg Graf Konrad II. von Werl-Arnsberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Konrad II. Konrad heiratete Mechthild (Mathilde) in cir 1070. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 472. |  Oda von Werl Oda von Werl Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Lothar Udo II. von Stade (der Nordmark) (Udonen). Lothar (Sohn von Graf Lothar Udo I. von Stade (der Nordmark) (Udonen) und Gräfin Adelheid von Oeningen) wurde geboren in nach 994; gestorben am 7 Nov 1082. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 473. |  Adelheid von Lauffen Adelheid von Lauffen Notizen: Adelheid von Lauffen Adelheid heiratete Graf Adolf I. von Berg in frühestens 1090. Adolf wurde geboren in cir 1045; gestorben am 31 Jul 1106. [Familienblatt] [Familientafel]
Adelheid heiratete Pfalzgraf Friedrich I. von Sommerschenburg in nach 1106. Friedrich gestorben in 1120. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 474. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_of_Tuscany Familie/Ehepartner: Herzog Gottfried IV. von Niederlothringen, der Bucklige . Gottfried (Sohn von Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige und Oda (Doda)) wurde geboren in cir 1040; gestorben am 27 Feb 1076 in Vlaardingen. [Familienblatt] [Familientafel] Mathilde heiratete Welf V. von Bayern (Welfen) in cir 1089. Welf (Sohn von Herzog Welf IV. von Bayern (Welfen) und Judith (Jutka) von Flandern) wurde geboren in cir 1073; gestorben am 24 Sep 1120 in Burg Kaufering; wurde beigesetzt in Weingarten, Ravensburg, Oberschwaben, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 475. |  Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Mousson Dietrich heiratete Gräfin Ermentrud von Burgund in cir 1076. Ermentrud (Tochter von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) wurde geboren in cir 1060. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 476. |  Sophie von Pfirt (von Mousson-Scarponnois) Sophie von Pfirt (von Mousson-Scarponnois) Familie/Ehepartner: Volmar I. von Froburg (Frohburg). Volmar (Sohn von Graf Adalbero) wurde geboren in 1050; gestorben in 1114. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 477. | Gräfin Beatrix von Mousson (Bar-Mümpelgard) Familie/Ehepartner: Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige . Berchtold (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)) wurde geboren in cir 1000; gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 478. |  Graf Otto von Ballenstedt (Askanier), der Reiche Graf Otto von Ballenstedt (Askanier), der Reiche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_(Ballenstedt) Familie/Ehepartner: Gräfin Eilika von Sachsen. Eilika (Tochter von Magnus von Sachsen (Billunger) und Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden)) wurde geboren in cir 1081; gestorben am 16 Jan 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 479. | Ekbert I. von Meissen (von Braunschweig)(Brunonen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ekbert_I._(Meißen) Familie/Ehepartner: Irmgard (Arduine) von Turin (von Susa). Irmgard (Tochter von Markgraf Olderich (Odelricus dictus Mainfredus) von Turin (Arduine) und Markgräfin Berta von Este) gestorben am 21 Jan 1078. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 480. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_von_Friesland Mathilde heiratete Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) in cir 1034. Heinrich (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in 1008; gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 481. |  Gräfin Hedwig von Eppenstein Gräfin Hedwig von Eppenstein Notizen: ACHTUNG |
| 482. |  Herzog Heinrich III. von Kärnten (von Eppenstein) Herzog Heinrich III. von Kärnten (von Eppenstein) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Kärnten) Heinrich heiratete Beatrix in cir 1075. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Liutgard in nach 1096. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Sophie von Österreich (Babenberger) in nach 1103. Sophie (Tochter von Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne und Ida (Itha) von Österreich) gestorben am 2 Mai 1154. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 483. | Adalbero von Steiermark Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 484. |  Markgraf Ottokar II. von Steiermark Markgraf Ottokar II. von Steiermark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Reformierte Garsten;1082-1122 urkundlich bezeugt. Familie/Ehepartner: Markgräfin Elisabeth von Österreich (Babenberger). Elisabeth (Tochter von Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne und Ida (Itha) von Österreich) gestorben in an einem 10 Okt zw 1107 und 1111. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 485. |  Stephan II. (Heinrich) von Blois Stephan II. (Heinrich) von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_II._(Blois) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Adela von England (von der Normandie). Adela (Tochter von König Wilhelm I. von England (von der Normandie), der Eroberer und Gräfin Mathilde von Flandern) wurde geboren in 1062; gestorben in 1138. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 486. |  Herbert II. von Maine (Zweites Haus) Herbert II. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_II._(Maine) |
| 487. |  Herzog Conan II. von der Bretagne Herzog Conan II. von der Bretagne Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 488. |  Havise (Hawisa) von der Bretagne Havise (Hawisa) von der Bretagne Anderer Ereignisse und Attribute:
Havise heiratete Graf Hoël II. (V.) von Cornouaille in 1066. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 489. |  Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_VI._(Niederlothringen) Gottfried heiratete Ida von Chiny in cir 1105. [Familienblatt] [Familientafel]
Gottfried heiratete Klementina (Clémence) von Burgund in cir 1125. Klementina (Tochter von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) gestorben in cir 1133. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 490. |  Heinrich III. von Löwen Heinrich III. von Löwen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Löwen) Familie/Ehepartner: Gertrude von Flandern. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 491. |  Ida von Löwen Ida von Löwen Notizen: Ida hatte mit Balduin II. neun Kinder, drei Töchter und sechs Söhne. Ida heiratete Balduin II. von Hennegau in 1084. Balduin (Sohn von Balduin VI. von Flandern, der Gute und Gräfin Richhilde von Hennegau) wurde geboren in cir 1056; gestorben in 1098 in Bithynien bei Nicäa. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 492. |  Graf Eustach III. von Boulogne Graf Eustach III. von Boulogne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Marie von Schottland. Marie (Tochter von König Malcolm III. von Schottland, Langhals und Margareta von Schottland) gestorben in 1116. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 493. |  Graf Balduin I. von Jerusalem (von Boulogne) Graf Balduin I. von Jerusalem (von Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_I._(Jerusalem) Familie/Ehepartner: Godehilde von Tosny. Godehilde (Tochter von Raoul II. von Tosny und Élisabeth (Isabelle) von Montfort) gestorben in 1097. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Oriante von Melitene. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 494. |  Gottfried von Bouillon (Boulogne) Gottfried von Bouillon (Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_of_Bouillon |
| 495. |  Ida von Boulogne Ida von Boulogne Ida heiratete Graf Conon (Cuno, Kuno) von Montaigu in Datum unbekannt. Conon (Sohn von Graf Gozelo I. (Gozelon) von Montaigu und Ermentrud von Grandpré (?)) gestorben am 1 Mai 1106. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 496. |  Judith von Lens (von Boulogne) Judith von Lens (von Boulogne) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Lens Judith heiratete Waltheof II. von Northumbria in 1070. Waltheof (Sohn von Siward von Northumbria und Ælfflæd von Bernicia) wurde geboren in 1050; gestorben am 31 Mai 1076. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 497. |  Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen) Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Limburg Familie/Ehepartner: Graf Walram II. (Udo) von Arlon. Walram wurde geboren in cir 998/1000; gestorben in vor 1082. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 498. |  Adelheid von Weimar-Orlamünde Adelheid von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Weimar-Orlamünde Familie/Ehepartner: Graf Adalbert II. von Ballenstedt (Askanier). Adalbert (Sohn von Esico von Ballenstedt (Askanier) und Herzogin Mathilde von Schwaben) wurde geboren in cir 1030; gestorben in 1080. [Familienblatt] [Familientafel]
Adelheid heiratete Pfalzgraf Hermann II. von Lothringen in cir 1080. Hermann (Sohn von Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende und Mathilde von Niederlothringen) wurde geboren in cir 1049; gestorben am 20 Sep 1085 in Dalhem. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Heinrich II. von Laach (Gleiberg-Luxemburg). Heinrich wurde geboren in cir 1050; gestorben am 23 Okt 1095 in Burg Laach; wurde beigesetzt in Abtei Maria Laach. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 499. | Oda von Weimar-Orlamünde Familie/Ehepartner: Ekbert II. von Meissen (von Braunschweig)(Brunonen). Ekbert (Sohn von Ekbert I. von Meissen (von Braunschweig)(Brunonen) und Irmgard (Arduine) von Turin (von Susa)) wurde geboren in cir 1059/1061; gestorben in 3.Jul 1090 in Selketal, Harz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 500. |  Kunigunde von Weimar-Orlamünde Kunigunde von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Kunigunde hatte mit Kuno mindestens vier Kinder. Familie/Ehepartner: Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow. Jaropolk (Sohn von Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) und Prinzessin Gertrud von Polen) wurde geboren in vor 1050; gestorben in 22 Nov 1086 od 1087 in Swenigorod; wurde beigesetzt in Dmitrij-Kloster in der St. Petri-Kirche, Kiew. [Familienblatt] [Familientafel]
Kunigunde heiratete Graf Kuno von Northeim (von Beichlingen) in 1088. Kuno (Sohn von Otto von Northeim und Herzogin Richenza von Schwaben ?) wurde geboren in 1050/1060; gestorben in 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgraf Wiprecht II. von Groitzsch, der Ältere . Wiprecht (Sohn von Gaugraf Wiprecht I. vom Balsamgau (von Groitzsch) und Sigena von Leinungen) wurde geboren in cir 1050; gestorben am 22 Mai 1124 in Kloster St. Jacob in Pegau; wurde beigesetzt in Kirche St. Laurentius, Pegau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 501. |  Heinrich I. von Wettin (von Lausitz) Heinrich I. von Wettin (von Lausitz) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Meißen) Familie/Ehepartner: Gertrud von Braunschweig, die Jüngere . Gertrud (Tochter von Ekbert I. von Meissen (von Braunschweig)(Brunonen) und Irmgard (Arduine) von Turin (von Susa)) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 9 Dez 1117 in Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 502. |  Konrad von Wettin (von Lausitz) Konrad von Wettin (von Lausitz) Notizen: Gestorben: |
| 503. | Ida von Namur |
| 504. | Alix von Namur Familie/Ehepartner: Otto II. von Chiny. Otto gestorben in Dez 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 505. | Bischof Friedrich von Namur |
| 506. |  Gottfried von Namur Gottfried von Namur Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_I,_Count_of_Namur Gottfried heiratete Sibylla von Château-Porcien in cir 1087, und geschieden in cir 1104. [Familienblatt] [Familientafel] Gottfried heiratete Ermensinde von Luxemburg in nach 1098. Ermensinde (Tochter von Graf Konrad I. von Luxemburg und Clementia von Poitou (Poitiers)) wurde geboren in cir 1075; gestorben am 24 Jun 1143. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 507. | Albert von Namur |
| 508. | Graf Heinrich I. von Namur |
| 509. |  Graf Gerhard I. von Vaudémont (von Lothringen) Graf Gerhard I. von Vaudémont (von Lothringen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_I._(Vaudémont) Gerhard heiratete Gräfin Heilwig (Helwidis Hedwig) von Egisheim in cir 1080 in Priorat Belleval. Heilwig (Tochter von Graf Gerhard II. von Egisheim (Etichonen) und Richarda N.) gestorben in an einem 29 Jan vor 1126; wurde beigesetzt in Belval. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 510. |  Herzog Dietrich II. von Oberlothringen (Haus Châtenois) Herzog Dietrich II. von Oberlothringen (Haus Châtenois) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_II._(Lothringen) Dietrich heiratete Gräfin Hedwig von Formbach in 1075. Hedwig (Tochter von Graf Friedrich von Formbach und Gräfin Gertrud von Haldersleben) wurde geboren in 1057; gestorben in zw 1095 und 1100. [Familienblatt] [Familientafel]
Dietrich heiratete Gertrude von Flandern in 1096. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 511. | Gisela von Oberlothringen (im Elsass) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 512. |  Beatrix von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois) Beatrix von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois) Familie/Ehepartner: Graf Stephan I. von Burgund, Tollkopf . Stephan (Sohn von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) wurde geboren in 1065; gestorben am 18 Mai 1102 in Askalon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 513. |  Graf Emmo von Loon Graf Emmo von Loon Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Suanehild von West-Friesland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 514. |  Graf Enguerrand II. von Ponthieu Graf Enguerrand II. von Ponthieu Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Enguerrand_II._(Ponthieu) Familie/Ehepartner: Adelheid von der Normandie (Rolloniden). Adelheid (Tochter von Herzog Robert I. von der Normandie (Rolloniden), der Teufel und Herleva (Arlette) de Crey) wurde geboren in 1030; gestorben in 1082. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 515. |  Graf Guido I. von Ponthieu Graf Guido I. von Ponthieu Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_I._(Ponthieu) Familie/Ehepartner: Adele. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 516. |  Graf Rainald II. von Nevers (Monceaux) Graf Rainald II. von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Herrscher_von_Nevers Familie/Ehepartner: Agnes de Beaugency. [Familienblatt] [Familientafel]
Rainald heiratete Ida-Raimunde von Forez (Lyon) in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 517. |  Graf Wilhelm von Tonnerre (von Nevers) Graf Wilhelm von Tonnerre (von Nevers) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Tonnerre) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 518. |  Sibylle (Jolanthe) von Monceaux Sibylle (Jolanthe) von Monceaux Familie/Ehepartner: Hugo I. von Burgund. Hugo (Sohn von Heinrich von Burgund (Kapetinger) und Sibylla von Barcelona) wurde geboren in cir 1057; gestorben am 29 Aug 1093 in Cluny. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 519. |  Herr Renaud I. von Craon (Nevers, Monceaux) Herr Renaud I. von Craon (Nevers, Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Renaud heiratete Herrin Enoguen (Agnès) de Vitré in Datum unbekannt. Enoguen (Tochter von Princeps Robert I. de Vitré und Herrin Berthe de Craon (Haus Vitré)) gestorben in nach 1078. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 520. |  Mathilde von Vermandois Mathilde von Vermandois Mathilde heiratete Rudolf (Raoul) I. von Beaugency in 1090. Rudolf wurde geboren in 1067 in Beaugency; gestorben in 1130. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 521. |  Rudolf I. von Vermandois (von Frankreich), der Tapfere, der Einäugige Rudolf I. von Vermandois (von Frankreich), der Tapfere, der Einäugige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Vermandois) Rudolf heiratete Eleonore von Blois in cir 1120. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Aélis (Petronilla) von Aquitanien in cir 1142, und geschieden in ? 1151. Aélis (Tochter von Herzog Wilhelm X. von Aquitanien (von Poitou) und Eleonore von Châtellerault) gestorben in nach 24 Okt 1153. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Laurette von Elsass (von Flandern) in 1152. Laurette (Tochter von Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) und Swanhild) gestorben in 1170. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 522. |  Elisabeth (Isabel) von Vermandois Elisabeth (Isabel) von Vermandois Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Vermandois Elisabeth heiratete Robert I. von Beaumont (von Meulan), 1. Earl of Leicester in 1096. Robert (Sohn von Herr Roger von Beaumont (de Vieilles), der Bärtige und Adeline de Meulan) wurde geboren in zw 1040 und 1050; gestorben am 5 Jun 1118. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf William de Warenne. William (Sohn von Graf William de Warenne und Gundrada (Gundred, Gonrée) von Flandern) gestorben in 1138. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 523. |  Graf Arnulf III. von Flandern Graf Arnulf III. von Flandern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_III._(Flandern) (Aug 2018) |
| 524. |  Balduin II. von Hennegau Balduin II. von Hennegau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_II._(Hennegau) (Okt 2017) Balduin heiratete Ida von Löwen in 1084. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 525. |  Herzog Robert von England (von der Normandie), Kurzhose Herzog Robert von England (von der Normandie), Kurzhose Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Normandie) Familie/Ehepartner: Sybilla von Brindisi. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 526. |  Adela von England (von der Normandie) Adela von England (von der Normandie) Familie/Ehepartner: Stephan II. (Heinrich) von Blois. Stephan (Sohn von Theobald III. von Blois und Gundrade (Gondrée) N.) wurde geboren in cir 1045; gestorben am 19 Mai 1102. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 527. |  Agathe von England (von der Normandie) Agathe von England (von der Normandie) Notizen: Zur Heirat kam es nicht da Agathe als Verlobte Alfonsos auf der Reise von England nach Spanien verstarb. Familie/Ehepartner: König Alfons VI. von León (von Kastilien). Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von León, der Große und Sancha von León) wurde geboren in 1037; gestorben am 1 Jul 1109 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Abtei Santos Facundo y Primitivo (später San Benito) in Sahagún. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 528. |  König Heinrich I. (Henry Beauclerc) von England König Heinrich I. (Henry Beauclerc) von England Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(England) (Sep 2018) Heinrich heiratete Königin Matilda (Edith) von England (von Schottland) in Datum unbekannt. Matilda (Tochter von König Malcolm III. von Schottland, Langhals und Margareta von Schottland) gestorben in 1118. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Adelheid von Löwen am 29 Jan 1121. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Ansfriede. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Edith. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Edith (Sigulfsson). [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Sybil Corbet. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Nest von Deheubarth ferch Rhys. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Isabel von Beaumont. Isabel (Tochter von Robert I. von Beaumont (von Meulan), 1. Earl of Leicester und Elisabeth (Isabel) von Vermandois) wurde geboren in cir 1113; gestorben in nach 1172. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 529. |  Konstanze von England (von der Normandie) Konstanze von England (von der Normandie) Konstanze heiratete Alain IV. von Bretagne (Cornouaille) in 1086. Alain (Sohn von Graf Hoël II. (V.) von Cornouaille und Havise (Hawisa) von der Bretagne) wurde geboren in 1072; gestorben in 1119. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 530. |  Graf Robert II. von Flandern (von Jerusalem) Graf Robert II. von Flandern (von Jerusalem) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Flandern) Familie/Ehepartner: Klementina (Clémence) von Burgund. Klementina (Tochter von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) gestorben in cir 1133. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 531. |  Königin Adela von Flandern Königin Adela von Flandern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adela_von_Flandern Adela heiratete König Knut IV. von Dänemark, der Heilige in 1080 in Odense. Knut (Sohn von König Sven Estridsson von Dänemark und Aussereheliche Beziehungen) wurde geboren in cir 1043; gestorben am 10 Jul 1086 in Odense. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzog Roger Borsa von Apulien. Roger wurde geboren in 1061; gestorben am 22 Feb 1111. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 532. |  Gertrude von Flandern Gertrude von Flandern Familie/Ehepartner: Heinrich III. von Löwen. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich II. von Löwen und Adelheid von Betuwe) wurde geboren in 1060; gestorben in Februar oder März 1095 in Tournai. [Familienblatt] [Familientafel] Gertrude heiratete Herzog Dietrich II. von Oberlothringen (Haus Châtenois) in 1096. Dietrich (Sohn von Herzog Gerhard von Oberlothringen (von Elsass) (Haus Châtenois) und Hedwig von Namur) wurde geboren in vor 1065; gestorben am 23 Jan 1115; wurde beigesetzt in Châtenoi. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 533. | Philipp von Loo |
| 534. | Ogiva von Flandern |
| 535. |  Hugo I. von Burgund Hugo I. von Burgund Notizen: Liste der Herrscher von Burgund: Familie/Ehepartner: Sibylle (Jolanthe) von Monceaux. Sibylle (Tochter von Graf Wilhelm I. von Nevers (Monceaux) und Ermengarde von Tonnerre) wurde geboren in 1058; gestorben in 1078. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 536. |  Herzog Odo I. von Burgund, Borel Herzog Odo I. von Burgund, Borel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Odo_I._(Burgund) (Apr 2018) Odo heiratete Sibylle von Burgund in 1080. Sibylle (Tochter von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) wurde geboren in 1065; gestorben in nach 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 537. | 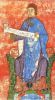 Graf Heinrich von Burgund (von Portugal) Graf Heinrich von Burgund (von Portugal) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Burgund (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Gräfinn von Portugal Teresa Alfónsez von León. Teresa (Tochter von König Alfons VI. von León (von Kastilien) und Jimena Muñoz) gestorben in 1130. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 538. |  Beatrix von Burgund Beatrix von Burgund Familie/Ehepartner: Herr Gui III. von Vignory. Gui (Sohn von Herr Gui II. von Vignory und Hildegarde ?) gestorben in 1125. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 539. |  Königin Urraca Alfónsez von León Königin Urraca Alfónsez von León Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Urraca_(León) (Okt 2017) Urraca heiratete Graf Raimund von Burgund in 1091. Raimund (Sohn von Graf Wilhelm I. von Burgund, der Grosse und Stephanie von Vienne (von Longwy?)) wurde geboren in cir 1080; gestorben in 1107; wurde beigesetzt in Kathedrale, Santiago de Compostela. [Familienblatt] [Familientafel]
Urraca heiratete König Alfons I. von Aragón (Jiménez), der Krieger in 1109, und geschieden in 1112. Alfons (Sohn von Sancho I. (Ramírez) von Aragón (von Navarra) (Jiménez) und Felicia von Ramerupt (von Roucy) (Montdidier)) wurde geboren in 1073; gestorben am 7 Sep 1134 in Abtei San Juan de la Peña. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Pedro González de Lara. Pedro gestorben am 16 Okt 1130 in Bayonne. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 540. | von Arlon Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich I. von Limburg (von Arlon). Heinrich (Sohn von Graf Walram II. (Udo) von Arlon und Jutta (Judith) von Luxemburg (von Niederlothringen)) gestorben in 1119. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 541. | Friedrich von Arlon |
| 542. | Beatrix von Arlon |
| 543. |  Piroska (Eirene) von Ungarn Piroska (Eirene) von Ungarn Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Piroska_von_Ungarn (Jun 2017) Piroska heiratete Johannes II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) in 1104/1105. Johannes (Sohn von Alexios I. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Irene (Eirene) Dukaina) wurde geboren am 13 Sep 1087 in Konstantinopel; gestorben am 8 Apr 1143 in Taurusgebirge. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 544. |  Graf Rudolf von Bregenz und Churrätien Graf Rudolf von Bregenz und Churrätien Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Irmengard von Calw. Irmengard gestorben in spätestens 1128. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Wulfhild von Bayern in cir 1128. Wulfhild (Tochter von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) gestorben in nach 1160. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 545. |  Guy de Vergy Guy de Vergy Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Acre_(1189%E2%80%9391) Familie/Ehepartner: Alix (Adelaïs) de Navilly. Alix (Tochter von Herr Gauthier de Navilly und Mathilde de la Ferté) gestorben in nach 1179. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 546. |  Eberhard III. (VII.) von Nellenburg (Eberhardinger) Eberhard III. (VII.) von Nellenburg (Eberhardinger) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 547. | Berta von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 548. |  Gisela von Schwaben Gisela von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweinfurt_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Arnold von Reichenbeuren (von Diessen). Arnold (Sohn von Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen) und Irmgard von Gilching) wurde beigesetzt in Kloster Benediktbeuren. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 549. | Judith von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 550. | Äbtissin Eilika von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 551. | Beatrix von Schweinfurt (von Schwaben) |
| 552. | Herzogin Ida von Sachsen? Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ida_de_Saxe Ida heiratete Friedrich II. von Luxemburg (von Niederlothringen) in cir 1055. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich von Luxemburg und Gräfin Irmtrud (Irmintrud) in der Wetterau) wurde geboren in cir 1005; gestorben am 28 Aug 1065. [Familienblatt] [Familientafel] Ida heiratete Graf Albert III. von Namur in cir 1065. Albert (Sohn von Graf Albert II. von Namur und Herzogin Reginlinde von Niederlothringen) gestorben am 22 Jun 1102. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 553. | Gertrude Billung (von Sachsen) Notizen: Gertrude und Florens I. hatten acht Kinder, davon vier Söhne, zwei Töchter und zwei unbekannt. Gertrude heiratete Graf Robert I. von Flandern, der Friese in 1063. Robert (Sohn von Balduin V. von Flandern, der Fromme und Adela von Frankreich, die Heilige ) wurde geboren in cir 1033; gestorben in zw 12 und 13 Okt 1093. [Familienblatt] [Familientafel]
Gertrude heiratete Graf Florens I. von Holland (Gerulfinger) in 1050. Florens (Sohn von Graf Dietrich III. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger), der Jerusalemer und Othelendis von Sachsen) wurde geboren in cir 1020; gestorben am 18 Jun 1061. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 554. |  Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ordulf_(Sachsen) Familie/Ehepartner: Wulfhild von Norwegen. Wulfhild (Tochter von König Olav II. Haraldsson von Norwegen und Astrid von Schweden) gestorben am 24 Mai 1071. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 555. | Hadwig (Hedwig) von Sachsen Notizen: Achtung: Die Herkunft von Hadwig ist nicht direkt nachweisbar. Sie wurde als Hadwig Billung, Tochter des Bernhard II. von Sachsen identifiziert,wird aber in neueren Forschungen (Hausmann 1994) einem Geschlechte aus Friaul zugeordnet! Familie/Ehepartner: Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim). Engelbert (Sohn von Graf Siegfried I. von Spanheim (Sponheim) und Gräfin Richardis (Richgard) von Lavant (Sieghardinger)) gestorben am 1 Apr 1096 in St. Paul im Lavanttal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 556. | 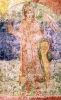 König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II. (Okt 2017) Vratislaw heiratete Prinzessin Adelheid von Ungarn (Árpáden) in 1058. Adelheid (Tochter von König Andreas I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Anastasia von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1040; gestorben am 27 Jan 1062. [Familienblatt] [Familientafel]
Vratislaw heiratete Königin Swatawa von Polen in 1062. Swatawa (Tochter von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew) wurde geboren in vor 1050; gestorben am 1 Sep 1126. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 557. |  Graf Konrad I. von Luxemburg Graf Konrad I. von Luxemburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_I,_Count_of_Luxembourg Konrad heiratete Ermesinde vom Nordgau in cir 1060. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Clementia von Poitou (Poitiers). Clementia (Tochter von Herzog Peter Wilhelm VII. von Poitou (Ramnulfiden) und Gräfin Ermensind von Longwy) wurde geboren in 1046/59; gestorben in nach 1129. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 558. |  Hermann von Salm Hermann von Salm Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Salm Familie/Ehepartner: Sophia von Formbach. Sophia (Tochter von Graf Meginhard V. (IV. ?) von Formbach und Mathilde von Rheinhausen) wurde geboren in 1050/55; gestorben in nach 1088. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 559. |  N. von Salm (von Luxemburg) N. von Salm (von Luxemburg) Familie/Ehepartner: Graf Konrad von Oltigen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 560. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kunigunde_von_Altdorf Kunigunde heiratete Markgraf Alberto Azzo II. d'Este in cir 1035. Alberto (Sohn von Alberto Azzo I. (Otbertiner) und Adela) wurde geboren in cir 1009; gestorben in 1097. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 561. |  Welf III. von Altdorf (Welfen) Welf III. von Altdorf (Welfen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Welf_III. |
| 562. |  Balduin V. von Flandern, der Fromme Balduin V. von Flandern, der Fromme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_V._(Flandern) Balduin heiratete Adela von Frankreich, die Heilige in 1028 in Paris, France. Adela (Tochter von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in ca 1009 od ca 1014; gestorben am 8 Jan 1079. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 563. |  Adelheid von Brauweiler Adelheid von Brauweiler Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Gottschalk von Zutphen (von Twente). Gottschalk (Sohn von Hermann von Nifterlake) gestorben in cir 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 564. |  Graf Adalbert III. von Calw Graf Adalbert III. von Calw Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Löwenstein_(Württemberg) Familie/Ehepartner: Kuniza (Cunizza) von Wirsbach (Willsbach). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 565. |  Gottfried II. von Calw Gottfried II. von Calw Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Calw Familie/Ehepartner: Liutgard von Zähringen. Liutgard (Tochter von Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen und Herzogin Agnes von Rheinfelden) wurde geboren in cir 1098; gestorben am 25 Mär 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 566. |  Graf Eckbert II. von Formbach von Pütten (Pitten) Graf Eckbert II. von Formbach von Pütten (Pitten) Notizen: Ekbert II., 1113 Graf von Formbach, 1120 von Pitten, 1142 Graf von Pitten, † 1144 ∞ Willibirg (Tochter des Markgraf Ottokar II. von Steyr), † 1145 Familie/Ehepartner: Markgräfin Wilibirg von Steiermark. Wilibirg (Tochter von Markgraf Ottokar II. von Steiermark und Markgräfin Elisabeth von Österreich (Babenberger)) gestorben in an einem 18 Jan zw 1136 und 1139. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 567. |  Graf Poppo VI. von Henneberg Graf Poppo VI. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Poppo heiratete Sophia (Sophie) von Andechs in vor 1182. Sophia (Tochter von Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) und Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher)) gestorben in 1218. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 568. | Irmingard heiratete Pfalzgraf Konrad von Schwaben (von Staufen) in cir 1160. Konrad (Sohn von Herzog Friedrich II. von Schwaben (Staufer) und Gräfin Agnes von Saarbrücken) wurde geboren in ca 1134 / 1136; gestorben am 8/9 Nov 1195. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 569. |  Lukardis von Henneberg Lukardis von Henneberg Lukardis heiratete Pfalzgraf Adalbert von Sommerschenburg in 1154 in Meiningen, Thüringen, DE. Adalbert gestorben in 15 Jan / 17 Mrz 1179. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 570. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Brandenburg) Otto heiratete Judith von Polen (Piasten) in cir 1148. Judith (Tochter von Herzog Boleslaw III. von Polen (Piasten), Schiefmund und Gräfin Salome von Berg (Schelklingen?)) wurde geboren in 1132; gestorben am 8. Juli 1172/1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Otto heiratete Adelheid (Ada?) von Holland? in vor 1176. Adelheid (Tochter von Florens III. von Holland (Gerulfinger) und Adelheid (Ada) von Huntingdon (von Schottland)) wurde geboren in cir 1163; gestorben in nach 1205. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 571. | Graf Hermann I. von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._(Weimar-Orlamünde) Familie/Ehepartner: Irmgard N.. Irmgard gestorben in 31 Jul 1174 bis 1180. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 572. |  Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_III._(Sachsen) (Apr 2018) Familie/Ehepartner: Brigitte von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Sophie von Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel] Bernhard heiratete Judith von Polen in vor 1175. Judith (Tochter von Grossherzog Miezislaus III. (Mieszko) von Polen und Herzogin Elisabeth von Ungarn) wurde geboren in 1154; gestorben am 1201 / 1202. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 573. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Hedwig hatte mit Otto zwei Töchter und zwei Söhne. Hedwig heiratete Markgraf Otto von Meissen (Wettiner) in cir 1155. Otto (Sohn von Markgraf Konrad I. von Wettin (Meissen) und Luitgard von Ravenstein) wurde geboren in 1125; gestorben am 18 Feb 1190; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 574. |  Gisela von Schwarzburg-Käfernburg Gisela von Schwarzburg-Käfernburg Gisela heiratete Pfalzgraf Friedrich V. von Putelendorf in nach 1126. Friedrich wurde geboren in vor 1114; gestorben am 31 Jan 1179. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 575. |  Graf Heinrich I. von Schwarzburg-Käfernburg Graf Heinrich I. von Schwarzburg-Käfernburg |
| 576. |  Graf Günter II. (III.) von Schwarzburg-Käfernburg Graf Günter II. (III.) von Schwarzburg-Käfernburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Günther_II._(Schwarzburg-Käfernburg) Familie/Ehepartner: Gertrud von Wettin (von Meissen). Gertrud (Tochter von Markgraf Konrad I. von Wettin (Meissen) und Luitgard von Ravenstein) gestorben in vor 1180. [Familienblatt] [Familientafel]
Günter heiratete Adelheid von Loccum-Hallermund in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 577. |  Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg Familie/Ehepartner: Graf Adolf II. von Schauenburg (von Holstein). Adolf (Sohn von Adolf I. von Schauenburg (von Holstein) und Hildewa) wurde geboren in 1128; gestorben am 6 Jul 1164 in Schlachtfeld Verchen, Demmin, Vorpommern; wurde beigesetzt in Minden, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 578. |  Juliane von Schwarzburg-Käfernburg Juliane von Schwarzburg-Käfernburg Notizen: Begraben: Juliane heiratete Heinrich I. Probus von Weida und Gera in 1163. Heinrich wurde geboren in 1122; gestorben in vor 8 Sep 1193; wurde beigesetzt in Pfarrkirche St. Veit, Wünschendorf. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 579. | Gräfin Mechthild von Gießen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Erbin von Gießen Mechthild heiratete Pfalzgraf Rudolf I. von Tübingen in 1181. Rudolf (Sohn von Pfalzgraf Hugo II. von Tübingen und Gräfin Elisabeth von Bregenz und Churrätien) wurde geboren in cir 1160; gestorben am 17 Mrz 1219. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 580. |  Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_IV._(Andechs) Berthold heiratete Agnes von Rochlitz in 1180. Agnes (Tochter von Dedo III. von Wettin (von Lausitz), der Feiste und Mathilde (Mechthilde) von Heinsberg) wurde geboren in 1152; gestorben am 25 Mrz 1195 in Dießen am Ammersee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 581. | Notizen: Name: Sophia heiratete Graf Poppo VI. von Henneberg in vor 1182. Poppo (Sohn von Burggraf Bertold I. von Henneberg und Bertha von Putelendorf (von Goseck)) wurde geboren in vor 1160; gestorben in Jun/Sep 1190 in Margat (Marqab). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 582. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Eberhard III. von Eberstein. Eberhard (Sohn von Berthold IV. von Eberstein und Uta von Lauffen) wurde geboren in Grafschaft Eberstein; gestorben in zw 1218 und 1219. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 583. | Notizen: Mathilde hatte mit Engelbert III. vermutlich zwei Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) und Adelheid von Dachau-Valley) wurde geboren in ca 1164/1172; gestorben am 5 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 584. |  Graf Ulrich von Berg Graf Ulrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berg_(Ehingen) Familie/Ehepartner: Adelheid (Udelhild) von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 585. |  Bischof Heinrich von Berg Bischof Heinrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Berg |
| 586. |  Bischof Diepold von Berg Bischof Diepold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_von_Berg |
| 587. |  Bischof Manegold von Berg Bischof Manegold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manegold_von_Berg |
| 588. |  Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Berg |
| 589. |  Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: Name: Richardis heiratete Graf Otto I. von Geldern in cir 1185. Otto (Sohn von Heinrich I. von Geldern und Agnes von Arnstein) wurde geboren in cir 1150; gestorben in nach 30.4.1207; wurde beigesetzt in Kloster Kamp, Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 590. |  Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Name: Sophia heiratete Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) in 1196. Hermann (Sohn von Landgraf Ludwig II. von Thüringen, der Eiserne und Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen)) wurde geboren in cir 1155; gestorben am 25 Apr 1217 in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 591. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig I. (* 23. Dezember 1173 in Kelheim; † 15. September 1231 ebenda) war Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein. Er gehörte dem Geschlecht der Wittelsbacher an. Den Beinamen der Kelheimer erhielt er, da er in Kelheim einem Attentat zum Opfer fiel. Ludwig heiratete Herzogin Ludmilla von Böhmen in 1204. Ludmilla (Tochter von Bedřich (Friedrich) von Böhmen (Přemysliden) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren in cir 1170; gestorben am 4 Aug 1240 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 592. |  Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bayerisches_Wappen Familie/Ehepartner: Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg. Rapoto (Sohn von Graf Rapoto I. von Ortenburg und Elisabeth von Sulzbach) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|