
| 1. |  Azzo (Adalbert) (von Friaul) Azzo (Adalbert) (von Friaul)Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. |  Wergigand von Istrien-Friaul Wergigand von Istrien-Friaul Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Werigand_(Friaul) Familie/Ehepartner: Willibirg von Freising (von Ebersberg). Willibirg (Tochter von Ulrich von Ebersberg und Richildis von Eppenstein) gestorben in nach 1056. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |  Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Poppo I. von Weimar (von Istrien). Poppo (Sohn von Wilhelm II. von Weimar, der Grosse ) wurde geboren in vor 1012; gestorben in 13 Jul cir 1044. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  Liutgard von Istrien-Friaul Liutgard von Istrien-Friaul Familie/Ehepartner: Graf Engelbert IV. von Chiemgau (Sieghardinger). Engelbert (Sohn von Engelbert III. von Chiemgau und Adala von Bayern) gestorben in cir 1040. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._(Istrien-Krain) Ulrich heiratete Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) in zw 1062 und 1063. Sophia (Tochter von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) gestorben am 18 Jun 1095. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Begraben: Familie/Ehepartner: Graf Siegfried I. von Spanheim (Sponheim). Siegfried wurde geboren in zw 1010 und 1015 in Burg Sponheim; gestorben am 7 Feb 1065 in Bulgarien; wurde beigesetzt in St. Paul im Lavanttal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Graf Meginhard (Meinhard) von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Graf Meginhard (Meinhard) von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Meinhardiner Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |  Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppo_II._(Istrien) Familie/Ehepartner: Gräfin Richardis (Richarda) von Spanheim. Richardis (Tochter von Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) und Hadwig (Hedwig) von Sachsen) gestorben in cir 1130. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Richgard von Weimar-Orlamünde (von Krain) Notizen: Richgard und Ekkehard I. hatten drei Söhne, Familie/Ehepartner: Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher). Ekkehard (Sohn von Otto I. von Scheyern (Wittelsbacher) und Haziga (Hadegunde) von Diessen) gestorben in vor 11 Mai 1091. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |  Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Engelbert I. Familie/Ehepartner: Hadwig (Hedwig) von Sachsen. Hadwig (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) wurde geboren in ca 1030/1035; gestorben in an einem 17 Jul ca 1112. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Richilda von Spanheim (Sponheim) Richilda von Spanheim (Sponheim) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Berchtold von Regensburg. Berchtold (Sohn von Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen) und Tuta von Regensburg) wurde geboren in cir 1042; gestorben in cir 1112. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. |  Hermann von Spanheim (Sponheim) Hermann von Spanheim (Sponheim) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Hermann heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  Graf Meinhard I. von Görz (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I._(Görz) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Schwarzenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Graf Engelbert I. von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Graf Engelbert I. von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Engelbert I. |
| 15. |  Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: Otto V. von Scheyern, nach anderer Zählart Otto IV. von Scheyern, (* 1083/1084; † 4. August 1156) stammt aus dem Geschlecht der Grafen von Scheyern, deren Name sich durch die Umsiedlung auf die Burg Wittelsbach in Grafen von Wittelsbach änderte. Er war Sohn von Ekkehardt I. von Scheyern und Richgard von Krain-Orlamünde. Er ist in dem Kloster Ensdorf, das von ihm gegründet wurde, begraben.[1] Familie/Ehepartner: Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe. Heilika (Tochter von Graf Friedrich III. von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe und Helwic von Schwaben ?) wurde geboren in cir 1103; gestorben am 14 Sep 1170 in Lengenfeld; wurde beigesetzt in Kloster Engsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |  Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_(Kärnten) Familie/Ehepartner: Uta von Passau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Graf Botho von Schwarzenburg Familie/Ehepartner: Petrissa Ne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. |  Richardis (Richgard) von Spanheim (Sponheim) Richardis (Richgard) von Spanheim (Sponheim) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Richgard von Sponheim oder Richardis Richardis heiratete Rudolf I. von Stade (der Nordmark) (Udonen) in Datum unbekannt. Rudolf (Sohn von Graf Lothar Udo II. von Stade (der Nordmark) (Udonen) und Oda von Werl) gestorben am 7 Dez 1124. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_II._(Görz) Familie/Ehepartner: Adelheid von Dachau-Valley. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Andechs) Bertold heiratete Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Hedwig (Tochter von Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) und Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe) gestorben am 16 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Luccardis (Liutgarde) von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Otto VI. von Andechs (von Diessen) |
| 24. | Familie/Ehepartner: Graf Diepold von Berg-Schelklingen. Diepold (Sohn von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) gestorben in spätestens 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. |  Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto I. der Rotkopf (* um 1117 wohl in Kelheim; † 11. Juli 1183 in Pfullendorf) aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war der Sohn des Pfalzgrafen Otto V. von Scheyern († 1156) und dessen Frau Heilika von Lengenfeld. Er war 1156 als Otto VI. Pfalzgraf von Bayern und von 1180 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Mit seinem Aufstieg zum Herzog begann die Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern, die erst im Jahre 1918 endete. Otto heiratete Agnes von Loon und Rieneck in 1169 in Kelheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach Hedwig heiratete Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Bertold (Sohn von Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen) und Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar)) wurde geboren in 1110/1115; gestorben am 14 Dez 1188; wurde beigesetzt in Kloster Diessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._von_Schwarzenburg |
| 28. | Notizen: Name: Familie/Ehepartner: aus der Steiermark. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. |  Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._(Kärnten) (Mai 2020) Familie/Ehepartner: Judith von Baden (von Verona). Judith (Tochter von Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) und Judith von Backnang (Hessonen)) gestorben in 1162. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten) Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Spanheim) Familie/Ehepartner: Mathilde von Sulzbach. Mathilde (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)) gestorben in 1165. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. |  Ida (Adelheid) von Spanheim (von Kärnten) Ida (Adelheid) von Spanheim (von Kärnten) Familie/Ehepartner: Graf Wilhelm III. von Nevers (Monceaux). Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm II. von Nevers (Monceaux) und Adelheid N.) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 21 Nov 1161; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Germain, Auxerre. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. |  Graf Rapoto I. von Ortenburg Graf Rapoto I. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ortenburg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Sulzbach. Elisabeth (Tochter von Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach und Mathilde von Bayern (Welfen)) gestorben am 23 Jan 1206; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  Gräfin Mathilde von Spanheim (von Kärnten) Gräfin Mathilde von Spanheim (von Kärnten) Notizen: Mathilde hatte mit Theobald II. elf Kinder. Mathilde heiratete Graf Theobald II. (IV.) (Diebold) von Champagne (Blois) in 1123. Theobald (Sohn von Stephan II. (Heinrich) von Blois und Adela von England (von der Normandie)) wurde geboren in 1093; gestorben am 10 Jan 1152. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Elisabeth von Schwarzenburg Notizen: Elisabeth hatte mit Meinhard I. vier Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Meinhard I. von Görz (Meinhardiner). Meinhard (Sohn von Graf Meginhard (Meinhard) von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner)) wurde geboren in cir 1070; gestorben in 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. |  Liutgard von Stade (Udonen) Liutgard von Stade (Udonen) Liutgard heiratete Friedrich II. von Sommerschenburg in Datum unbekannt, und geschieden in cir 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
Liutgard heiratete König Erik III. von Dänemark in 1144, und geschieden in 1146. Erik (Sohn von Jarl Håkon und Ragnhild) wurde geboren in cir 1100 bis 1105 in Fünen; gestorben am 27 Aug 1146 in Odense. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. |  Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Görz) Familie/Ehepartner: Mathilde (Mechthild) von Andechs (von Istrien). Mathilde (Tochter von Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) und Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher)) gestorben in 1245. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. |  Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_IV._(Andechs) Berthold heiratete Agnes von Rochlitz in 1180. Agnes (Tochter von Dedo III. von Wettin (von Lausitz), der Feiste und Mathilde (Mechthilde) von Heinsberg) wurde geboren in 1152; gestorben am 25 Mrz 1195 in Dießen am Ammersee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Notizen: Name: Sophia heiratete Graf Poppo VI. von Henneberg in vor 1182. Poppo (Sohn von Burggraf Bertold I. von Henneberg und Bertha von Putelendorf (von Goseck)) wurde geboren in vor 1160; gestorben in Jun/Sep 1190 in Margat (Marqab). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Eberhard III. von Eberstein. Eberhard (Sohn von Berthold IV. von Eberstein und Uta von Lauffen) wurde geboren in Grafschaft Eberstein; gestorben in zw 1218 und 1219. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Notizen: Mathilde hatte mit Engelbert III. vermutlich zwei Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) und Adelheid von Dachau-Valley) wurde geboren in ca 1164/1172; gestorben am 5 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. |  Graf Ulrich von Berg Graf Ulrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berg_(Ehingen) Familie/Ehepartner: Adelheid (Udelhild) von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. |  Bischof Heinrich von Berg Bischof Heinrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Berg |
| 44. |  Bischof Diepold von Berg Bischof Diepold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_von_Berg |
| 45. |  Bischof Manegold von Berg Bischof Manegold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manegold_von_Berg |
| 46. |  Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Berg |
| 47. |  Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: Name: Richardis heiratete Graf Otto I. von Geldern in cir 1185. Otto (Sohn von Heinrich I. von Geldern und Agnes von Arnstein) wurde geboren in cir 1150; gestorben in nach 30.4.1207; wurde beigesetzt in Kloster Kamp, Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. |  Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Name: Sophia heiratete Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) in 1196. Hermann (Sohn von Landgraf Ludwig II. von Thüringen, der Eiserne und Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen)) wurde geboren in cir 1155; gestorben am 25 Apr 1217 in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig I. (* 23. Dezember 1173 in Kelheim; † 15. September 1231 ebenda) war Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein. Er gehörte dem Geschlecht der Wittelsbacher an. Den Beinamen der Kelheimer erhielt er, da er in Kelheim einem Attentat zum Opfer fiel. Ludwig heiratete Herzogin Ludmilla von Böhmen in 1204. Ludmilla (Tochter von Bedřich (Friedrich) von Böhmen (Přemysliden) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren in cir 1170; gestorben am 4 Aug 1240 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. |  Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bayerisches_Wappen Familie/Ehepartner: Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg. Rapoto (Sohn von Graf Rapoto I. von Ortenburg und Elisabeth von Sulzbach) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | Notizen: Name: |
| 52. |
| 53. |
| 54. | Notizen: Name: Irmgard? heiratete Adolf II. von Berg in spätestens 1131. Adolf (Sohn von Graf Adolf I. von Berg und Adelheid von Lauffen) wurde geboren in 1090er; gestorben in 12 Okt 1160 bis 1170 in Burg Berge, Altenberg, Odenthal; wurde beigesetzt in Abtei Altenberg, Odenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. |  Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Andechs) Bertold heiratete Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Hedwig (Tochter von Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) und Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe) gestorben am 16 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Luccardis (Liutgarde) von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | Otto VI. von Andechs (von Diessen) |
| 57. | Familie/Ehepartner: Graf Diepold von Berg-Schelklingen. Diepold (Sohn von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) gestorben in spätestens 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. |  Herzog Hermann II. von Kärnten Herzog Hermann II. von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_(Kärnten) (Apr 2018) Hermann heiratete Herzogin Agnes von Österreich (Babenberger) in 1173. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich II. von Österreich, Jasomirgott und Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in 1151; gestorben am 13 Jan 1182; wurde beigesetzt in Krypta der Wiener Schottenkirche. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 59. |  Graf Guido von Nevers (Monceaux) Graf Guido von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_von_Nevers Guido heiratete Mathilde von Burgund in cir 1168. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. |  Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mathilde von Bayern (Wittelsbacher). Mathilde (Tochter von Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf und Agnes von Loon und Rieneck) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Kastel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. |  Graf Heinrich I. von Ortenburg Graf Heinrich I. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Bogislawa (Božislava) von Böhmen (Přemysliden). Bogislawa (Tochter von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Adelheid von Meissen) gestorben in cir 1223. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgräfin Richgard von Hohenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. |  Graf Heinrich I. von Champagne (Blois) Graf Heinrich I. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Champagne) Heinrich heiratete Prinzessin Marie von Frankreich (Kapetinger) in 1164. Marie (Tochter von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin Eleonore von Aquitanien) wurde geboren in 1145; gestorben am 11 Mrz 1198. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. |  Marie von Champagne (Blois) Marie von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Marie und Odo II. hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Marie heiratete Herzog Odo II. von Burgund in 1145. Odo (Sohn von Herzog Hugo II. von Burgund und Mathilde de Mayenne) wurde geboren in cir 1118; gestorben am 27 Sep 1162. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. |  Graf Theobald V. von Champagne (Blois) Graf Theobald V. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_V._(Blois) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Sibylle von Château-Renault. [Familienblatt] [Familientafel] Theobald heiratete Prinzessin Alix von Frankreich (Kapetinger) in 1164. Alix (Tochter von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin Eleonore von Aquitanien) wurde geboren in 1150; gestorben in 1197/1198. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. |  Isabelle (Elisabeth) von Champagne (Blois) Isabelle (Elisabeth) von Champagne (Blois) Notizen: Geburt: Isabelle heiratete Herzog Roger III. von Apulien (Hauteville) in 1139/1140/1143. Roger (Sohn von König Roger II. von Sizilien (Hauteville) und Königin Elvira Alfónsez (von León)) wurde geboren in 1118; gestorben am 2 Mai 1149. [Familienblatt] [Familientafel] Isabelle heiratete Guillaume IV. Gouët in vor 1155. Guillaume (Sohn von Herr Guillaume III. Gouët und Mabile (Mabel, Eustachia, Richilde) von England) wurde geboren in cir 1125; gestorben in 1168/1171. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. |  Mathilde von Champagne (Blois) Mathilde von Champagne (Blois) Mathilde heiratete Graf Rotrou IV. von Le Perche in Datum unbekannt. Rotrou (Sohn von Rotrou III. von Le Perche und Hedwig (Havise) von Salisbury (von Évreux)) gestorben am 27 Jul 1191. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. |  Herrin von Ligny Agnes von Champagne (Blois) Herrin von Ligny Agnes von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Agnes heiratete Graf Rainald II. von Bar, (von Mousson) (Scarponnois), der Junge in zw 1155 und 1158. Rainald (Sohn von Graf Rainald I. von Bar, (von Mousson) (Scarponnois), der Einäugige und Gräfin Gisela von Vaudémont (von Lothringen)) wurde geboren in 1115; gestorben am 25 Jul 1170; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Mihiel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. |  Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois) Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adela_von_Champagne Adela heiratete König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere am 13 Nov 1160 in Kathedrale Notre-Dame, Paris. Ludwig (Sohn von König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke und Königin Adelheid von Maurienne (Savoyen)) wurde geboren in 1120; gestorben am 18 Sep 1180 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. |  Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_II._(Görz) Familie/Ehepartner: Adelheid von Dachau-Valley. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. | Äbtissin Adelheid von Sommerschenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Adelheid IV., geboren als Adelheid von Sommerschenburg (* um 1130; † 1. Mai 1184 in Quedlinburg) war von 1152/53 an Äbtissin von Gandersheim und ab 1160/61 zusätzlich als Adelheid III. Äbtissin des Damenstifts in Quedlinburg. |
| 71. |  Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I. Meinhard heiratete Adelheid von Tirol in vor 9 Sep 1237. Adelheid (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) gestorben in Okt/Nov 1278. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 72. |  Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_VII._(Meranien) Otto heiratete Beatrix II. von Burgund (Staufern) in 1208. Beatrix (Tochter von Pfalzgraf Otto I. von Burgund (Schwaben, Staufer) und Gräfin Margarete von Blois) wurde geboren in cir 1193; gestorben am 7 Mai 1231; wurde beigesetzt in Kloster Langheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. |  Gertrud von Andechs Gertrud von Andechs Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Andreas II. fünf Kinder. Familie/Ehepartner: König Andreas II. von Ungarn (Árpáden). Andreas (Sohn von König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Agnès von Châtillon) wurde geboren in cir 1177; gestorben in 1235 in Ofen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. |  Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes hatte mit Phillip August drei Kinder. Agnes-Maria heiratete König Philipp II. August von Frankreich (Kapetinger) in 1196. Philipp (Sohn von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois)) wurde geboren am 21 Aug 1165 in Gonesse; gestorben am 14 Jul 1223 in Mantes-la-Jolie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 75. |  Hedwig von Andechs Hedwig von Andechs Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Sie wird in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt. Im römischen Generalkalender ist ihr Gedenktag am 16. Oktober, im evangelischen Namenkalender am 15. Oktober. Hedwig heiratete Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige in 1186. Heinrich (Sohn von Herzog Boleslaw I. von Schlesien (von Polen) (Piasten), der Lange und Adelheid von Sulzbach) wurde geboren in cir 1165 in Glogau; gestorben am 19 Mrz 1238 in Crossen an der Oder; wurde beigesetzt in vor dem Hauptaltar der Klosterkirche von Trebnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. |  Burggraf Berthold II. von Würzburg (von Henneberg) Burggraf Berthold II. von Würzburg (von Henneberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Kunigunde von Abensberg. [Familienblatt] [Familientafel]
Berthold heiratete Mechthild von Esvelt am 24 Apr 1190. Mechthild gestorben am 22/28 Sep 1246. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 77. |  Graf Poppo VII. von Henneberg Graf Poppo VII. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Henneberg_(Adelsgeschlecht) Poppo heiratete Elisabeth von Wildberg in 1217. Elisabeth wurde geboren in 1187 in Burg Wildberg, Sulzfeld; gestorben am 15 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
Poppo heiratete Jutta von Thüringen (Ludowinger) am 3 Jan 1223 in Leipzig, DE. Jutta (Tochter von Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) und Sophia von Sommerschenburg) wurde geboren in 1184; gestorben am 6 Aug 1235 in Schleusingen, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. |  Otto I. von Henneberg-Botenlauben Otto I. von Henneberg-Botenlauben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Otto heiratete Beatrix von Courtenay in vor 1 Okt 1208. Beatrix (Tochter von Baron Joscelin III. von Courtenay (von Edessa) und Agnes von Milly) wurde geboren in 1176?; gestorben in nach 7 Feb 1245; wurde beigesetzt in Kloster Frauenroth. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 79. |  Heinrich II. von Henneberg Heinrich II. von Henneberg |
| 80. |  Adelheid von Henneberg Adelheid von Henneberg Adelheid heiratete Herzog Heinrich III. von Limburg in vor 1189. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich II. von Limburg und Mathilde von Saffenberg) wurde geboren in cir 1140; gestorben am 21 Jul 1221 in Klosterrath. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 81. |  Elisabeth von Henneberg Elisabeth von Henneberg |
| 82. |  Kunigunde von Henneberg Kunigunde von Henneberg |
| 83. |  Margarethe von Henneberg Margarethe von Henneberg |
| 84. |  Gräfin Gertrud von Eberstein ? Gräfin Gertrud von Eberstein ? Notizen: Es ist nicht verbürgt, dass Gertrud eine von Eberstein ist. Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Neuenburg. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Neuenburg und Baronin Berta (Berthe) von Grenchen (de Granges)) wurde geboren in cir 1175; gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. |  Bischof Konrad von Eberstein Bischof Konrad von Eberstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Eberstein |
| 86. |  Graf Eberhard IV. von Eberstein Graf Eberhard IV. von Eberstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_IV._von_Eberstein Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Sayn. Adelheid (Tochter von Graf Heinrich II. von Sayn und Agnes von Saffenberg) gestorben in 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. |  Otto I. von Eberstein Otto I. von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Urach. Kunigunde (Tochter von Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) und Adelheid von Neuffen) gestorben in vor 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Beatrix von Crutheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 88. |  Agnes von Eberstein Agnes von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken). Friedrich (Sohn von Graf Simon II. von Saarbrücken und Liutgard (Lucarde) von Leiningen) gestorben in 1237. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Diether V von Katzenelnbogen. Diether (Sohn von Graf Diether IV. von Katzenelnbogen und Hildegunde) gestorben am 13 Jan 1276. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 89. |  Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I. Meinhard heiratete Adelheid von Tirol in vor 9 Sep 1237. Adelheid (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) gestorben in Okt/Nov 1278. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. |  Graf Diepold von Kersch (von Berg) Graf Diepold von Kersch (von Berg) Notizen: Geburt: Diepold heiratete Wilipirg von Aichelberg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Württemberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 92. |  Graf Gerhard IV von Geldern Graf Gerhard IV von Geldern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gerhard IV. von Geldern (* um 1185; † 22. Oktober 1229) war von 1207 bis zu seinem Tod Graf von Geldern. Gerhard heiratete Margareta von Brabant in 1206 in Löwen, Brabant. Margareta (Tochter von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1192; gestorben in 1231. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. |  Adelheid von Geldern Adelheid von Geldern Adelheid heiratete Graf Wilhelm I. von Holland (Gerulfinger) in 1197. Wilhelm (Sohn von Florens III. von Holland (Gerulfinger) und Adelheid (Ada) von Huntingdon (von Schottland)) wurde geboren in cir 1170; gestorben am 4 Feb 1222. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 94. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Thüringen) Ludwig heiratete Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) in 1221. Elisabeth (Tochter von König Andreas II. von Ungarn (Árpáden) und Gertrud von Andechs) wurde geboren am 7 Jul 1207 in Pressburg; gestorben am 17 Nov 1231 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 95. |  Agnes von Thüringen (Ludowinger) Agnes von Thüringen (Ludowinger) Notizen: Name: Agnes heiratete Herzog Heinrich von Österreich (Babenberger) am 29 Nov 1225 in Nürnberg, Bayern, DE. Heinrich (Sohn von Herzog Leopold VI. von Österreich (Babenberger, der Glorreiche und Theodora Angela von Byzanz) wurde geboren in 1208; gestorben am 29 Nov 1227/1228. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) in 1238. Albrecht (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in cir 1175; gestorben am 7 Okt 1260; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 96. |  Irmgard von Thüringen (Ludowinger) Irmgard von Thüringen (Ludowinger) Irmgard heiratete Fürst Heinrich I. von Anhalt (Askanier) in 1211. Heinrich (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in 1170; gestorben in 1252. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. |  Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto II. der Erlauchte (* 7. April 1206 in Kelheim; † 29. November 1253 in Landshut) aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war von 1231 bis 1253 Herzog von Bayern und von 1214 bis 1253 Pfalzgraf bei Rhein. Familie/Ehepartner: Agnes von Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. |  Pfalzgraf Rapoto III. von Ortenburg in Kreiburg Pfalzgraf Rapoto III. von Ortenburg in Kreiburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Adelheid von Zollern. Adelheid (Tochter von Burggraf Konrad I. von Nürnberg (Hohenzollern), der Fromme und Adelheid von Frontenhausen) gestorben am 19 Okt 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 99. |  Graf Eberhard I. von Berg-Altena Graf Eberhard I. von Berg-Altena Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eberhard I. von Berg-Altena (* um 1130; † 23. Januar 1180) war Graf von Altena von 1161 bis 1180. Familie/Ehepartner: Adelheid von Cuyk-Arnsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. |  Graf Engelbert I. von Berg Graf Engelbert I. von Berg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I._(Berg) Engelbert heiratete Margaretha von Geldern in Spätestens 1175. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 101. |  Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_IV._(Andechs) Berthold heiratete Agnes von Rochlitz in 1180. Agnes (Tochter von Dedo III. von Wettin (von Lausitz), der Feiste und Mathilde (Mechthilde) von Heinsberg) wurde geboren in 1152; gestorben am 25 Mrz 1195 in Dießen am Ammersee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. | Notizen: Name: Sophia heiratete Graf Poppo VI. von Henneberg in vor 1182. Poppo (Sohn von Burggraf Bertold I. von Henneberg und Bertha von Putelendorf (von Goseck)) wurde geboren in vor 1160; gestorben in Jun/Sep 1190 in Margat (Marqab). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 103. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Eberhard III. von Eberstein. Eberhard (Sohn von Berthold IV. von Eberstein und Uta von Lauffen) wurde geboren in Grafschaft Eberstein; gestorben in zw 1218 und 1219. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. | Notizen: Mathilde hatte mit Engelbert III. vermutlich zwei Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) und Adelheid von Dachau-Valley) wurde geboren in ca 1164/1172; gestorben am 5 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 105. |  Graf Ulrich von Berg Graf Ulrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berg_(Ehingen) Familie/Ehepartner: Adelheid (Udelhild) von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. |  Bischof Heinrich von Berg Bischof Heinrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Berg |
| 107. |  Bischof Diepold von Berg Bischof Diepold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_von_Berg |
| 108. |  Bischof Manegold von Berg Bischof Manegold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manegold_von_Berg |
| 109. |  Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Berg |
| 110. |  Gräfin Agnes I. von Nevers Gräfin Agnes I. von Nevers Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes I. hatte mit Peter II. eine Tochter. Agnes heiratete Kaiser Peter II. von Courtenay (Kapetinger) in 1184. Peter (Sohn von Peter I. von Frankreich (Courtenay, Kapetinger) und Herrin Elisabeth von Courtenay) wurde geboren in cir 1155; gestorben in 1217/19. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 111. |  Anna (Agnes, Cordula) von Ortenburg Anna (Agnes, Cordula) von Ortenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ortenburg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Friedrich von Truhendingen. Friedrich (Sohn von Friedrich von Truhendingen) gestorben in 1246/51. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 112. |  Graf Rapoto IV. von Ortenburg Graf Rapoto IV. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rapoto_IV._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Kunigunde von Bruckberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 113. |  Graf Heinrich II. von Champagne (Blois) Graf Heinrich II. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Champagne) (Sep 2023) Heinrich heiratete Königin Isabella I. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) am 6 Mai 1192. Isabella (Tochter von Amalrich I. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) und Königin Maria von Jerusalem (Komnenen)) wurde geboren in 1170; gestorben in 1205/1208. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 114. |  Graf Theobald III. von Champagne (Blois) Graf Theobald III. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_III._(Champagne) (Okt 2017) Theobald heiratete Gräfin Blanka von Navarra in 1195 in Chartres. Blanka (Tochter von König Sancho VI. von Navarra, der Weise und Sancha von Kastilien) gestorben in 1229. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 115. |  Kaiserin Marie von Champagne (Blois) Kaiserin Marie von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_von_Champagne_(Kaiserin) Marie heiratete Kaiser Balduin I. von Konstantinopel (von Hennegau) am 6 Jan 1186. Balduin (Sohn von Balduin V. von Hennegau und Gräfin Margarete I. von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in Jul 1171 in Valenciennes, Frankreich; gestorben in nach 20.7.1205 in Tarnowo, Bulgarien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 116. |  Alix (Adelheid) von Burgund Alix (Adelheid) von Burgund Familie/Ehepartner: Archambault (VIII.) von Bourbon. Archambault (Sohn von Herr Archambault VII. von Bourbon und Agnes von Savoyen) wurde geboren am 29 Jun 1140; gestorben am 26 Jul 1169. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 117. |  Herzog Hugo III. von Burgund Herzog Hugo III. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_III._(Burgund) Hugo heiratete Alix von Lothringen in 1165. Alix (Tochter von Herzog Matthäus I. von Lothringen und Bertha von Schwaben) wurde geboren in 1165; gestorben in 1200. [Familienblatt] [Familientafel]
Hugo heiratete Gräfin Béatrice (Beatrix) von Albon in 1184. Béatrice (Tochter von Graf Guigues V. von Albon und Beatrice von Montferrat) wurde geboren in 1161; gestorben am 16 Dez 1228 in Château féodal de Vizille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 118. |  Gräfin Margarete von Blois Gräfin Margarete von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Margarete hatte mit Otto I. zwei Kinder. Margarete heiratete Hugues III. d’Oisy in cir 1183. Hugues gestorben in Aug 1189. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Pfalzgraf Otto I. von Burgund (Schwaben, Staufer) in cir 1190. Otto (Sohn von Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) von Schwaben (von Staufen) und Kaiserin Beatrix von Burgund) wurde geboren in Jun/Jul 1170; gestorben am 13 Jan 1200 in Besançon, FR. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarete heiratete Walter II. von Avesnes in ca 1202/1203. Walter (Sohn von Herr Jakob von Avesnes und Adela von Guise) wurde geboren in cir 1170; gestorben in 1245/1246. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. |  Graf Ludwig von Blois Graf Ludwig von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Ludwig heiratete Gräfin Katharina von Clermont-en-Beauvaisis in 1184. Katharina (Tochter von Graf Rudolf I. (Raoul) von Clermont-en-Beauvaisis, der Rote und Alice (Adele) Le Puiset (von Breteul)) wurde geboren in vor 1178; gestorben am 19/20 Sep 1212/1213. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 120. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Mathilde heiratete Hervé III. von Donzy (Semur) in Datum unbekannt. Hervé (Sohn von Herr Geoffroy III. von Donzy (Semur)) gestorben in 1187. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 121. |  Graf Gottfried (Geoffrey) III. von Le Perche Graf Gottfried (Geoffrey) III. von Le Perche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_III._(Perche) Gottfried heiratete Mathilde (Mahaut) Richenza von Sachsen in Datum unbekannt. Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe und Mathilde von England (Plantagenêt)) gestorben in vor 1210. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 122. |  Graf Theobald I. von Bar-Scarponnois Graf Theobald I. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_I._(Bar) (Dez 2018) Theobald heiratete Lauretta von Loon und Rieneck in 1176. Lauretta (Tochter von Graf Ludwig I. von Loon und Rieneck und Agnes von Metz) gestorben in 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
Theobald heiratete Ermesinde von Brienne in 1189. Ermesinde (Tochter von Graf Guido von Brienne und Elisabeth de Chacenay) gestorben in 1211. [Familienblatt] [Familientafel]
Theobald heiratete Gräfin Ermesinde II. von Luxemburg in 1197. Ermesinde (Tochter von Graf Heinrich IV. von Luxemburg (von Namur), der Blinde und Agnes von Geldern) wurde geboren in Jul 1186; gestorben am 12 Feb 1247; wurde beigesetzt in Abtei Clairefontaine bei Arlon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 123. |  Graf Heinrich I. von Bar (von Mousson) (Scarponnois) Graf Heinrich I. von Bar (von Mousson) (Scarponnois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Bar) (Dez 2018) |
| 124. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_II._(Frankreich) (Feb 2022) Philipp heiratete Königin Isabella von Hennegau am 28 Apr 1180 in Abtei Sainte Trinité zu Bapaume. Isabella (Tochter von Balduin V. von Hennegau und Gräfin Margarete I. von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in ? 23 Apr 1170 in Lille; gestorben am 15 Mrz 1190 in Paris, France; wurde beigesetzt in Notre Dame de Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
Philipp heiratete Prinzessin Ingeborg von Dänemark am 15 Aug 1193 in Kathedrale, Amiens, Frankreich. Ingeborg (Tochter von König Waldemar I. von Dänemark, der Grosse und Königin Sophia von Dänemark (von Minsk)) wurde geboren in cir 1175; gestorben am 29 Jul 1236 in Corbeil; wurde beigesetzt in Saint-Jean-sur-l’Isle bei Corbeil. [Familienblatt] [Familientafel] Philipp heiratete Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) in 1196. Agnes-Maria (Tochter von Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) und Agnes von Rochlitz) wurde geboren in cir 1172; gestorben in 18 oder 19 Jul 1201 in Poissy, FR; wurde beigesetzt in Benediktinerkloster St. Corentin-lès-Mantes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 125. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alix_von_Frankreich,_Gräfin_von_Vexin Alix heiratete Graf Wilhelm IV. von Ponthieu (Talvas) (von Montgommery) am 20 Aug 1195. Wilhelm (Sohn von Graf Johann I. von Ponthieu und Beatrix von Saint-Pol (Haus Candavène)) wurde geboren in 1179; gestorben am 4 Okt 1221. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 126. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Frankreich_(1171–1240) (Okt 2017) Agnes heiratete Kaiser Alexios II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) am 2 Mrz 1180. Alexios (Sohn von Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) und Maria (Xene) von Antiochia (Poitiers)) wurde geboren am 10 Sep 1169; gestorben in Okt 1183. [Familienblatt] [Familientafel] Agnes heiratete Andronikos I. Komnenos (Byzanz, Komnenen) in 1183. Andronikos (Sohn von Isaak Komnenos (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in cir 1122; gestorben am 12 Sep 1185 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Theodoros Branas. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 127. |  Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Görz) Familie/Ehepartner: Mathilde (Mechthild) von Andechs (von Istrien). Mathilde (Tochter von Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) und Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher)) gestorben in 1245. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 128. |  Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_II. (Okt 2017) Meinhard heiratete Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher) in 1258 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren in cir 1227 in Burg Trausnitz in Landshut; gestorben am 9 Okt 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 129. | Herzog Otto VIII. von Meranien (von Andechs) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_VIII._(Meranien) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Tirol. Elisabeth (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) wurde geboren in ca 1220/1225; gestorben am 10 Okt 1256. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 130. | Gräfin Beatrix von Andechs (von Meranien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix hatte mit Hermann II. sechs Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Hermann II. von Weimar-Orlamünde. Hermann (Sohn von Graf Siegfried III. von Weimar-Orlamünde und Prinzessin Sophia von Dänemark) wurde geboren in cir 1184; gestorben am 27 Dez 1247. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 131. |  Margareta von Meran Margareta von Meran Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Meranien Margareta heiratete Przemsyl von Mähren in vor 15 Sep 1232. [Familienblatt] [Familientafel] Margareta heiratete Graf Friedrich I. von Truhendingen am 2 Jun 1240. Friedrich (Sohn von Friedrich von Truhendingen und Anna (Agnes, Cordula) von Ortenburg) gestorben am 30 Aug 1274. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 132. | Adelheid von Meranien (von Andechs) Notizen: Adelheid und Hugo hatten mehrere Kinder, darunter, vier Söhne und zwei Töchter. Adelheid heiratete Hugo von Chalon (Salins) in 1236. Hugo (Sohn von Graf Johann I. von Chalon (Salins) und Mathilde (Mahaut) von Burgund) wurde geboren in 1220; gestorben am 12 Nov 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 133. | Elisabeth von Meranien Notizen: Erbtochter der Andechser Grafen Otto VII. Elisabeth heiratete Burggraf Friedrich III. von Nürnberg (Hohenzollern), der Erber in 1246. Friedrich (Sohn von Burggraf Konrad I. von Nürnberg (Hohenzollern), der Fromme und Adelheid von Frontenhausen) wurde geboren in cir 1220; gestorben am 14 Aug 1297 in Burg, Cadolzburg Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 134. | 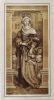 Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) Notizen: Elisabeth hatte mit Ludwig IV. drei Kinder. Elisabeth heiratete Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der Heilige in 1221. Ludwig (Sohn von Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) und Sophia von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 28 Okt 1200 in Creuzburg; gestorben am 11 Sep 1227 in Otranto. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 135. |  König Béla IV. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) König Béla IV. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Béla_IV._(Ungarn) Béla heiratete Königin von Ungarn Maria Laskaris (Nicäa) in 1218. Maria (Tochter von Kaiser Theodor I. Laskaris (Nicäa, Byzanz) und Anna Angelina Angelos (Byzanz)) wurde geboren in 1206 in Nicäa, Byzantinisches Reich; gestorben in 1270. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 136. | 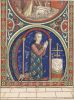 Prinz Philipp Hurepel von Frankreich (Kapetinger) Prinz Philipp Hurepel von Frankreich (Kapetinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Hurepel Philipp heiratete Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) in cir 1218. Mathilde (Tochter von Graf Rainald I. von Dammartin (Haus Mello) und Gräfin Ida von Elsass) gestorben in 1259. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 137. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Polen) Heinrich heiratete Herzogin Anna von Böhmen in 1217. Anna (Tochter von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Konstanze von Ungarn) wurde geboren in 1201/1204; gestorben am 26 Aug 1265. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 138. |  Burggraf Berthold III. von Würzburg (von Henneberg) Burggraf Berthold III. von Würzburg (von Henneberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mechthild von Hachberg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 139. |  Heinrich III. von Henneberg Heinrich III. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Elisabeth von Teck. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Sophia von Meissen (Weissenfels). Sophia (Tochter von Markgraf Dietrich von Meissen (Wettiner) und Jutta von Thüringen (Ludowinger)) gestorben am 17 Mrz 1280. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 140. |  Luitgard von Henneberg Luitgard von Henneberg Notizen: Zitat aus: https://mvdok.lbmv.de/mjbrenderer?id=mvdok_document_00002930 (Seite 150, 151) Luitgard heiratete Fürst Johann I. von Mecklenburg in 1229. Johann (Sohn von Heinrich Borwin (Burwy) II. von Mecklenburg und Christine) wurde geboren in cir 1211; gestorben am 1 Aug 1264; wurde beigesetzt in Münster, Doberan . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 141. |  Adelheid von Henneberg Adelheid von Henneberg |
| 142. |  Bertha von Henneberg Bertha von Henneberg |
| 143. |  Anna von Henneberg Anna von Henneberg |
| 144. |  Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._von_Henneberg Hermann heiratete Margarete von Holland (von Henneberg) in Pfingsten 1249. Margarete (Tochter von Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) und Mathilde von Brabant) wurde geboren in 1234; gestorben am 26 Mrz 1276 in Loosduinen; wurde beigesetzt in Kirche der Abtei von Loosduinen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 145. |  Kunigunde von Henneberg Kunigunde von Henneberg Kunigunde heiratete Herr Albrecht I. von Hohenlohe-Möckmühl in 1240. Albrecht (Sohn von Graf Gottfried I. von Hohenlohe-Weikersheim und Richenza (Richza) von Krautheim) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 146. |  Bischof Berthold IV. von Henneberg Bischof Berthold IV. von Henneberg |
| 147. |  Margaretha von Henneberg Margaretha von Henneberg Margaretha heiratete Konrad I. von Wildberg am 26 Aug 1271 in Rodach. Konrad wurde geboren in Burg Wildberg, Sulzfeld; gestorben am 6 Dez 1272. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 148. |  Otto von Henneberg Otto von Henneberg Notizen: Name: |
| 149. |  von Henneberg von Henneberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Konrad I. von Teck. Konrad (Sohn von Herzog Adalbert II. (Albrecht) von Teck) wurde geboren in cir 1195; gestorben in cir 1244; wurde beigesetzt in Kirchheim, Teck, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 150. |  Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Nidau Familie/Ehepartner: Bertha von Granges. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Richenza. Richenza gestorben in 1263/1267. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 151. | Propst Othon von Neuenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 152. |  Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Vers 1251 il échange sa part de la seigneurie de Valangin avec son frère Ulrich IV de Neuchâtel-Aarberg contre celle que ce dernier détenait sur Strassberg. Familie/Ehepartner: Jeanne von Granges. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 153. | Henri von Neuenburg |
| 154. |  Herr Ulrich IV von Neuenburg-Aarberg Herr Ulrich IV von Neuenburg-Aarberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Aarberg Familie/Ehepartner: Herrin Agnes von Montfaucon (von Montbéliard). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 155. |  Gertrud von Neuenburg Gertrud von Neuenburg Familie/Ehepartner: Graf Diethelm von Toggenburg. Diethelm (Sohn von Graf Diethelm von Toggenburg und Guta von Rapperswil) gestorben am 25 Jan 1236/47. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 156. | von Neuenburg Familie/Ehepartner: Rudolf I. von Falkenstein. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 157. | von Neuenburg Familie/Ehepartner: Konrad (Burkhard?) von Rothelin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 158. |  Berta von Neuenburg Berta von Neuenburg Notizen: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19528.php Familie/Ehepartner: Lütold V. von Regensberg. Lütold (Sohn von Lütold IV. von Regensberg und Gräfin von Kyburg) wurde geboren in vor 1218; gestorben in cir 1250. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Simon von Grandson. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 159. | Agnes von Neuenburg Familie/Ehepartner: Pierre von Grandson. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 160. |  Agnes von Eberstein Agnes von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich II. von Zweibrücken. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich I. von Zweibrücken (von Saarbrücken) und Hedwig von Lothringen) gestorben in 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 161. |  Eberhard V. von Eberstein Eberhard V. von Eberstein Familie/Ehepartner: Elisabeth von Baden. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 162. |  Adelheid von Eberstein Adelheid von Eberstein Notizen: Name: Adelheid heiratete Heinrich II von Lichtenberg in 1251. Heinrich (Sohn von Ludwig von Lichtenberg und Adelheid oder Elisa) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 163. |  Wolfrad von Eberstein Wolfrad von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Wertheim. Kunigunde gestorben in nach 9 Okt 1331. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 164. |  Simon von Leiningen Simon von Leiningen Notizen: Name: Simon heiratete Gertrud von Dagsburg (Etichonen) in 1220. Gertrud (Tochter von Albert II. (Albrecht) von Dagsburg (Etichonen) und Gertrud von Baden) gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 165. |  Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(Leiningen) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Kyburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 166. |  Graf Emich IV. von Leiningen Graf Emich IV. von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Emich_IV. Emich heiratete Elisabeth in cir 1235. Elisabeth gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
Emich heiratete Margarete von Heimbach (Hengebach) in 1265. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 167. |  Bischof Heinrich von Leiningen Bischof Heinrich von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Leiningen |
| 168. |  Bischof Berthold von Leiningen Bischof Berthold von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Leiningen |
| 169. |  Kunigunde von Leiningen Kunigunde von Leiningen Familie/Ehepartner: Werner IV. von Bolanden (Falkenstein, Münzenberg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 170. |  Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_II. (Okt 2017) Meinhard heiratete Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher) in 1258 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren in cir 1227 in Burg Trausnitz in Landshut; gestorben am 9 Okt 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 171. |  Engino von Aichelberg Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete von Otterswang in Datum unbekannt. wurde geboren in cir 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 172. |  Luitgard von Burgau Luitgard von Burgau Familie/Ehepartner: Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere . Ludwig (Sohn von Herzog Ludwig I. von Teck) wurde geboren in cir 1255; gestorben in 1 Mai 1280/20 Jul 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 173. |  Markgraf Heinrich II. von Burgau Markgraf Heinrich II. von Burgau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Alpeck. Adelheid (Tochter von Witegow von Alpeck) gestorben in 1280; wurde beigesetzt in Wengenkloster bei Ulm. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 174. |  Elisabeth von Berg (von Burgau) Elisabeth von Berg (von Burgau) Familie/Ehepartner: Graf Hugo II. von Montfort. Hugo (Sohn von Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) und Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg) gestorben am 11 Aug 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 175. |  Graf Otto II von Geldern, der Lahme Graf Otto II von Geldern, der Lahme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto II. von Geldern (* um 1215; † 10. Januar 1271; genannt der Lahme) war Graf von Geldern vom 22. Oktober 1229 bis zu seinem Tod. Otto heiratete Margarete von Kleve in Datum unbekannt. Margarete (Tochter von Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve und Nicht klar ?) gestorben am 10 Sep 1251. [Familienblatt] [Familientafel]
Otto heiratete Philippa von Dammartin (von Ponthieu) in Datum unbekannt. Philippa gestorben in 1277/81. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 176. |  Richarda von Geldern Richarda von Geldern Richarda heiratete Graf Wilhelm IV von Jülich in spätestens 1251/1252. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm III. von Jülich) wurde geboren in 1210; gestorben am 16 Mrz 1278 in Aachen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 177. |  Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Florens_IV._(Holland) Florens heiratete Mathilde von Brabant in 1224. Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1195; gestorben am 21 Dez 1267. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 178. |  Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen) Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stammmutter des Hauses Hessen Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen). Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1207; gestorben am 1 Feb 1248 in Löwen, Brabant; wurde beigesetzt in Villers-la-Ville. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 179. |  Hermann II. von Thüringen Hermann II. von Thüringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Thüringen) Familie/Ehepartner: Margaretha von Italien. Margaretha wurde geboren in 1237; gestorben am 8 Aug 1270 in Frankfurt am Main, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Hermann heiratete Helene von Braunschweig am 9 Okt 1239. Helene (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren am 18 Mrz 1223; gestorben am 6 Sep 1273; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 180. |  Herzogin Gertrud von Österreich (Babenberger) Herzogin Gertrud von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Vladislaw keine Kinder. Gertrud heiratete Vladislav von Böhmen in cir 1246. Vladislav (Sohn von König Wenzel I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde (Cunegundis) von Schwaben (Staufer)) gestorben am 3 Jan 1247. [Familienblatt] [Familientafel] Gertrud heiratete Markgraf Hermann VI von Baden in cir 1248. Hermann (Sohn von Markgraf Hermann V von Baden und Pfalzgräfin Irmengard bei Rhein (von Braunschweig)) wurde geboren in cir 1225; gestorben am 4 Okt 1250. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Roman von Halicz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 181. |  Jutta von Anhalt Jutta von Anhalt Notizen: Jutta hatte mit Nikolaus I. sechs Kinder. Jutta heiratete Nikolaus I. von Werle (von Mecklenburg) in cir 1231. Nikolaus (Sohn von Heinrich Borwin (Burwy) II. von Mecklenburg und Christine) wurde geboren in cir 1210; gestorben am 14 Mai 1277. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 182. |  Fürst Siegfried I von Anhalt (von Köthen) (Askanier) Fürst Siegfried I von Anhalt (von Köthen) (Askanier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_I._(Anhalt) Familie/Ehepartner: Katharina Birgersdottir von Schweden. Katharina (Tochter von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in 1245; gestorben in 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 183. |  Hedwig von Anhalt Hedwig von Anhalt Notizen: Hedwig und Boleslaw II. hatten sechs Kinder, drei Söhne und drei Töchter. Hedwig heiratete Herzog Boleslaw II. von Schlesien (Piasten) in 1242. Boleslaw (Sohn von Herzog Heinrich II von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Fromme und Herzogin Anna von Böhmen) wurde geboren in cir 1217; gestorben in 1278. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 184. |  Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher) Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth von Bayern (* um 1227 auf der Burg Trausnitz in Landshut; † 9. Oktober 1273) aus dem Hause Wittelsbach war durch ihren ersten Ehemann Konrad IV. römisch-deutsche Königin und Königin von Sizilien und Jerusalem sowie durch ihren zweiten Ehemann Meinhard II. Gräfin von Görz und Tirol. Elisabeth heiratete König Konrad IV. von Staufen am 1 Sep 1246 in Vohburg, Bayern, DE. Konrad (Sohn von König Friedrich II. von Staufen und Königin Jolante (Isabella II.) von Brienne (von Jerusalem)) wurde geboren am 25 Apr 1228 in Andria, Apulien; gestorben am 21 Mai 1254 in Lavello. [Familienblatt] [Familientafel]
Elisabeth heiratete Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) in 1258 in München, Bayern, DE. Meinhard (Sohn von Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) und Adelheid von Tirol) wurde geboren in cir 1239; gestorben in cir 30 Okt 1295 in Greifenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 185. |  Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig II., der Strenge (* 13. April 1229 in Heidelberg; † 2. Februar 1294 ebenda), aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war von 1253 bis 1294 Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein. Seit der Landesteilung von 1255 regierte er das Herzogtum Oberbayern. Ludwig heiratete Herzogin Maria von Brabant am 2 Aug 1254. Maria (Tochter von Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) und Marie von Schwaben (Staufer)) wurde geboren in 1226; gestorben am 18 Jan 1256 in Donauwörth. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Anna von Glogau (von Schlesien) (Piasten) am 24 Aug 1260 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Mathilde von Habsburg am 24 Okt 1273 in Aachen, Deutschland. Mathilde (Tochter von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in 1251; gestorben in 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 186. |  Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_XIII._(Bayern) Heinrich heiratete Elisabeth von Ungarn in 1250. Elisabeth (Tochter von König Béla IV. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin von Ungarn Maria Laskaris (Nicäa)) wurde geboren in 1236; gestorben in 1271. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 187. |  Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg Notizen: Name: Elisabeth heiratete Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans in 1258. Hartmann (Sohn von Graf Rudolf I. von Montfort-Werdenberg und Klementa von Kyburg) gestorben in spätestens 1271. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 188. |  Arnold von Altena Arnold von Altena Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_von_Altena Familie/Ehepartner: Mechthild von Holland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 189. |  Oda von Berg-Altena Oda von Berg-Altena Oda heiratete Graf Simon I. von Tecklenburg in Datum unbekannt. Simon (Sohn von Graf Heinrich I. von Tecklenburg und Eilike (Heilwig) von Oldenburg) wurde geboren in cir 1140; gestorben am 8 Aug 1202. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 190. |  Adolf III. von Berg Adolf III. von Berg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_III._(Berg) Adolf heiratete Bertha von Sayn (?) in Spätestens 1204. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 191. |  Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_VII._(Meranien) Otto heiratete Beatrix II. von Burgund (Staufern) in 1208. Beatrix (Tochter von Pfalzgraf Otto I. von Burgund (Schwaben, Staufer) und Gräfin Margarete von Blois) wurde geboren in cir 1193; gestorben am 7 Mai 1231; wurde beigesetzt in Kloster Langheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 192. |  Gertrud von Andechs Gertrud von Andechs Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Andreas II. fünf Kinder. Familie/Ehepartner: König Andreas II. von Ungarn (Árpáden). Andreas (Sohn von König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Agnès von Châtillon) wurde geboren in cir 1177; gestorben in 1235 in Ofen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 193. |  Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes hatte mit Phillip August drei Kinder. Agnes-Maria heiratete König Philipp II. August von Frankreich (Kapetinger) in 1196. Philipp (Sohn von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois)) wurde geboren am 21 Aug 1165 in Gonesse; gestorben am 14 Jul 1223 in Mantes-la-Jolie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 194. |  Hedwig von Andechs Hedwig von Andechs Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Sie wird in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt. Im römischen Generalkalender ist ihr Gedenktag am 16. Oktober, im evangelischen Namenkalender am 15. Oktober. Hedwig heiratete Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige in 1186. Heinrich (Sohn von Herzog Boleslaw I. von Schlesien (von Polen) (Piasten), der Lange und Adelheid von Sulzbach) wurde geboren in cir 1165 in Glogau; gestorben am 19 Mrz 1238 in Crossen an der Oder; wurde beigesetzt in vor dem Hauptaltar der Klosterkirche von Trebnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 195. |  Burggraf Berthold II. von Würzburg (von Henneberg) Burggraf Berthold II. von Würzburg (von Henneberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Kunigunde von Abensberg. [Familienblatt] [Familientafel]
Berthold heiratete Mechthild von Esvelt am 24 Apr 1190. Mechthild gestorben am 22/28 Sep 1246. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 196. |  Graf Poppo VII. von Henneberg Graf Poppo VII. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Henneberg_(Adelsgeschlecht) Poppo heiratete Elisabeth von Wildberg in 1217. Elisabeth wurde geboren in 1187 in Burg Wildberg, Sulzfeld; gestorben am 15 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
Poppo heiratete Jutta von Thüringen (Ludowinger) am 3 Jan 1223 in Leipzig, DE. Jutta (Tochter von Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) und Sophia von Sommerschenburg) wurde geboren in 1184; gestorben am 6 Aug 1235 in Schleusingen, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 197. |  Otto I. von Henneberg-Botenlauben Otto I. von Henneberg-Botenlauben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Otto heiratete Beatrix von Courtenay in vor 1 Okt 1208. Beatrix (Tochter von Baron Joscelin III. von Courtenay (von Edessa) und Agnes von Milly) wurde geboren in 1176?; gestorben in nach 7 Feb 1245; wurde beigesetzt in Kloster Frauenroth. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 198. |  Heinrich II. von Henneberg Heinrich II. von Henneberg |
| 199. |  Adelheid von Henneberg Adelheid von Henneberg Adelheid heiratete Herzog Heinrich III. von Limburg in vor 1189. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich II. von Limburg und Mathilde von Saffenberg) wurde geboren in cir 1140; gestorben am 21 Jul 1221 in Klosterrath. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 200. |  Elisabeth von Henneberg Elisabeth von Henneberg |
| 201. |  Kunigunde von Henneberg Kunigunde von Henneberg |
| 202. |  Margarethe von Henneberg Margarethe von Henneberg |
| 203. |  Gräfin Gertrud von Eberstein ? Gräfin Gertrud von Eberstein ? Notizen: Es ist nicht verbürgt, dass Gertrud eine von Eberstein ist. Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Neuenburg. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Neuenburg und Baronin Berta (Berthe) von Grenchen (de Granges)) wurde geboren in cir 1175; gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 204. |  Bischof Konrad von Eberstein Bischof Konrad von Eberstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Eberstein |
| 205. |  Graf Eberhard IV. von Eberstein Graf Eberhard IV. von Eberstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_IV._von_Eberstein Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Sayn. Adelheid (Tochter von Graf Heinrich II. von Sayn und Agnes von Saffenberg) gestorben in 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 206. |  Otto I. von Eberstein Otto I. von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Urach. Kunigunde (Tochter von Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) und Adelheid von Neuffen) gestorben in vor 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Beatrix von Crutheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 207. |  Agnes von Eberstein Agnes von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken). Friedrich (Sohn von Graf Simon II. von Saarbrücken und Liutgard (Lucarde) von Leiningen) gestorben in 1237. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Diether V von Katzenelnbogen. Diether (Sohn von Graf Diether IV. von Katzenelnbogen und Hildegunde) gestorben am 13 Jan 1276. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 208. |  Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I. Meinhard heiratete Adelheid von Tirol in vor 9 Sep 1237. Adelheid (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) gestorben in Okt/Nov 1278. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 209. |  Graf Diepold von Kersch (von Berg) Graf Diepold von Kersch (von Berg) Notizen: Geburt: Diepold heiratete Wilipirg von Aichelberg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 210. |  Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Württemberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 211. |  Gräfin Mathilde von Courtenay (Nevers) Gräfin Mathilde von Courtenay (Nevers) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_von_Courtenay Mathilde heiratete Graf Hervé IV. von Donzy (Semur) in cir 20 Okt 1199. Hervé (Sohn von Hervé III. von Donzy (Semur) und Herrin Mathilde Gouët) gestorben in 21 Jan 1222 oder 23 Jan 1223 in Burg Saint-Aignan; wurde beigesetzt in Kloster Pontigny. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Graf Guigues IV. von Forez (Albon) in 1226. Guigues (Sohn von Graf Guiguez III. von Forez (Albon) und Ascuraa) wurde geboren in vor 1200; gestorben am 29 Okt 1241 in Castellaneta; wurde beigesetzt in Kathedrale, Montbrison. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 212. |  Graf Friedrich I. von Truhendingen Graf Friedrich I. von Truhendingen Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._von_Truhendingen Friedrich heiratete Margareta von Meran am 2 Jun 1240. Margareta (Tochter von Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) und Beatrix II. von Burgund (Staufern)) gestorben in spätestens 1271. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 213. |  Graf Heinrich III. von Ortenburg Graf Heinrich III. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Adelheid von Schaunberg. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Sophie von Henneberg-Aschach am 21 Jun 1335. Sophie (Tochter von Heinrich VI. von Henneberg-Aschach und Gräfin Sophia von Schwarzburg-Blankenburg) wurde geboren in cir 1320; gestorben am 27 Nov 1344. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 214. |  Liutgard von Ortenburg Liutgard von Ortenburg Familie/Ehepartner: Graf Hartmann II. von Wartstein. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 215. |  Alice (Alix) von Champagne (Blois) Alice (Alix) von Champagne (Blois) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_(Champagne) (Sep 2023) Alice heiratete König Hugo I. von Lusignan (Zypern) in 1208. Hugo (Sohn von König Amalrich I von Lusignan (Zypern) und Eschiva von Ibelin) wurde geboren in 1195; gestorben am 10 Jan 1218 in Tripolis. [Familienblatt] [Familientafel]
Alice heiratete Fürst Bohemund V. von Antiochia in 1225, und geschieden in 1227. Bohemund (Sohn von Fürst Bohemund IV. von Antiochia und Plaisance von Gibelet) wurde geboren in cir 1200; gestorben in Jan 1252. [Familienblatt] [Familientafel] Alice heiratete Raoul von Soissons in 1241. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 216. |  Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_I._(Navarra) (Sep 2017) Theobald heiratete Gertrud von Egisheim in cir 1217, und geschieden in cir 1221. Gertrud (Tochter von Graf Albert von Egisheim) wurde geboren in cir 1203; gestorben am 30 Mrz 1225. [Familienblatt] [Familientafel] Theobald heiratete Agnes von Beaujeu in 1222. Agnes (Tochter von Guichard IV. von Beaujeu und Sibylle von Hennegau) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Abtei von Clairvaux. [Familienblatt] [Familientafel]
Theobald heiratete Marguerite von Bourbon (von Dampierre) in 1232. Marguerite (Tochter von Herr Archambault VIII. von Dampierre (Bourbon) und Béatrice de Montluçon) gestorben in 1256. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 217. |  Gräfin Johanna von Flandern (von Konstantinopel) Gräfin Johanna von Flandern (von Konstantinopel) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna hatte mit Fernando eine 1231 geborene Tochter, Maria, die aber 1235 starb. Johanna heiratete Graf Thomas II. von Savoyen am 2 Apr 1237. Thomas (Sohn von Graf Thomas I. von Savoyen und Béatrice Marguerite von Genf) wurde geboren in 1199; gestorben am 7 Feb 1259 in Aosta; wurde beigesetzt in Abtei Hautecombe. [Familienblatt] [Familientafel] Johanna heiratete Fernando (Ferdinand, Ferrand) von Portugal am 1 Jan 1212. Fernando (Sohn von König Sancho I. von Portugal, der Besiedler und Prinzessin Dulce von Barcelona) wurde geboren am 24 Mrz 1188; gestorben am 26 Jul 1233; wurde beigesetzt in Zisterzienserabtei von Marquette. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 218. |  Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_II._(Flandern) Margarethe heiratete Burkhard von Avesnes in 1212. Burkhard (Sohn von Herr Jakob von Avesnes und Adela von Guise) wurde geboren in cir 1182; gestorben in 1244 in Rupelmonde, Flandern. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarethe heiratete Guillaume II. (Wilhelm) von Dampierre in 1223. Guillaume (Sohn von Herr Guy II. (Guido) von Dampierre und Mathilde I. von Bourbon) gestorben am 3 Sep 1231; wurde beigesetzt in Zisterzienserabtei von Orchies (Arrondissement Douai), dann ab 1257 in der Abtei Flines. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 219. |  Mathilde I. von Bourbon Mathilde I. von Bourbon Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_I._(Bourbon) Mathilde heiratete Herr Guy II. (Guido) von Dampierre in Sep 1196. Guy (Sohn von Herr Willhelm (Guillaume) I. von Dampierre und Ermengarde de Mouchy) gestorben am 18 Jan 1216. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Gaucher IV. (Gauthier) von Salins (Vienne) in vor 1183, und geschieden in 1195. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 220. |  Herzog Odo III. von Burgund Herzog Odo III. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Odo_III._(Burgund) Odo heiratete Teresa (Mathilde) von Portugal in 1194. Teresa (Tochter von König Alfons I. Henriques von Portugal und Gräfin Mathilde (Mafalda) von Savoyen und Maurienne) wurde geboren in 1157; gestorben am 16 Okt 1218. [Familienblatt] [Familientafel] Odo heiratete Alix von Vergy in 1199. Alix (Tochter von Herr Hugues de Vergy und Gillette de Trainel) wurde geboren in cir 1182; gestorben in 1252. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 221. |  Herr Alexander (Alexandre) von Burgund Herr Alexander (Alexandre) von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Alexander heiratete Herrin Beatrix (Berthe) von Rion in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 222. |  Mathilde (Mahaut) von Burgund Mathilde (Mahaut) von Burgund Notizen: Mathilde und Johann I. hatten fünf Kinder, einen Sohn und vier Töchter. Mathilde heiratete Graf Johann I. von Chalon (Salins) in Jan 1214. Johann (Sohn von Graf Stephan III. von Auxonne (von Chalon) und Beatrix von Chalon (Thiern)) wurde geboren in 1190; gestorben in 1267. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 223. |  Anne (Marguerite) von Burgund Anne (Marguerite) von Burgund Notizen: Anne und Amadeus IV. hatten zwei Töchter. Familie/Ehepartner: Graf Amadeus IV. von Savoyen. Amadeus (Sohn von Graf Thomas I. von Savoyen und Béatrice Marguerite von Genf) wurde geboren in 1197 in Montmélian; gestorben am 13 Jul 1253 in Montmélian. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 224. |  Beatrix II. von Burgund (Staufern) Beatrix II. von Burgund (Staufern) Notizen: Beatrix II. hatte mit Otto VII. sechs Kinder, einen Sohn und fünf Töchter. Beatrix heiratete Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) in 1208. Otto (Sohn von Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) und Agnes von Rochlitz) gestorben am 7 Mai 1234 in Besançon, FR; wurde beigesetzt in Kloster Langheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 225. |  Gräfin Maria von Avesnes Gräfin Maria von Avesnes Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Blois) Maria heiratete Graf Hugo I. (V.) von Châtillon-Saint Pol in Apr 1226. Hugo (Sohn von Graf Walter III. (Gaucher) von Châtillon-Saint Pol und Elisabeth von Saint Pol (Haus Candavène)) wurde geboren in nach 1197; gestorben am 9 Apr 1248 in Avignon, Frankreich; wurde beigesetzt in Abtei Pont-aux-Dames, Couilly-Pont-aux-Dames, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 226. |  Graf Hervé IV. von Donzy (Semur) Graf Hervé IV. von Donzy (Semur) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hervé_IV._(Donzy) Hervé heiratete Gräfin Mathilde von Courtenay (Nevers) in cir 20 Okt 1199. Mathilde (Tochter von Kaiser Peter II. von Courtenay (Kapetinger) und Gräfin Agnes I. von Nevers) wurde geboren in cir 1188; gestorben am 12 Okt 1257 in Abbaye Fontevrault; wurde beigesetzt in Abbaye Fontevrault. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 227. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_(Perche) Thomas heiratete Helisende von Rethel in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 228. |  Gräfin Agnes von Bar Gräfin Agnes von Bar Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes und Friedrich II. hatten sechs oder sieben Kinder, vier oder fünf Söhne und zwei Töchter. Agnes heiratete Herzog Friedrich II. von Lothringen (von Bitsch) in 1188. Friedrich (Sohn von Herzog Friedrich I. (Ferri) von Lothringen (von Bitsch) und Prinzessin Ludomilla von Polen) gestorben in 08 od 09 Okt 1213. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 229. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Bar) (Dez 2018) Heinrich heiratete Philippa von Dreux in 1219. Philippa (Tochter von Graf Robert II. von Dreux und Yolande von Coucy) wurde geboren in 1192; gestorben in 1242. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 230. |  Agnes von Bar-Scarponnois Agnes von Bar-Scarponnois Notizen: Die Ehe der Agnes mit Hugo I. blieb kinderlos. Familie/Ehepartner: Graf Hugo I. (V.) von Châtillon-Saint Pol. Hugo (Sohn von Graf Walter III. (Gaucher) von Châtillon-Saint Pol und Elisabeth von Saint Pol (Haus Candavène)) wurde geboren in nach 1197; gestorben am 9 Apr 1248 in Avignon, Frankreich; wurde beigesetzt in Abtei Pont-aux-Dames, Couilly-Pont-aux-Dames, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 231. |  Elisabeth von Bar Elisabeth von Bar Familie/Ehepartner: Walram II. von Monschau (Haus Limburg). Walram (Sohn von Herzog Walram IV. von Limburg und Kunigunde von Monschau) gestorben in 1242. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 232. |  Margarete von Bar Margarete von Bar Notizen: Geburt: Margarete heiratete Graf Hugo III. von Vaudémont in cir 1231. Hugo (Sohn von Graf Hugo II. von Vaudémont und Hedwiga von Reynel) wurde geboren in vor 1231; gestorben in cir 1244. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 233. |  König Ludwig VIII. von Frankreich, der Löwe König Ludwig VIII. von Frankreich, der Löwe Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VIII._(Frankreich) (Okt 2017) Ludwig heiratete Königin Blanka von Kastilien am 23 Mai 1200 in Port-Mort. Blanka (Tochter von König Alfons VIII. von Kastilien und Königin Eleanore von England (Plantagenêt)) wurde geboren in vor dem 4 Mär 1188 in Palencia; gestorben am 27 Nov 1252 in Paris, France; wurde beigesetzt in Zisterzienserkloster Maubuisson. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 234. |  Gräfin Marie von Ponthieu (von Montgommery) Gräfin Marie von Ponthieu (von Montgommery) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Ponthieu Marie heiratete Graf Simon von Dammartin (von Ponthieu) in 1250. Simon (Sohn von Graf Aubry II. (Alberich) von Dammartin (Haus Mello) und Mathilde (Mathildis, Mahaut, Mabile) von Clermont) gestorben in 1239. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 235. |  Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Agnes heiratete Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) am 1 Jan 1286. Friedrich (Sohn von Albrecht II. von Meissen (Wettiner) und Prinzessin Margaretha von Staufen) wurde geboren in 1257 in Wartburg in Eisenach; gestorben am 16 Nov 1323 in Wartburg in Eisenach; wurde beigesetzt in Burg Grimmenstein in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 236. |  Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth hatte mit Albrecht I. 21 Kinder. Elisabeth heiratete König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) am 20 Nov 1274 in Wien. Albrecht (Sohn von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in Jul 1255 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 1 Mai 1308 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 237. |  Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(Kärnten) Otto heiratete Euphemia von Schlesien (Piasten) in 1297. Euphemia (Tochter von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren in 1281; gestorben in 1347. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 238. |  Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kärnten Familie/Ehepartner: Anna Přemyslovna. Anna (Tochter von König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) und Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg) wurde geboren am 15 Okt 1290 in Prag, Tschechien ; gestorben am 3 Sep 1313 in Kärnten; wurde beigesetzt in Dominikanerkloster Bozen. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen) am 15 Sep 1315 in Innsbruck, Österreich. Adelheid (Tochter von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in 1285; gestorben am 18 Aug 1320. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Beatrice von Savoyen in Feb 1328. Beatrice (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in cir 1310; gestorben in 1331. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 239. |  Graf Hermann III. von Weimar-Orlamünde (Askanier) Graf Hermann III. von Weimar-Orlamünde (Askanier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_III._(Weimar-Orlamünde) Familie/Ehepartner: N N. N gestorben in nach 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 240. |  Graf Otto III. (IV.) von Weimar-Orlamünde Graf Otto III. (IV.) von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(Weimar-Orlamünde) (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Agnes von Truhedingen (Leiningen?). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 241. |  Friedrich II. von Truhendingen Friedrich II. von Truhendingen Notizen: Name: Friedrich heiratete Agnes von Württemberg in vor 11 Jan 1282. Agnes (Tochter von Graf Ulrich I. von Württemberg und Gräfin Mechthild von Baden) wurde geboren in vor 1264; gestorben am 27 Sep 1305; wurde beigesetzt in Dominikanerkloster Mergentheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 242. |  Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_IV._(Burgund) Otto heiratete Philippa von Bar in 1263. Philippa (Tochter von Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois und Jeanne von Toucy) gestorben in 1290. [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Mathilde (Mahaut) von Artois in 1285. Mathilde (Tochter von Graf Robert II. von Artois und Amicia von Courtenay) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 27 Nov 1329 in Paris, France; wurde beigesetzt am 30 Nov 1329 in Abtei Maubuisson. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 243. |  Graf Rainald (Renaud) von Burgund (von Chalon) Graf Rainald (Renaud) von Burgund (von Chalon) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Begraben: Rainald heiratete Gräfin Guillemette von Neuenburg in 1282. Guillemette (Tochter von Amadeus von Neuenburg und Jordane von La Sarra) gestorben in 1317 in Château d'Etobon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 244. | Isabel (Elisabeth) von Bourgonne-Comté (von Chalon) Isabel heiratete Graf Hartmann V. von Kyburg in 1254. Hartmann (Sohn von Graf Werner von Kyburg (Kiburg) und Herzogin Alix Berta von Lothringen) wurde geboren in 1223; gestorben am 3 Sep 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 245. |  Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen) Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stammmutter des Hauses Hessen Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen). Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1207; gestorben am 1 Feb 1248 in Löwen, Brabant; wurde beigesetzt in Villers-la-Ville. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 246. |  Hermann II. von Thüringen Hermann II. von Thüringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Thüringen) Familie/Ehepartner: Margaretha von Italien. Margaretha wurde geboren in 1237; gestorben am 8 Aug 1270 in Frankfurt am Main, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Hermann heiratete Helene von Braunschweig am 9 Okt 1239. Helene (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren am 18 Mrz 1223; gestorben am 6 Sep 1273; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 247. |  Anna von Ungarn (Árpáden) Anna von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Grossfürst Rostislaw von Kiew. Rostislaw (Sohn von Grossfürst Michael von Tschernigow) wurde geboren in 1210; gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 248. |  Elisabeth von Ungarn Elisabeth von Ungarn Notizen: Elisabeth und Heinrich XIII. hatten sieben Kinder. Elisabeth heiratete Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) in 1250. Heinrich (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 19 Nov 1235; gestorben am 3 Feb 1290 in Burghausen; wurde beigesetzt in Kloster Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 249. |  König Stephan V. von Ungarn (Árpáden) König Stephan V. von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_V._(Ungarn) Familie/Ehepartner: Königin Elisabeth von Cumania. Elisabeth (Tochter von Khan Kuthen von Cumania und Prinzessin Halitsch N.) wurde geboren in 1240; gestorben in 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 250. |  Prinzessin Jolanta Helena von Ungarn (Árpáden) Prinzessin Jolanta Helena von Ungarn (Árpáden) Jolanta heiratete Bolesław VI. von Kalisch (Piasten), der Fromme in 1257. Bolesław (Sohn von Herzog Władysław Odonic von Kalisch (Piasten)) wurde geboren in 1224/1227; gestorben am 13/14 Apr 1279 in Kalisz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 251. |  Herzog Béla (Bela) von Slawonien (Árpáden) Herzog Béla (Bela) von Slawonien (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Béla heiratete Kunigunde von Brandenburg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 252. | Herzog Boleslaw II. von Schlesien (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Boleslaw_II._(Schlesien) Boleslaw heiratete Hedwig von Anhalt in 1242. Hedwig (Tochter von Fürst Heinrich I. von Anhalt (Askanier) und Irmgard von Thüringen (Ludowinger)) gestorben am 21 Dez 1259. [Familienblatt] [Familientafel]
Boleslaw heiratete Eufemia (Alenta, Adelheid) von Pommerellen in cir 1261, und geschieden in 1275. Eufemia (Tochter von Herzog Sambor II. von Pommerellen und Mathilde (Mechthildis) von Mecklenburg) wurde geboren in 1254. [Familienblatt] [Familientafel] Boleslaw heiratete Sophia von Dyhrn in cir 1277. Sophia wurde geboren in 1255/1257; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 253. | Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Elisabeth und Przemysł I. hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Familie/Ehepartner: Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten). Przemysł (Sohn von Herzog Władysław Odon (von Polen) und Jadwiga N.) wurde geboren in 1220/1221; gestorben in 1257. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 254. |  Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten) Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Konrad II. von Schlesien war Begründer der Glogauer Herzogslinie Konrad heiratete Salome von Polen in 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Sophia von Landsberg. Sophia (Tochter von Dietrich von Landsberg (Meissen, Wettiner) und Helene von Brandenburg) wurde geboren in 1258/1259; gestorben in 14 od 24 Aug 1318 in Weissenfels. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 255. |  Amalia von Henneberg Amalia von Henneberg Notizen: Name: |
| 256. |  Jutta von Henneberg Jutta von Henneberg |
| 257. |  Sophia von Henneberg Sophia von Henneberg Familie/Ehepartner: Herr Friedrich von Hohenlohe-Wernsberg. Friedrich (Sohn von Herr Albrecht I. von Hohenlohe-Möckmühl und Udelhild von Berg-Schelkingen) wurde geboren in vor 1267; gestorben am 23 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 258. |  Alheidis (Adelheid) von Henneberg Alheidis (Adelheid) von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Graf Ludwig II. von Rieneck. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 259. |  Heinrich IV. (III.) von Henneberg-Hartenberg Heinrich IV. (III.) von Henneberg-Hartenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Margarethe von Meissen. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Kunigunde von Wertheim in vor 3 Mai 1287. Kunigunde gestorben in nach 9 Okt 1331. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 260. |  Graf Berthold V. von Henneberg-Schleusingen Graf Berthold V. von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Henneberg,_Grafen_von#Henneberg-Coburg Berthold heiratete Sophia von Schwarzburg-Blankenburg in kurz vor 7 Mrz 1268 in Elgersburg. Sophia (Tochter von Graf Günter IV. (VII.) von Schwarzburg und Prinzessin Sofija von Halicz (Halytsch)) gestorben am 13 Feb 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 261. |  Graf Hermann II. von Henneberg-Aschach Graf Hermann II. von Henneberg-Aschach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Hermann heiratete Adelheid von Trimberg in vor 25 Mrz 1277. Adelheid gestorben in zw 18 Nov 1316 und 7 Jul 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 262. |  Elisabeth von Mecklenburg Elisabeth von Mecklenburg Notizen: Elisabeth und Gerhard I. hatten elf Kinder, vier Töchter und sieben Söhne. Elisabeth heiratete Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe in cir 1250. Gerhard (Sohn von Graf Adolf IV. von Schauenburg (von Holstein) und Heilwig von der Lippe) wurde geboren in 1232; gestorben am 21 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 263. |  Albrecht I. von Mecklenburg Albrecht I. von Mecklenburg |
| 264. |  Fürst Heinrich I. von Mecklenburg Fürst Heinrich I. von Mecklenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Mecklenburg) Heinrich heiratete Anastasia von Pommern (Greifen) in cir 1259. Anastasia (Tochter von Herzog Barnim I. von Pommern (Greifen) und Marianne) wurde geboren in cir 1245; gestorben am 15 Mrz 1317. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 265. |  Graf Poppo VIII. von von Henneberg-Coburg Graf Poppo VIII. von von Henneberg-Coburg |
| 266. |  Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg Familie/Ehepartner: Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange . Otto (Sohn von Markgraf Otto III. von Brandenburg (Askanier), der Fromme und Beatrix (Božena) von Böhmen) wurde geboren in cir 1246; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 267. |  Herzog Ludwig I. von Teck Herzog Ludwig I. von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 268. |  Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere Notizen: Stammliste der Herzöge von Teck: Familie/Ehepartner: Uta von Zweibrücken. Uta (Tochter von Simon I. von Zweibrücken und von Calw) gestorben in vor 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 269. |  Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau Notizen: Rodolphe II de Neuchâtel-Nidau, (? - 1308/09), comte de Nidau, seigneur de Fenis et de Cerlier. Dès la succession de son père il accorde les franchises à la ville de Nidau en 12615 puis à Cerlier en 1264/66 Familie/Ehepartner: Gertrude von Neuenburg-Strassberg. Gertrude (Tochter von Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg und Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein) wurde geboren am 27 Mrz 1327. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 270. | Richenza von Neuenburg-Nidau |
| 271. |  Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg Notizen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Strassberg Familie/Ehepartner: Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein. Adelheid (Tochter von Otto II. von Ochsenstein und Kunigunde von Habsburg) gestorben am 17 Mai 1314/1332. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 272. |  Graf Wilhelm von Aarberg-Aarberg Graf Wilhelm von Aarberg-Aarberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Wädenswil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 273. |  Kraft von Toggenburg Kraft von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Toggenburger Familie/Ehepartner: Elisabeth von Bussnang. Elisabeth (Tochter von Ritter Albrecht von Bussnang und von Wartenberg) gestorben in spätestens 1276. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 274. |  Lüthold VI. von Regensberg Lüthold VI. von Regensberg Notizen: Zitat aus: https://wikivividly.com/lang-de/wiki/Freiherren_von_Regensberg Familie/Ehepartner: Adelburg von Kaiserstuhl. Adelburg (Tochter von Rudolf von Kaiserstuhl und Adelheid von Tengen) gestorben in spätestens 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 275. |  Ulrich von Regensberg Ulrich von Regensberg Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Regensberg_family Familie/Ehepartner: Berta von Klingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Pfirt. Adelheid (Tochter von Graf Ulrich von Pfirt und Herrin Agnes de Vergy) gestorben in zw 1311 und 1314. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 276. |  Simon I. von Zweibrücken Simon I. von Zweibrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Calw. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 277. |  Elisabeth von Zweibrücken Elisabeth von Zweibrücken Familie/Ehepartner: Graf Gerlach V. von Veldenz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 278. |  Kunigunde von Lichtenberg Kunigunde von Lichtenberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Otto III. von Ochsenstein. Otto (Sohn von Otto II. von Ochsenstein und Kunigunde von Habsburg) gestorben am 2 Jul 1298 in Göllheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 279. |  Agnes von Leiningen Agnes von Leiningen |
| 280. |  Adelheid von Leiningen Adelheid von Leiningen Adelheid heiratete Graf Johann I. von Sponheim-Kreuznach in 1265. Johann (Sohn von Simon I. von Sponheim-Kreuznach und Margarete von Heimbach (Hengebach)) wurde geboren in zw 1245 und 1250; gestorben am 28 Jan 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 281. |  Emich V. von Leiningen Emich V. von Leiningen Emich heiratete Katharina von Ochsenstein in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 282. |  Bischof Friedrich von Bolanden Bischof Friedrich von Bolanden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bolanden |
| 283. |  Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Agnes heiratete Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) am 1 Jan 1286. Friedrich (Sohn von Albrecht II. von Meissen (Wettiner) und Prinzessin Margaretha von Staufen) wurde geboren in 1257 in Wartburg in Eisenach; gestorben am 16 Nov 1323 in Wartburg in Eisenach; wurde beigesetzt in Burg Grimmenstein in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 284. |  Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth hatte mit Albrecht I. 21 Kinder. Elisabeth heiratete König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) am 20 Nov 1274 in Wien. Albrecht (Sohn von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in Jul 1255 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 1 Mai 1308 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 285. |  Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(Kärnten) Otto heiratete Euphemia von Schlesien (Piasten) in 1297. Euphemia (Tochter von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren in 1281; gestorben in 1347. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 286. |  Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kärnten Familie/Ehepartner: Anna Přemyslovna. Anna (Tochter von König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) und Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg) wurde geboren am 15 Okt 1290 in Prag, Tschechien ; gestorben am 3 Sep 1313 in Kärnten; wurde beigesetzt in Dominikanerkloster Bozen. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen) am 15 Sep 1315 in Innsbruck, Österreich. Adelheid (Tochter von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in 1285; gestorben am 18 Aug 1320. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Beatrice von Savoyen in Feb 1328. Beatrice (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in cir 1310; gestorben in 1331. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 287. |  Graf Engino von Aichelberg Graf Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete Agnes von Helfenstein in Datum unbekannt. Agnes (Tochter von Wilhelm II. von Helfenstein und Irmengarde von Molsberg) wurde geboren in 1212. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 288. |  Herzogin Anna von Teck Herzogin Anna von Teck Anna heiratete Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg in cir 1260. Diepold (Sohn von Graf Engino von Aichelberg und Agnes von Helfenstein) wurde geboren in 1234; gestorben am 6 Mrz 1270. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 289. |  Adelheid von Burgau Adelheid von Burgau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Burgau Adelheid heiratete Rudolf II. von Werdenberg-Sargans in vor 1291. Rudolf (Sohn von Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans und Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg) gestorben in 28 Sep 1322 ? in bei Mühldorf am Inn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 290. |  Heinrich von Burgau Heinrich von Burgau Familie/Ehepartner: Margarethe von Hohenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 291. |  Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Notizen: Zitat aus: https://regiowiki.at/wiki/Rudolf_II._von_Montfort Rudolf heiratete Agnes von Grüningen (Grieningen) in zw 1255 und 1260. Agnes (Tochter von Graf Hartmann II. von Grüningen) wurde geboren in Grüningen, Baden-Württemberg, DE; gestorben in spätestens 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 292. |  Ulrich I. von Montfort-Bregenz Ulrich I. von Montfort-Bregenz |
| 293. |  Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang |
| 294. |  Bischof Friedrich von Montfort Bischof Friedrich von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 295. |  Fürstabt Wilhelm von Montfort Fürstabt Wilhelm von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 296. |  Margarethe von Geldern Margarethe von Geldern Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Dietrich VI. (VIII.) von Kleve. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich V. (VII.) von Kleve und Aleidis (Alheidis) von Heinsberg (Haus Sponheim)) wurde geboren in cir 1256/57; gestorben am 4 Okt 1305. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarethe heiratete Herr Enguerrand IV. von Coucy in cir 1262. Enguerrand (Sohn von Herr Enguerrand III. von Coucy und Marie von Montmirail) gestorben in 1310. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 297. |  Rainald I. von Geldern Rainald I. von Geldern Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_I._(Geldern) Rainald heiratete Irmgard von Limburg in 1270. Irmgard (Tochter von Herzog Walram V. von Limburg und Jutta (Judith) von Kleve) gestorben in 1283. [Familienblatt] [Familientafel] Rainald heiratete Margareta von Flandern (von Dampierre) in 1286. Margareta (Tochter von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Isabella von Luxemburg) gestorben in 1331. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 298. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_V._(Jülich) Gerhard heiratete von Kessel in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Gerhard heiratete Elisabeth von Brabant-Arschot in Datum unbekannt. Elisabeth (Tochter von Herr Gottfried von Brabant-Arschot und Jeanne Isabeau von Vierzon) gestorben in 1350. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 299. | Notizen: Name: Margaretha heiratete Graf Diether V von Katzenelnbogen in cir 1261. Diether (Sohn von Graf Diether IV. von Katzenelnbogen und Hildegunde) gestorben am 13 Jan 1276. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 300. | Notizen: Name: Blancheflor heiratete Heinrich I. von Sponheim-Starkenburg in 1265. Heinrich (Sohn von Graf Johann I. von Sponheim-Starkenberg (von Sayn) und von Isenberg (von Altena)) wurde geboren in zw 1235 und 1240; gestorben am 1 Aug 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 301. | Notizen: Name: Peronetta heiratete Graf Ludwig von Arnsberg in vor 1277. Ludwig (Sohn von Graf Gottfried III. von Arnsberg und Adelheid von Blieskastel) wurde geboren in cir 1237; gestorben am 2 Mai 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 302. |  Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Holland Familie/Ehepartner: Elisabeth von Lüneburg (von Braunschweig). Elisabeth (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1230; gestorben am 27 Mai 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 303. |  Adelheid von Holland Adelheid von Holland Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Holland Adelheid heiratete Johann von Hennegau (von Avesnes) in 1246. Johann (Sohn von Burkhard von Avesnes und Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze ) wurde geboren am 1 Mai 1218 in Houffalize, Wallonien; gestorben am 24 Dez 1257. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 304. |  Margarete von Holland (von Henneberg) Margarete von Holland (von Henneberg) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Henneberg Margarete heiratete Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg in Pfingsten 1249. Hermann (Sohn von Graf Poppo VII. von Henneberg und Jutta von Thüringen (Ludowinger)) wurde geboren in 1224; gestorben am 18 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 305. |  Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Heinrich I. von Hessen (* 24. Juni 1244; † 21. Dezember 1308 in Marburg) war erster Landgraf von Hessen und Begründer des hessischen Fürstenhauses. Heinrich heiratete Adelheid von Lüneburg (von Braunschweig) am 10 Sep 1263. Adelheid (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) gestorben am 12 Jun 1274 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Mechtild von Kleve in cir 1275. Mechtild (Tochter von Graf Dietrich V. (VII.) von Kleve und Aleidis (Alheidis) von Heinsberg (Haus Sponheim)) gestorben am 21 Dez 1309. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 306. |  Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth heiratete Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große am 13 Jul 1254. Albrecht (Sohn von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1236; gestorben am 15 Aug 1279. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 307. |  Friedrich von Baden (von Österreich) Friedrich von Baden (von Österreich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Baden-Österreich |
| 308. |  Herr Johann I. von Werle Herr Johann I. von Werle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus:: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Werle) Familie/Ehepartner: Sophie von Lindau-Ruppin. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 309. |  Heinrich I. von Werle Heinrich I. von Werle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Werle) (Jun 2021) Heinrich heiratete Königin Rikitsa (Richiza) Birgersdatter von Norwegen (von Bjälbo) in cir 1262. Rikitsa (Tochter von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in cir 1238; gestorben in 1288. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Mathilde von Braunschweig (von Lüneburg) in cir 1291. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 310. |  Fürst Albrecht I. von Anhalt-Köthen (Askanier) Fürst Albrecht I. von Anhalt-Köthen (Askanier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Anhalt) Familie/Ehepartner: Liutgard von Holstein. Liutgard (Tochter von Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe und Elisabeth von Mecklenburg) wurde geboren in cir 1251; gestorben in 1289. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Agnes von Brandenburg (Askanier). Agnes (Tochter von Markgraf Konrad I. von Brandenburg (Askanier) und Constanze von Polen (Piasten)) gestorben in 1329. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 311. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(Schlesien) Heinrich heiratete Elisabeth von Kalisch in 1277. Elisabeth (Tochter von Bolesław VI. von Kalisch (Piasten), der Fromme und Prinzessin Jolanta Helena von Ungarn (Árpáden)) gestorben in 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 312. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bolko_I._(Schweidnitz) (Apr 2018) Bolko heiratete Beatrix von Brandenburg in 1286. Beatrix (Tochter von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Katharina von Polen) gestorben in 1316. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 313. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Schlesien-Liegnitz Agnes heiratete Graf Ulrich I. von Württemberg in nach 1259. Ulrich (Sohn von Graf Ludwig von Württemberg und von Kyburg (Kiburg)) wurde geboren in 1226; gestorben am 25 Feb 1265. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 314. |  König Konradin von Staufen König Konradin von Staufen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Der letzte legitime Staufer. Konradin heiratete Sophia von Landsberg in 1266. Sophia (Tochter von Dietrich von Landsberg (Meissen, Wettiner) und Helene von Brandenburg) wurde geboren in 1258/1259; gestorben in 14 od 24 Aug 1318 in Weissenfels. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 315. |  Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I,_Duke_of_Bavaria Rudolf heiratete Prinzessin Mechthild von Nassau am 1 Sep 1294 in Nürnberg, Bayern, DE. Mechthild (Tochter von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1280; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 316. |  Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Fürst Otto II. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1288. Otto (Sohn von Herzog Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) und Liutgard von Holstein) wurde geboren in cir 1266; gestorben am 10 Apr 1330; wurde beigesetzt in Kloster St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 317. |  Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes heiratete Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) in 1303. Heinrich (Sohn von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren am 21 Mrz 1256; gestorben am 14 Feb 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Landgraf Heinrich von Hessen in 1290. Heinrich wurde geboren in 1264; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 318. |  Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(HRR) Ludwig heiratete Beatrix von Schlesien-Schweidnitz in cir 1308. Beatrix (Tochter von Herzog Bolko I. von Schlesien (von Schweidnitz) (Piasten) und Beatrix von Brandenburg) wurde geboren in cir 1290; gestorben am 24 Aug 1322 in München, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Margarethe von Hennegau (von Holland) am 25 Feb 1324 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Margarethe (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in ca 1307 / 1310 in Valenciennes ?; gestorben am 23 Jun 1356 in Quesnoy; wurde beigesetzt in Minoritenkirche zu Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 319. |  König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto III. von Bayern (* 11. Februar 1261; † 9. September 1312 in Landshut) stammte aus dem Geschlecht der Wittelsbacher. Er war von 1290 bis 1312 Herzog von Niederbayern und als Béla V. von 1305 bis 1307 ungarischer König. Otto heiratete Katharina von Habsburg in cir 1279 in Wien. Katharina (Tochter von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in cir 1256 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 4 Apr 1282 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Kloster Seligenthal bei Landshut. [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Herzogin Agnes von Glogau am 18 Mai 1309. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in zw 1293 und 1296; gestorben am 25 Dez 1361 in Selingenthal; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 320. |  Rudolf II. von Werdenberg-Sargans Rudolf II. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Rudolf heiratete Adelheid von Burgau in vor 1291. Adelheid (Tochter von Markgraf Heinrich II. von Burgau und Adelheid von Alpeck) gestorben am spätestens 1307 ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: von Aspermont. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 321. |  Friedrich von Isenberg (von Altena) Friedrich von Isenberg (von Altena) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Berg Friedrich heiratete Sophie von Limburg in cir 1214. Sophie (Tochter von Herzog Walram IV. von Limburg und Kunigunde von Monschau) gestorben in 1226. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 322. |  Agnes von Altena Agnes von Altena Familie/Ehepartner: Graf Christian II. von Oldenburg. Christian (Sohn von Graf Moritz I. von Oldenburg und Salome von Hochstaden-Wickrath) wurde geboren in vor 1209; gestorben in 1233. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 323. |  Oda von Tecklenburg Oda von Tecklenburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Hermann II. von der Lippe. Hermann wurde geboren in 1175 in Lippe (heute Lippstadt); gestorben am 25 Dez 1229 in Schlachtfeld Hasbergen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 324. |  Graf Otto I. von Tecklenburg Graf Otto I. von Tecklenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Tecklenburg) Otto heiratete Mechthild von Holstein-Schauenburg in Datum unbekannt. Mechthild (Tochter von Adolf III. von Schauenburg (von Holstein) und Adelheid von Querfurt) wurde geboren in cir 1190; gestorben in cir 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 325. |  Irmgard von Berg Irmgard von Berg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_von_Berg Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich IV. von Limburg. Heinrich (Sohn von Herzog Walram IV. von Limburg und Kunigunde von Monschau) wurde geboren in cir 1200; gestorben am 25 Feb 1246. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 326. | Herzog Otto VIII. von Meranien (von Andechs) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_VIII._(Meranien) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Tirol. Elisabeth (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) wurde geboren in ca 1220/1225; gestorben am 10 Okt 1256. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 327. | Gräfin Beatrix von Andechs (von Meranien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix hatte mit Hermann II. sechs Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Hermann II. von Weimar-Orlamünde. Hermann (Sohn von Graf Siegfried III. von Weimar-Orlamünde und Prinzessin Sophia von Dänemark) wurde geboren in cir 1184; gestorben am 27 Dez 1247. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 328. |  Margareta von Meran Margareta von Meran Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Meranien Margareta heiratete Przemsyl von Mähren in vor 15 Sep 1232. [Familienblatt] [Familientafel] Margareta heiratete Graf Friedrich I. von Truhendingen am 2 Jun 1240. Friedrich (Sohn von Friedrich von Truhendingen und Anna (Agnes, Cordula) von Ortenburg) gestorben am 30 Aug 1274. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 329. | Adelheid von Meranien (von Andechs) Notizen: Adelheid und Hugo hatten mehrere Kinder, darunter, vier Söhne und zwei Töchter. Adelheid heiratete Hugo von Chalon (Salins) in 1236. Hugo (Sohn von Graf Johann I. von Chalon (Salins) und Mathilde (Mahaut) von Burgund) wurde geboren in 1220; gestorben am 12 Nov 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 330. | Elisabeth von Meranien Notizen: Erbtochter der Andechser Grafen Otto VII. Elisabeth heiratete Burggraf Friedrich III. von Nürnberg (Hohenzollern), der Erber in 1246. Friedrich (Sohn von Burggraf Konrad I. von Nürnberg (Hohenzollern), der Fromme und Adelheid von Frontenhausen) wurde geboren in cir 1220; gestorben am 14 Aug 1297 in Burg, Cadolzburg Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 331. | 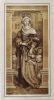 Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) Notizen: Elisabeth hatte mit Ludwig IV. drei Kinder. Elisabeth heiratete Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der Heilige in 1221. Ludwig (Sohn von Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) und Sophia von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 28 Okt 1200 in Creuzburg; gestorben am 11 Sep 1227 in Otranto. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 332. |  König Béla IV. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) König Béla IV. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Béla_IV._(Ungarn) Béla heiratete Königin von Ungarn Maria Laskaris (Nicäa) in 1218. Maria (Tochter von Kaiser Theodor I. Laskaris (Nicäa, Byzanz) und Anna Angelina Angelos (Byzanz)) wurde geboren in 1206 in Nicäa, Byzantinisches Reich; gestorben in 1270. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 333. | 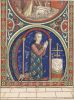 Prinz Philipp Hurepel von Frankreich (Kapetinger) Prinz Philipp Hurepel von Frankreich (Kapetinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Hurepel Philipp heiratete Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) in cir 1218. Mathilde (Tochter von Graf Rainald I. von Dammartin (Haus Mello) und Gräfin Ida von Elsass) gestorben in 1259. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 334. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Polen) Heinrich heiratete Herzogin Anna von Böhmen in 1217. Anna (Tochter von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Konstanze von Ungarn) wurde geboren in 1201/1204; gestorben am 26 Aug 1265. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 335. |  Burggraf Berthold III. von Würzburg (von Henneberg) Burggraf Berthold III. von Würzburg (von Henneberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mechthild von Hachberg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 336. |  Heinrich III. von Henneberg Heinrich III. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Elisabeth von Teck. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Sophia von Meissen (Weissenfels). Sophia (Tochter von Markgraf Dietrich von Meissen (Wettiner) und Jutta von Thüringen (Ludowinger)) gestorben am 17 Mrz 1280. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 337. |  Luitgard von Henneberg Luitgard von Henneberg Notizen: Zitat aus: https://mvdok.lbmv.de/mjbrenderer?id=mvdok_document_00002930 (Seite 150, 151) Luitgard heiratete Fürst Johann I. von Mecklenburg in 1229. Johann (Sohn von Heinrich Borwin (Burwy) II. von Mecklenburg und Christine) wurde geboren in cir 1211; gestorben am 1 Aug 1264; wurde beigesetzt in Münster, Doberan . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 338. |  Adelheid von Henneberg Adelheid von Henneberg |
| 339. |  Bertha von Henneberg Bertha von Henneberg |
| 340. |  Anna von Henneberg Anna von Henneberg |
| 341. |  Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._von_Henneberg Hermann heiratete Margarete von Holland (von Henneberg) in Pfingsten 1249. Margarete (Tochter von Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) und Mathilde von Brabant) wurde geboren in 1234; gestorben am 26 Mrz 1276 in Loosduinen; wurde beigesetzt in Kirche der Abtei von Loosduinen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 342. |  Kunigunde von Henneberg Kunigunde von Henneberg Kunigunde heiratete Herr Albrecht I. von Hohenlohe-Möckmühl in 1240. Albrecht (Sohn von Graf Gottfried I. von Hohenlohe-Weikersheim und Richenza (Richza) von Krautheim) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 343. |  Bischof Berthold IV. von Henneberg Bischof Berthold IV. von Henneberg |
| 344. |  Margaretha von Henneberg Margaretha von Henneberg Margaretha heiratete Konrad I. von Wildberg am 26 Aug 1271 in Rodach. Konrad wurde geboren in Burg Wildberg, Sulzfeld; gestorben am 6 Dez 1272. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 345. |  Otto von Henneberg Otto von Henneberg Notizen: Name: |
| 346. |  von Henneberg von Henneberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Konrad I. von Teck. Konrad (Sohn von Herzog Adalbert II. (Albrecht) von Teck) wurde geboren in cir 1195; gestorben in cir 1244; wurde beigesetzt in Kirchheim, Teck, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 347. |  Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Nidau Familie/Ehepartner: Bertha von Granges. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Richenza. Richenza gestorben in 1263/1267. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 348. | Propst Othon von Neuenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 349. |  Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Vers 1251 il échange sa part de la seigneurie de Valangin avec son frère Ulrich IV de Neuchâtel-Aarberg contre celle que ce dernier détenait sur Strassberg. Familie/Ehepartner: Jeanne von Granges. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 350. | Henri von Neuenburg |
| 351. |  Herr Ulrich IV von Neuenburg-Aarberg Herr Ulrich IV von Neuenburg-Aarberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Aarberg Familie/Ehepartner: Herrin Agnes von Montfaucon (von Montbéliard). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 352. |  Gertrud von Neuenburg Gertrud von Neuenburg Familie/Ehepartner: Graf Diethelm von Toggenburg. Diethelm (Sohn von Graf Diethelm von Toggenburg und Guta von Rapperswil) gestorben am 25 Jan 1236/47. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 353. | von Neuenburg Familie/Ehepartner: Rudolf I. von Falkenstein. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 354. | von Neuenburg Familie/Ehepartner: Konrad (Burkhard?) von Rothelin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 355. |  Berta von Neuenburg Berta von Neuenburg Notizen: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19528.php Familie/Ehepartner: Lütold V. von Regensberg. Lütold (Sohn von Lütold IV. von Regensberg und Gräfin von Kyburg) wurde geboren in vor 1218; gestorben in cir 1250. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Simon von Grandson. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 356. | Agnes von Neuenburg Familie/Ehepartner: Pierre von Grandson. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 357. |  Agnes von Eberstein Agnes von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich II. von Zweibrücken. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich I. von Zweibrücken (von Saarbrücken) und Hedwig von Lothringen) gestorben in 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 358. |  Eberhard V. von Eberstein Eberhard V. von Eberstein Familie/Ehepartner: Elisabeth von Baden. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 359. |  Adelheid von Eberstein Adelheid von Eberstein Notizen: Name: Adelheid heiratete Heinrich II von Lichtenberg in 1251. Heinrich (Sohn von Ludwig von Lichtenberg und Adelheid oder Elisa) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 360. |  Wolfrad von Eberstein Wolfrad von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Wertheim. Kunigunde gestorben in nach 9 Okt 1331. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 361. |  Simon von Leiningen Simon von Leiningen Notizen: Name: Simon heiratete Gertrud von Dagsburg (Etichonen) in 1220. Gertrud (Tochter von Albert II. (Albrecht) von Dagsburg (Etichonen) und Gertrud von Baden) gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 362. |  Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(Leiningen) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Kyburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 363. |  Graf Emich IV. von Leiningen Graf Emich IV. von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Emich_IV. Emich heiratete Elisabeth in cir 1235. Elisabeth gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
Emich heiratete Margarete von Heimbach (Hengebach) in 1265. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 364. |  Bischof Heinrich von Leiningen Bischof Heinrich von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Leiningen |
| 365. |  Bischof Berthold von Leiningen Bischof Berthold von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Leiningen |
| 366. |  Kunigunde von Leiningen Kunigunde von Leiningen Familie/Ehepartner: Werner IV. von Bolanden (Falkenstein, Münzenberg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 367. |  Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_II. (Okt 2017) Meinhard heiratete Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher) in 1258 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren in cir 1227 in Burg Trausnitz in Landshut; gestorben am 9 Okt 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 368. |  Engino von Aichelberg Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete von Otterswang in Datum unbekannt. wurde geboren in cir 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 369. |  Luitgard von Burgau Luitgard von Burgau Familie/Ehepartner: Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere . Ludwig (Sohn von Herzog Ludwig I. von Teck) wurde geboren in cir 1255; gestorben in 1 Mai 1280/20 Jul 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 370. |  Markgraf Heinrich II. von Burgau Markgraf Heinrich II. von Burgau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Alpeck. Adelheid (Tochter von Witegow von Alpeck) gestorben in 1280; wurde beigesetzt in Wengenkloster bei Ulm. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 371. |  Elisabeth von Berg (von Burgau) Elisabeth von Berg (von Burgau) Familie/Ehepartner: Graf Hugo II. von Montfort. Hugo (Sohn von Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) und Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg) gestorben am 11 Aug 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 372. |  Gräfin Agnès II. von Donzy (Nevers) Gräfin Agnès II. von Donzy (Nevers) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus, Okt 2017: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_II._(Nevers) Agnès heiratete Graf Guido I. (IV.) von Saint Pol (de Châtillon) in 1221. Guido (Sohn von Graf Walter III. (Gaucher) von Châtillon-Saint Pol und Elisabeth von Saint Pol (Haus Candavène)) wurde geboren in nach 1196; gestorben in Aug 1226 in vor Avignon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 373. |  Heinrich IV. von Ortenburg Heinrich IV. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Agnes von Bayern. Agnes (Tochter von König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) und Herzogin Agnes von Glogau) wurde geboren in 1310; gestorben in 1360. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 374. |  Maria von Zypern (Lusignan) Maria von Zypern (Lusignan) Familie/Ehepartner: Graf Walter IV. von Brienne. Walter (Sohn von Graf Walter III. von Brienne und Maria Elvira von Sizilien (Hauteville)) wurde geboren in 1205; gestorben in 1246; wurde beigesetzt in 1250 in Johanniterkirche St. Johannis, Akkon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 375. |  Isabella von Lusignan (Zypern) Isabella von Lusignan (Zypern) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_von_Zypern (Sep 2023) Isabella heiratete Heinrich von Lusignan (Antiochia, Ramnulfiden) in 1233. Heinrich (Sohn von Fürst Bohemund IV. von Antiochia und Plaisance von Gibelet) wurde geboren in cir 1210; gestorben in 18 od 27 Jun 1276 in vor Tripolis; wurde beigesetzt in Kathedrale St. Sophia, Nikosia. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 376. |  König Heinrich I. von Zypern König Heinrich I. von Zypern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Zypern) (Sep 2023) Heinrich heiratete Alix von Montferrat (Aleramiden) in Mai 1229. Alix (Tochter von Markgraf Wilhelm VI. von Montferrat (Aleramiden) und Berta di Clavesana) gestorben am vor Apr 1233. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Stephanie von Barberon in 1237. Stephanie wurde geboren in cir 1220/1225; gestorben in 1249. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Plaisance von Antiochia in 1251. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 377. |  Blanche (Blanca) von Champagne Blanche (Blanca) von Champagne Blanche heiratete Herzog Johann I. von der Bretagne, der Rote in 1236. Johann (Sohn von Peter von Dreux, Mauclerc und Herzogin Alix von Thouars) wurde geboren in 1217 in Château de l’Isle, Marzan; gestorben am 8 Okt 1286. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 378. |  König Theobald II. (V.) von Navarra (Blois) König Theobald II. (V.) von Navarra (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_II._(Navarra) (Sep 2017) Theobald heiratete Prinzessin Isabella von Frankreich in 1255 in Melun. Isabella (Tochter von König Ludwig IX. von Frankreich und Königin Margarete von der Provence) wurde geboren am 2 Mrz 1242; gestorben am 27 Apr 1271 in Îles d’Hyères; wurde beigesetzt in Kirche der Cordelières, Provins. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 379. | Marguerite von Navarra Notizen: Margarete und Friedrich III. hatten acht Kinder, fünf Söhne und drei Töchter. Marguerite heiratete Herzog Friedrich III. von Lothringen in 10 Jul1255. Friedrich (Sohn von Herzog Matthäus II. von Lothringen und Katherina von Limburg) wurde geboren in 1238; gestorben am 31 Dez 1302. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 380. |  Beatrix (Béatrice) von Champagne Beatrix (Béatrice) von Champagne Notizen: Beatrix und Hugo IV. hatten zehn Kinder. Namentlich bekannt sind vier Töchter und ein Sohn. Familie/Ehepartner: Herzog Hugo IV. von Burgund. Hugo (Sohn von Herzog Odo III. von Burgund und Alix von Vergy) wurde geboren am 9 Mrz 1212 in Villaines-en-Duesmois; gestorben am 27 Okt 1272. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 381. |  König Heinrich I. von Navarra (von Champagne) König Heinrich I. von Navarra (von Champagne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Mit seinem Tod erlosch die männliche Linie der Grafen der Champagne und Könige von Navarra. Heinrich heiratete Blanche von Artois in 1269 in Melun. Blanche (Tochter von Robert I. von Artois (von Frankreich) und Gräfin Mathilde von Brabant) wurde geboren in 1248; gestorben am 2 Mai 1302 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 382. |  Johann von Hennegau (von Avesnes) Johann von Hennegau (von Avesnes) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Avesnes Johann heiratete Adelheid von Holland in 1246. Adelheid (Tochter von Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) und Mathilde von Brabant) wurde geboren in cir 1230; gestorben in 1284. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 383. |  Jeanne (Johanna) von Dampierre Jeanne (Johanna) von Dampierre Notizen: Name: Jeanne heiratete Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois in 1243. Theobald (Sohn von Graf Heinrich II. von Bar-Scarponnois und Philippa von Dreux) wurde geboren in 1221; gestorben in 1291. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 384. |  Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_I._(Flandern) (Jun 2022) Guido heiratete Mathilde von Béthune in 1246. Mathilde (Tochter von Herr Robert VII. von Béthune und Elisabeth von Morialmez) gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
Guido heiratete Isabella von Luxemburg in 1264. Isabella (Tochter von Graf Heinrich V. von Limburg-Luxemburg, der Blonde und Herrin Margareta von Bar) wurde geboren in 1247; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 385. |  Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Laura von Lothringen in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 386. |  Herr Archambault VIII. von Dampierre (Bourbon) Herr Archambault VIII. von Dampierre (Bourbon) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Archambault_VIII. (Jul 2023) Archambault heiratete Béatrice de Montluçon in 1215. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 387. |  Guillaume II. (Wilhelm) von Dampierre Guillaume II. (Wilhelm) von Dampierre Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._von_Dampierre Guillaume heiratete Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze in 1223. Margarethe (Tochter von Kaiser Balduin I. von Konstantinopel (von Hennegau) und Kaiserin Marie von Champagne (Blois)) wurde geboren in 1202; gestorben in 1280; wurde beigesetzt in Abtei Flines. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 388. |  Marie von Dampierre Marie von Dampierre Marie heiratete Henri I. von Sully (von Blois) in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 389. |  Johanna von Burgund Johanna von Burgund Familie/Ehepartner: Graf Rudolf II. (Raoul) von Lusignan-Issoudun. Rudolf (Sohn von Graf Rudolf I. (Raoul) von Lusignan (von Eu) und Gräfin Alix von Eu (Rolloniden)) gestorben in 1246. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 390. |  Herzog Hugo IV. von Burgund Herzog Hugo IV. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_IV._(Burgund) Hugo heiratete Yolande von Dreux in 1229. Yolande (Tochter von Graf Robert III. von Dreux und Herrin Aénor von Saint-Valéry) wurde geboren in 1212; gestorben in 1248. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Beatrix (Béatrice) von Champagne. Beatrix (Tochter von Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger und Marguerite von Bourbon (von Dampierre)) wurde geboren in 1242; gestorben in 1294/1295. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 391. | Hugo von Chalon (Salins) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Chalon Hugo heiratete Adelheid von Meranien (von Andechs) in 1236. Adelheid (Tochter von Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) und Beatrix II. von Burgund (Staufern)) gestorben am 8 Mrz 1279 in Evian; wurde beigesetzt in Abtei Cherlieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 392. |  Beatrix von Savoyen Beatrix von Savoyen Beatrix heiratete König Manfred von Sizilien (Staufer) in 1248/1249. Manfred (Sohn von König Friedrich II. von Staufen und Bianca Lancia, die Jüngere ) wurde geboren in 1232 in Venosa; gestorben am 26 Feb 1266 in Benevent; wurde beigesetzt in Felsental am Fluss Garigliano. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 393. |  Johann I. (Jean) von Châtillon-Saint Pol Johann I. (Jean) von Châtillon-Saint Pol Notizen: Name: |
| 394. |  Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_II._(St._Pol) Guido heiratete Gräfin Mathilde von Brabant am cir Mai 1254 in Neapel, Italien. Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) und Marie von Schwaben (Staufer)) wurde geboren in 1224; gestorben am 29 Sep 1288; wurde beigesetzt in Abtei Cercamp. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 395. |  Herr Walter IV. (Gaucher) von Châtillon (Blois) Herr Walter IV. (Gaucher) von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 396. |  Herzog Matthäus II. von Lothringen Herzog Matthäus II. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthäus_II._(Lothringen) (Nov 2018) Matthäus heiratete Katherina von Limburg in 1225. Katherina (Tochter von Herzog Walram IV. von Limburg und Gräfin Ermesinde II. von Luxemburg) wurde geboren in 1215; gestorben am 18 Apr 1255. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 397. |  Herzogin Alix Berta von Lothringen Herzogin Alix Berta von Lothringen Notizen: urkundlich bezeugt. Familie/Ehepartner: Graf Werner von Kyburg (Kiburg). Werner (Sohn von Graf Ulrich III. von Kyburg und Anna von Zähringen) wurde geboren in cir 1180; gestorben in 1228 in Schlachtfeld vor Akkon, Israel; wurde beigesetzt in Jerusalem. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 398. |  Herrin Margareta von Bar Herrin Margareta von Bar Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Margareta heiratete Graf Heinrich V. von Limburg-Luxemburg, der Blonde in 1240. Heinrich (Sohn von Herzog Walram IV. von Limburg und Gräfin Ermesinde II. von Luxemburg) wurde geboren in 1216; gestorben am 24 Dez 1281 in Mainz - Worms. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 399. |  Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_II._(Bar) (Jun 2022) Theobald heiratete Jeanne (Johanna) von Dampierre in 1243. Jeanne (Tochter von Guillaume II. (Wilhelm) von Dampierre und Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze ) wurde geboren in 1224. [Familienblatt] [Familientafel] Theobald heiratete Jeanne von Toucy in nach 1231. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 400. |  Walram III. von Monschau (Haus Limburg) Walram III. von Monschau (Haus Limburg) Walram heiratete Gräfin Jutta von Ravensberg in 1251 oder vor 1251. Jutta (Tochter von Otto II. von Ravensberg und Sophie von Oldenburg) wurde geboren in cir 1223 oder cir 1231. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 401. |  Graf Heinrich I. von Vaudémont Graf Heinrich I. von Vaudémont Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Vaudémont) (Sep 2023) Heinrich heiratete Marguerite von La Roche in cir 1252. Marguerite (Tochter von Herzog von Athen Guy I. (Guido) von La Roche und Agnes von Bruyères) gestorben in nach 1293. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 402. |  König Ludwig IX. von Frankreich König Ludwig IX. von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IX._(Frankreich) Familie/Ehepartner: Königin Margarete von der Provence. Margarete (Tochter von Graf Raimund Berengar V. von der Provence und Beatrix von Savoyen) wurde geboren in 1221 in Brignoles; gestorben am 20 Dez 1295 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 403. |  Robert I. von Artois (von Frankreich) Robert I. von Artois (von Frankreich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_I._(Artois) Robert heiratete Gräfin Mathilde von Brabant am 14 Jun 1237 in Compiègne, Frankreich. Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) und Marie von Schwaben (Staufer)) wurde geboren in 1224; gestorben am 29 Sep 1288; wurde beigesetzt in Abtei Cercamp. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 404. |  Prinz Alfons von Frankreich (von Poitou) Prinz Alfons von Frankreich (von Poitou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_von_Poitiers (Aug 2023) Alfons heiratete Gräfin Johanna von Toulouse (Raimundiner) in 1241. Johanna (Tochter von Graf Raimund VII. von Toulouse (Raimundiner) und Sancha von Aragón) wurde geboren in 1220; gestorben am 20 Aug 1271 in Corneto, Siena. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 405. |  König Karl I. von Anjou (von Frankreich) König Karl I. von Anjou (von Frankreich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(Neapel) Karl heiratete Königin Beatrix von der Provence in cir 1245 in Aix. Beatrix (Tochter von Graf Raimund Berengar V. von der Provence und Beatrix von Savoyen) wurde geboren in 1231; gestorben in 1267. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 406. |  Gräfin Johanna von Dammartin (von Ponthieu) Gräfin Johanna von Dammartin (von Ponthieu) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johanna heiratete König Ferdinand III. von León (von Kastilien) am vor Aug 1237. Ferdinand (Sohn von König Alfons IX. von León (von Kastilien) und Königin Berenguela von Kastilien) wurde geboren in 30 Jul od 05 Aug 1199 in Zamora; gestorben am 30 Mai 1252 in Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 407. |  Marie de Dammartin (Haus Mello) Marie de Dammartin (Haus Mello) Marie heiratete Graf Jean II. (Johann) von Roucy (Pierrepont) in Datum unbekannt. Jean (Sohn von Robert I. de Pierrepont und Eustacie von Roucy) gestorben in 1251. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 408. |  Anna von Habsburg Anna von Habsburg Notizen: Anna und Hermann (III.) der Lange hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange in 1295. Hermann (Sohn von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) wurde geboren in cir 1275; gestorben am 1 Feb 1308 in bei Lübz; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 18 Mrz 1294; gestorben am 24 Nov 1335; wurde beigesetzt in Klarissenkloster, Breslau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 409. |  Agnes von Habsburg (von Ungarn) Agnes von Habsburg (von Ungarn) Notizen: Über Kinder von Agnes mit Andreas III. ist nichts bekannt. Agnes heiratete König Andreas III. von Ungarn (Árpáden), der Venezianer am 13 Feb 1296 in Wien. Andreas (Sohn von Prinz Stephan von Slowenien (von Ungarn) (Árpáden) und Katharina Morosini (Morossini)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 14 Jan 1301. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 410. |  Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Böhmen) Rudolf heiratete Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) in 1300. Blanka (Tochter von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in cir 1285 in Paris, France; gestorben am 1 Mrz 1305 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen am 16 Okt 1306. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 411. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nancy und Friedrich IV. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Elisabeth heiratete Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur in 1307 in Nancy, FR. Friedrich (Sohn von Herzog Theobald II. von Lothringen und Isabelle de Rumigny) wurde geboren am 15 Apr 1282 in Gondreville; gestorben am 23 Aug 1328 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 412. |  Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Österreich) (Mai 2018) Albrecht heiratete Herzogin Johanna von Pfirt am 26 Mrz 1324 in Wien. Johanna (Tochter von Ulrich von Pfirt und Prinzessin Johanna von Mömpelgard) wurde geboren in 1300 in Basel, BS, Schweiz; gestorben am 15 Nov 1351 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 413. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(Habsburg) Leopold heiratete Prinzessin Katharina von Savoyen am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Katharina (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in zw 1297 und 1304 in Brabant; gestorben am 30 Sep 1336 in Rheinfelden, AG, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann 1770 Dom St. Blasien, dann 1806 Stift Spital Phyrn, dann 1809 Stiftskirchengruft Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 414. | Elisabeth von Kärnten Notizen: Elisabeth und Peter II. hatten neun Kinder, sechs Töchter und drei Söhne. Elisabeth heiratete König Peter II. von Aragón (von Sizilien) am 23 Apr 1223. Peter (Sohn von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1305; gestorben in Aug 1342 in Calascibetta. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 415. |  Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ Notizen: Margarete und Johann Heinrich hatten keine Kinder. Margarete heiratete Markgraf Johann Heinrich von Luxemburg am 16 Sep 1330 in Innsbruck, Österreich, und geschieden in 1349. Johann wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechien ; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) am 10 Feb 1342 in Schloss Tirol. Ludwig (Sohn von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Beatrix von Schlesien-Schweidnitz) wurde geboren in Mai 1315; gestorben am 18 Sep 1361 in Zorneding bei München. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 416. |  Elisabeth von Weimar-Orlamünde (Askanier), die Ältere Elisabeth von Weimar-Orlamünde (Askanier), die Ältere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth und Hartmann hatten eine Tochter. Familie/Ehepartner: Hartmann von Lobdeburg-Arnshaugk. Hartmann gestorben am 20 Feb 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
Elisabeth heiratete Albrecht II. von Meissen (Wettiner) in 1290. Albrecht (Sohn von Markgraf Heinrich III. von Meissen (Wettiner) und Constantia von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in 1240; gestorben am 13 Nov 1314 in Erfurt, Thüringen, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 417. |  Graf Hermann IV. von Weimar-Orlamünde Graf Hermann IV. von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Hermann heiratete Mechthild von Rabenswalde in 1290. Mechthild gestorben in 1315. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 418. |  Graf Ulrich von Truhendingen Graf Ulrich von Truhendingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Imagina von Limburg. Imagina (Tochter von Johann I. von Limburg und Elisabeth von Geroldseck (Hohengeroldseck)) gestorben in spätestens 1337. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 419. |  Gräfin Johanna II. von Burgund Gräfin Johanna II. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna und Philipp hatten sechs oder sieben Kinder, vier oder fünf Töchter und zwei Söhne. Johanna heiratete König Philipp V. von Frankreich in Jan 1307. Philipp (Sohn von König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne und Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne)) wurde geboren am 17 Nov 1293; gestorben am 3 Jan 1322 in Abtei Longchamp. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 420. |  Othenin von Mömpelgard (Montbéliard) Othenin von Mömpelgard (Montbéliard) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 421. |  Gräfin Agnes von Mömpelgard (Montbéliard) Gräfin Agnes von Mömpelgard (Montbéliard) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Heinrich I. (Henri) von Montfaucon-Mömpelgard (Montbéliard). Heinrich (Sohn von Walter II. (Gauthier) von Montfaucon-Mömpelgard (Montbéliard) und Herrin Mathilde (Mahaut) de Lamarche (de Chaussin)) gestorben in 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 422. |  Jeanna von Mömpelgard (Montbéliard) Jeanna von Mömpelgard (Montbéliard) |
| 423. |  Margarita von Mömpelgard (Montbéliard) Margarita von Mömpelgard (Montbéliard) |
| 424. |  Alix von Montaigu (Mömpelgard, Montbéliard) Alix von Montaigu (Mömpelgard, Montbéliard) |
| 425. |  Anna von Kyburg (von Thun und Burgdorf) Anna von Kyburg (von Thun und Burgdorf) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Kyburg_(Adelsgeschlecht) Anna heiratete Eberhard I. von Habsburg-Laufenburg in 1273. Eberhard (Sohn von Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame und Gertrud von Regensberg) wurde geboren in cir 1249; gestorben in cir 1284. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 426. |  Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Heinrich I. von Hessen (* 24. Juni 1244; † 21. Dezember 1308 in Marburg) war erster Landgraf von Hessen und Begründer des hessischen Fürstenhauses. Heinrich heiratete Adelheid von Lüneburg (von Braunschweig) am 10 Sep 1263. Adelheid (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) gestorben am 12 Jun 1274 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Mechtild von Kleve in cir 1275. Mechtild (Tochter von Graf Dietrich V. (VII.) von Kleve und Aleidis (Alheidis) von Heinsberg (Haus Sponheim)) gestorben am 21 Dez 1309. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 427. |  Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth heiratete Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große am 13 Jul 1254. Albrecht (Sohn von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1236; gestorben am 15 Aug 1279. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 428. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Kunigunde hatte mit Ottokar II. wahrscheinlich sechs Kinder. Kunigunde heiratete Zawisch von Krumau (von Falkenstein) (Witigonen) in Mai 1285. Zawisch (Sohn von Budiwoj von Krumau (Witigonen) und Perchta von Falkenstein) wurde geboren in cir 1250; gestorben am 24 Aug 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
Kunigunde heiratete König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) in Okt 1261 in Burg Pozsony (heute Bratislava). Ottokar (Sohn von König Wenzel I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde (Cunegundis) von Schwaben (Staufer)) wurde geboren in cir 1232 in Městec Králové, Tschechien; gestorben am 26 Aug 1278 in Dürnkrut, in Niederösterreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 429. |  König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto III. von Bayern (* 11. Februar 1261; † 9. September 1312 in Landshut) stammte aus dem Geschlecht der Wittelsbacher. Er war von 1290 bis 1312 Herzog von Niederbayern und als Béla V. von 1305 bis 1307 ungarischer König. Otto heiratete Katharina von Habsburg in cir 1279 in Wien. Katharina (Tochter von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in cir 1256 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 4 Apr 1282 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Kloster Seligenthal bei Landshut. [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Herzogin Agnes von Glogau am 18 Mai 1309. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in zw 1293 und 1296; gestorben am 25 Dez 1361 in Selingenthal; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 430. | Maria von Ungarn Notizen: Maria und Karl II. hatten 14 Kinder, neun Söhne und fünf Töchter. Maria heiratete Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme in 1270. Karl (Sohn von König Karl I. von Anjou (von Frankreich) und Königin Beatrix von der Provence) wurde geboren in 1254; gestorben am 6 Mai 1309 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 431. |  Anna von Ungarn Anna von Ungarn Notizen: Anna und Andronikos II. hatten zwei Söhne. Anna heiratete Andronikos II. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) in 1273. Andronikos (Sohn von Kaiser Michael VIII. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) und Theodora Dukaina Komnene Palaiologina Batatzaina (Byzanz)) wurde geboren am 25 Mrz 1259 in Nikaia; gestorben am 13 Feb 1332 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 432. |  König Ladislaus IV. von Ungarn (Árpáden), der Kumane König Ladislaus IV. von Ungarn (Árpáden), der Kumane Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_IV. Ladislaus heiratete Isabella (Elisabeth) von Anjou (von Frankreich) in 1270. Isabella (Tochter von König Karl I. von Anjou (von Frankreich) und Königin Beatrix von der Provence) wurde geboren in 1261; gestorben in 1304. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 433. | Elisabeth von Kalisch Notizen: Elisabeth und Heinrich V. hatten drei Söhne und fünf Töchter. Elisabeth heiratete Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) in 1277. Heinrich (Sohn von Herzog Boleslaw II. von Schlesien (Piasten) und Hedwig von Anhalt) wurde geboren in cir 1248; gestorben am 22 Feb 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 434. | Herzogin Hedwig von Kalisch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Hedwig und Władysław I. hatten sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne. Hedwig heiratete König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang am 6 Jan 1293. Władysław (Sohn von Kasimir I. von Kujawien (von Masowien) (Piasten) und Euphrosyne von Oppeln (von Ratibor)) wurde geboren in 1260; gestorben am 2 Mrz 1333 in Krakau, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 435. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(Schlesien) Heinrich heiratete Elisabeth von Kalisch in 1277. Elisabeth (Tochter von Bolesław VI. von Kalisch (Piasten), der Fromme und Prinzessin Jolanta Helena von Ungarn (Árpáden)) gestorben in 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 436. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bolko_I._(Schweidnitz) (Apr 2018) Bolko heiratete Beatrix von Brandenburg in 1286. Beatrix (Tochter von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Katharina von Polen) gestorben in 1316. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 437. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Schlesien-Liegnitz Agnes heiratete Graf Ulrich I. von Württemberg in nach 1259. Ulrich (Sohn von Graf Ludwig von Württemberg und von Kyburg (Kiburg)) wurde geboren in 1226; gestorben am 25 Feb 1265. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 438. | Constanze von Polen (Piasten) Familie/Ehepartner: Markgraf Konrad I. von Brandenburg (Askanier). Konrad (Sohn von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Sophia von Dänemark) wurde geboren in cir 1240; gestorben in 1304; wurde beigesetzt in Kloster Chorin. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 439. |  Przemysł II. von Polen Przemysł II. von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Przemysł_II. Przemysł heiratete Richiza (Rixa) von Schweden am 11 Okt 1285. Richiza (Tochter von König Waldemar (Valdemar) von Schweden und Sophia von Dänemark) wurde geboren in cir 1265; gestorben in 1291. [Familienblatt] [Familientafel]
Przemysł heiratete Ludgarda von Mecklenburg in Jul 1273. Ludgarda wurde geboren in cir 1260; gestorben in Dez 1283. [Familienblatt] [Familientafel] Przemysł heiratete Margarete von Brandenburg in 1291. Margarete (Tochter von Markgraf Albrecht III. von Brandenburg und Mathilde von Dänemark) wurde geboren in cir 1270; gestorben in 1315. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 440. |  Herzog Heinrich III. von Glogau Herzog Heinrich III. von Glogau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Glogau) Heinrich heiratete Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1290. Mechthild (Tochter von Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große und Adelaide (Alessina) von Montferrat) wurde geboren in 1276; gestorben in 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 441. |  Anna von Glogau (von Schlesien) (Piasten) Anna von Glogau (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Anna hatte mit Ludwig II. drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 24 Aug 1260 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 442. |  Herr Heinrich von Hohenlohe-Wernsberg Herr Heinrich von Hohenlohe-Wernsberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 443. |  Domherr Heinrich V. von Henneberg Domherr Heinrich V. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beruf / Beschäftigung: |
| 444. |  Graf Poppo X. von Henneberg-Hartenberg Graf Poppo X. von Henneberg-Hartenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Elisabeth? von Castell. Elisabeth? gestorben in 1315. [Familienblatt] [Familientafel] Poppo heiratete Richza (Richtz) von Hohenlohe-Weikersheim in vor 6 Nov 1316. Richza (Tochter von Herr Kraft I. von Hohenlohe-Weikersheim und Margarethe von Truhendingen) wurde geboren in vor 1305; gestorben in 4 Feb / 28 Apr 1337; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 445. |  Berthold IX. von Henneberg Berthold IX. von Henneberg |
| 446. |  Elisabeth von Henneberg Elisabeth von Henneberg |
| 447. |  Sophie von Henneberg Sophie von Henneberg |
| 448. |  Adelheid von Henneberg Adelheid von Henneberg |
| 449. |  Kunigunde von Henneberg Kunigunde von Henneberg |
| 450. |  Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_VII. Berthold heiratete Adelheid von Hessen in 1284. Adelheid (Tochter von Heinrich I. von Hessen (von Brabant) und Adelheid von Lüneburg (von Braunschweig)) wurde geboren in 1268; gestorben in 1317. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 451. |  Graf Hermann III. von Henneberg-Aschach Graf Hermann III. von Henneberg-Aschach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Katharina von Schlesien-Glogau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 452. |  Heinrich VI. von Henneberg-Aschach Heinrich VI. von Henneberg-Aschach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Heinrich heiratete Gräfin Sophia von Schwarzburg-Blankenburg in vor 3 Mrz 1315. Sophia (Tochter von Günther VIII. von Schwarzburg-Käfernburg (Kevernburg) und Irmgard von Schwarzburg-Schwarzburg) gestorben am 4 Mrz 1358. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 453. |  Berthold VIII. von Henneberg-Aschach Berthold VIII. von Henneberg-Aschach |
| 454. |  Poppo IX. von Henneberg-Aschach Poppo IX. von Henneberg-Aschach |
| 455. |  Elisabeth von Henneberg-Aschach Elisabeth von Henneberg-Aschach |
| 456. |  Hermann von Henneberg-Aschach Hermann von Henneberg-Aschach |
| 457. |  Liutgard von Holstein Liutgard von Holstein Familie/Ehepartner: Fürst Albrecht I. von Anhalt-Köthen (Askanier). Albrecht (Sohn von Fürst Siegfried I von Anhalt (von Köthen) (Askanier) und Katharina Birgersdottir von Schweden) gestorben in 1316. [Familienblatt] [Familientafel] Liutgard heiratete Herzog Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1265. Johann (Sohn von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in cir 1242; gestorben am 13 Dez 1277; wurde beigesetzt in Kloster St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 458. |  Graf Gerhard II. von Holstein (von Plön), der Blinde Graf Gerhard II. von Holstein (von Plön), der Blinde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_II._(Holstein-Plön) (Jul 2023) Gerhard heiratete Prinzessin Ingeborg von Schweden am 12 Dez 1275. Ingeborg (Tochter von König Waldemar (Valdemar) von Schweden und Sophia von Dänemark) wurde geboren in cir 1262; gestorben in ca 1290/1293. [Familienblatt] [Familientafel]
Gerhard heiratete Agnes (Agnete) von Brandenburg in 1293. Agnes (Tochter von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren in 1257; gestorben am 29 Sep 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 459. |  Graf Adolf VI. von Schauenburg-Holstein (Pinneberg) Graf Adolf VI. von Schauenburg-Holstein (Pinneberg) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_VI._(Holstein-Schauenburg) Adolf heiratete Helena von Sachsen-Lauenburg (Askanier) in vor 14 Feb 1294. Helena (Tochter von Johann I. von Sachsen-Lauenburg (Askanier) und Ingeborg (Ingeburg) Birgersdottir von Schweden) gestorben in nach 13 Sep 1337; wurde beigesetzt in Kloster Loccum. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 460. |  Graf Heinrich I. von Holstein-Rendsburg Graf Heinrich I. von Holstein-Rendsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Holstein-Rendsburg) (Aug 2023) Heinrich heiratete Heilwig van Bronckhorst in 1289. Heilwig (Tochter von Herr Willem van Bronckhorst und Irmgard van Randerode) wurde geboren in nach 1265; gestorben in 1331. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 461. |  Königin von Schweden Helvig (Hedwig) von Holstein Königin von Schweden Helvig (Hedwig) von Holstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Helvig_von_Holstein (Aug 2023) Helvig heiratete König Magnus I. (Ladulås) von Schweden in 1276. Magnus (Sohn von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in 1240; gestorben am 18 Dez 1290 in Insel Visingsö, Vättern; wurde beigesetzt in Riddarholmskirche, Stockholm. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 462. |  Herr Heinrich II. von Mecklenburg Herr Heinrich II. von Mecklenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Mecklenburg) (Jun 2021) Heinrich heiratete Beatrix von Brandenburg in 1292 in Burg Stargard. Beatrix (Tochter von Markgraf Albrecht III. von Brandenburg und Mathilde von Dänemark) gestorben am 22 Sep 1314 in Wismar. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Anna zu Sachsen-Wittenberg in nach 6 Jul 1315. Anna gestorben in zw 25 Jun 1327 und 9 Aug 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Agnes von Lindow-Ruppin. Agnes (Tochter von Graf Günther ? von Lindow-Ruppin) wurde geboren in cir 1300; gestorben am 9 Mai 1343 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 463. |  Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_(Brandenburg) Hermann heiratete Anna von Habsburg in 1295. Anna (Tochter von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1275/80; gestorben in 1326, 1327 oder 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 464. |  Jutta (Brigitte) von Brandenburg Jutta (Brigitte) von Brandenburg Notizen: Geburt: Jutta heiratete Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1298. Rudolf (Sohn von Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg) wurde geboren in 1284 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; gestorben am 12 Mrz 1356 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; wurde beigesetzt in Schlosskirche, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 465. |  Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere Familie/Ehepartner: Luitgard von Burgau. Luitgard (Tochter von Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) und Adelheid von Württemberg) wurde geboren in vor 1260; gestorben in vor 13 Mai 1295. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 466. |  Simon von Teck Simon von Teck Familie/Ehepartner: Agnes von Helfenstein. Agnes (Tochter von Graf Ulrich III. von Helfenstein und Adelheid von Graisbach) gestorben in 1335/36. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 467. |  Herr Rudolf III. von Neuenburg-Nidau Herr Rudolf III. von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Imier de Neuchâtel-Strassberg, (? - 03 mai 1364), comte de Strassberg. Conseiller du duc d'Autriche. Accablé de dettes il vend en 1327 son domaine de Balm à Rodolphe III de Neuchâtel-Nidau, puis quelque temps avant son décès il cède Büren à Rodolphe IV de Neuchâtel-Nidau. Familie/Ehepartner: Jonata von Neuenburg. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Verena (Varenne) von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont). Verena (Tochter von Herr Thiébaud IV. von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) und Agnes von Geroldseck am Wasichen (Ès-Vosges)) gestorben in 1372. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Gräfin Jeanne von Habsburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 468. | Propst Hartmann von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 469. |  Gertrude von Neuenburg-Strassberg Gertrude von Neuenburg-Strassberg Familie/Ehepartner: Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau. Rudolf (Sohn von Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau und Richenza) gestorben in 1308/1309. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 470. |  Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Marguerite von Freiburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 471. |  Gräfin Agnes von Aarberg-Aarberg Gräfin Agnes von Aarberg-Aarberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Walram II. (I.) von Thierstein-Pfeffingen. Walram (Sohn von Pfalzgraf Ulrich von Thierstein-Pfeffingen und von Geroldseck am Wasichen ?) gestorben in spätestens 1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 472. |  Graf Friedrich III. von Toggenburg Graf Friedrich III. von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Klementa von Werdenberg. Klementa (Tochter von Graf Rudolf I. von Montfort-Werdenberg und Klementa von Kyburg) gestorben am 28 Feb 1282; wurde beigesetzt in Töss. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 473. |  Gertrud von Regensberg Gertrud von Regensberg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Regensberg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame . Rudolf (Sohn von Rudolf II. von Habsburg, der Gütige und Agnes von Staufen) gestorben in 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Albrecht von Griessenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 474. |  Adelheid von Regensberg Adelheid von Regensberg Notizen: Freiin Familie/Ehepartner: Ulrich von Altenklingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 475. |  Uta von Zweibrücken Uta von Zweibrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere . Konrad (Sohn von Herzog Konrad I. von Teck und von Henneberg) wurde geboren in cir 1235; gestorben am 1 Mai 1292 in Frankfurt am Main, DE; wurde beigesetzt in Marienkirche, Owen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 476. |  Gräfin Agnes von Veldenz Gräfin Agnes von Veldenz Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Veldenz Familie/Ehepartner: Heinrich von Geroldseck (Hohengeroldseck). Heinrich (Sohn von Walter II. von Geroldseck (Hohengeroldseck) und Heilika von Finstingen) gestorben in 1294. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 477. |  Guota (Imagina) von Ochsenstein Guota (Imagina) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Donat von Vaz. Donat (Sohn von Walter V. von Vaz und Luitgard (Liukarda) von Kirchberg) gestorben am 23 Apr 1337/38 in Churwalden, GR, Schweiz; wurde beigesetzt in Churwalden, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 478. |  Simon II. von Sponheim-Kreuznach Simon II. von Sponheim-Kreuznach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_II._(Sponheim-Kreuznach) Simon heiratete Elisabeth von Valkenburg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 479. |  Anna von Habsburg Anna von Habsburg Notizen: Anna und Hermann (III.) der Lange hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange in 1295. Hermann (Sohn von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) wurde geboren in cir 1275; gestorben am 1 Feb 1308 in bei Lübz; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 18 Mrz 1294; gestorben am 24 Nov 1335; wurde beigesetzt in Klarissenkloster, Breslau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 480. |  Agnes von Habsburg (von Ungarn) Agnes von Habsburg (von Ungarn) Notizen: Über Kinder von Agnes mit Andreas III. ist nichts bekannt. Agnes heiratete König Andreas III. von Ungarn (Árpáden), der Venezianer am 13 Feb 1296 in Wien. Andreas (Sohn von Prinz Stephan von Slowenien (von Ungarn) (Árpáden) und Katharina Morosini (Morossini)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 14 Jan 1301. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 481. |  Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Böhmen) Rudolf heiratete Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) in 1300. Blanka (Tochter von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in cir 1285 in Paris, France; gestorben am 1 Mrz 1305 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen am 16 Okt 1306. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 482. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nancy und Friedrich IV. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Elisabeth heiratete Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur in 1307 in Nancy, FR. Friedrich (Sohn von Herzog Theobald II. von Lothringen und Isabelle de Rumigny) wurde geboren am 15 Apr 1282 in Gondreville; gestorben am 23 Aug 1328 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 483. |  Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Österreich) (Mai 2018) Albrecht heiratete Herzogin Johanna von Pfirt am 26 Mrz 1324 in Wien. Johanna (Tochter von Ulrich von Pfirt und Prinzessin Johanna von Mömpelgard) wurde geboren in 1300 in Basel, BS, Schweiz; gestorben am 15 Nov 1351 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 484. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(Habsburg) Leopold heiratete Prinzessin Katharina von Savoyen am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Katharina (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in zw 1297 und 1304 in Brabant; gestorben am 30 Sep 1336 in Rheinfelden, AG, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann 1770 Dom St. Blasien, dann 1806 Stift Spital Phyrn, dann 1809 Stiftskirchengruft Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 485. | Elisabeth von Kärnten Notizen: Elisabeth und Peter II. hatten neun Kinder, sechs Töchter und drei Söhne. Elisabeth heiratete König Peter II. von Aragón (von Sizilien) am 23 Apr 1223. Peter (Sohn von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1305; gestorben in Aug 1342 in Calascibetta. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 486. |  Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ Notizen: Margarete und Johann Heinrich hatten keine Kinder. Margarete heiratete Markgraf Johann Heinrich von Luxemburg am 16 Sep 1330 in Innsbruck, Österreich, und geschieden in 1349. Johann wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechien ; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) am 10 Feb 1342 in Schloss Tirol. Ludwig (Sohn von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Beatrix von Schlesien-Schweidnitz) wurde geboren in Mai 1315; gestorben am 18 Sep 1361 in Zorneding bei München. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 487. |  Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Herzogin Anna von Teck in cir 1260. Anna (Tochter von Herzog Ludwig II. von Teck, der Jüngere und Luitgard von Burgau) wurde geboren in cir 1240 in Teck, Owen, DE; gestorben in 1270 in Eichelberg, Östringen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 488. |  Graf Diepold II. von Aichelberg Graf Diepold II. von Aichelberg Notizen: Name: Diepold heiratete Gräfin Agnes von Rechberg in Datum unbekannt. Agnes wurde geboren in 1270 in Rechberg, Schwäbisch Gmünd, DE . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 489. |  Rudolf III. von Werdenberg-Sargans Rudolf III. von Werdenberg-Sargans Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberg_(Adelsgeschlecht)#Grafen_von_Werdenberg-Sargans Familie/Ehepartner: Ursula von Vaz. Ursula (Tochter von Donat von Vaz und Guota (Imagina) von Ochsenstein) gestorben am 4 Apr 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 490. |  Markgraf Heinrich III. von Burgau Markgraf Heinrich III. von Burgau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._von_Burgau |
| 491. |  Elisabeth von Montfort Elisabeth von Montfort Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Montfort_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Eberhard Truchsess von Waldburg. Eberhard (Sohn von Otto Bertold Truchsess von Waldburg) gestorben am 30 Dez 1291. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 492. |  Graf Hugo IV. von Montfort zu Feldkirch Graf Hugo IV. von Montfort zu Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Anna von Veringen. Anna (Tochter von Graf Heinrich von Veringen (von Altveringen) und Verena von Klingen) wurde geboren in cir 1278; gestorben in 1320 in Neuburg, Oesterreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 493. |  Bischof Rudolf III. von Montfort-Feldkirch Bischof Rudolf III. von Montfort-Feldkirch Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._von_Montfort |
| 494. |  Ulrich II. von Montfort-Feldkirch Ulrich II. von Montfort-Feldkirch |
| 495. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto wurde um 1278 als ältester Sohn des Grafen Dietrich VI. von Kleve und dessen erster Ehefrau Margarethe von Geldern, einer Tochter Graf Ottos von Geldern geboren. Seit 1297 wird er als Junggraf von Kleve erwähnt und trat schließlich die Nachfolge seines am 4. Oktober 1305 verstorbenen Vaters an. Dabei hatte er sich mit den Ansprüchen seiner Stiefmutter Margareta von Neu-Kyburg und seiner Halbbrüder Dietrich und Johann auseinanderzusetzen. Otto heiratete Mechtild von Virneburg in 1308. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 496. |  Margarethe von Geldern Margarethe von Geldern Notizen: Name: Margarethe heiratete Graf Dietrich VIII. (IX.) von Kleve am 7 Mai 1308. Dietrich (Sohn von Dietrich VI. (VIII.) von Kleve und Margareta von Neu-Kyburg) gestorben am 7 Jul 1347. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 497. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Jülich) Wilhelm heiratete Johanna von Avesnes (von Holland) in 1324. Johanna (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in 1315; gestorben in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 498. | Marie heiratete Heinrich II. von Virneburg in Datum unbekannt. Heinrich gestorben in 1338. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Graf Dietrich VIII. (IX.) von Kleve in Datum unbekannt. Dietrich (Sohn von Dietrich VI. (VIII.) von Kleve und Margareta von Neu-Kyburg) gestorben am 7 Jul 1347. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Konrad II. von Saffenberg in Datum unbekannt. Konrad gestorben in nach 17 Sep 1377. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 499. | Elisabeth heiratete Johann II. (III.?) von Sayn in Datum unbekannt. Johann gestorben in 1359. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Gottfried V. von Hatzfeld in Datum unbekannt. Gottfried gestorben in 1371. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 500. |  Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen Notizen: Graf Wilhelm I. von Katzenelnbogen (* 1270 oder 1271; † 18. November 1331) war Graf von Katzenelnbogen aus der älteren Linie der Familie. Sein Vater war Diether V. von Katzenelnbogen, seine Mutter Margarete von Jülich († 1292), Tochter aus der gleichnamigen, einflussreichen Adelsfamilie. Wilhelm heiratete Irmgard (Jutta) von Isenburg-Büdingen in 1284. Irmgard gestorben in 1309. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Waldeck. Adelheid (Tochter von Graf Otto I von Waldeck und Sophie von Hessen) gestorben am 1 Sep 1329; wurde beigesetzt in Stiftskirche St, Goar. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 501. |  Diether VI. von Katzenelnbogen Diether VI. von Katzenelnbogen Notizen: Gestorben: Diether heiratete Katharina von Kleve in vor 1308. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 502. |  Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Sponheim-Starkenburg) Johann heiratete Katharina von Ochsenstein in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 503. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Arnsberg) Wilhelm heiratete Beatrix von Rietberg in 1296. Beatrix (Tochter von Graf Konrad II. von Rietberg und Mechthild) gestorben in 1328/1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 504. |  Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Florens_V._(Holland) Florens heiratete Beatrix (Béatrice) von Flandern (von Dampierre) in 1268/1269. Beatrix (Tochter von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Mathilde von Béthune) wurde geboren in 1253/1254; gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 505. |  Graf Johann II. (Jean) von Avesnes Graf Johann II. (Jean) von Avesnes Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Holland) Johann heiratete Philippa von Luxemburg in cir 1270. Philippa (Tochter von Graf Heinrich V. von Limburg-Luxemburg, der Blonde und Herrin Margareta von Bar) wurde geboren in 1252; gestorben am 6 Apr 1311. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 506. |  Graf Poppo VIII. von von Henneberg-Coburg Graf Poppo VIII. von von Henneberg-Coburg |
| 507. |  Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg Familie/Ehepartner: Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange . Otto (Sohn von Markgraf Otto III. von Brandenburg (Askanier), der Fromme und Beatrix (Božena) von Böhmen) wurde geboren in cir 1246; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 508. |  Sophie von Hessen Sophie von Hessen Notizen: Name: Sophie heiratete Graf Otto I von Waldeck in cir 1275. Otto gestorben in Nov 1305; wurde beigesetzt in Grabkapelle St. Nikolaus, Kloster Marienthal, Netze, Waldeck, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 509. |  Heinrich von Hessen Heinrich von Hessen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzogin Agnes von Bayern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 510. |  Adelheid von Hessen Adelheid von Hessen Notizen: Name: Adelheid heiratete Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen in 1284. Berthold (Sohn von Graf Berthold V. von Henneberg-Schleusingen und Sophia von Schwarzburg-Blankenburg) wurde geboren in 1272 in Schleusingen, Thüringen; gestorben am 13 Apr 1340 in Schleusingen, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 511. |  Otto I von Hessen Otto I von Hessen Notizen: Otto I. (* um 1272; † 17. Januar 1328 in Kassel) war ein Sohn des Landgrafen Heinrich I. von Hessen und dessen Gemahlin Adelheid von Braunschweig. Familie/Ehepartner: Adelheid von Ravensberg. Adelheid (Tochter von Graf Otto III. von Ravensberg und Hedwig von der Lippe) wurde geboren in cir 1270; gestorben in nach 3 Apr 1338. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 512. |  Herr Nikolaus II. zu Werle Herr Nikolaus II. zu Werle Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_II._(Werle) (Jun 2021) Nikolaus heiratete Richsa von Dänemark in 1292. Richsa (Tochter von König Erik V. von Dänemark, Klipping und Agnes (Agnete) von Brandenburg) gestorben in vor 27 Okt 1308. [Familienblatt] [Familientafel]
Nikolaus heiratete Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in nach 1308. Mathilde (Tochter von Fürst Otto II. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) und Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher)) gestorben in 1316. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 513. |  Herr Johann II. von Werle-Güstrow Herr Johann II. von Werle-Güstrow Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Werle) (Jun 2021) Johann heiratete Mathilde (Mechthild) von Braunschweig in 1311. Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) gestorben in 1333/1344. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 514. |  Herzogin Rixa von Werle Herzogin Rixa von Werle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rixa_von_Werle (Jun 2021) Rixa heiratete Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen), der Fette in 1284. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große und Adelaide (Alessina) von Montferrat) wurde geboren in cir 1268; gestorben am 22 Sep 1318; wurde beigesetzt in Braunschweiger Dom (Blasius-Kirche), Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 515. |  Mathilde von Anhalt-Zerbst Mathilde von Anhalt-Zerbst Mathilde heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in 1339. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 516. | Euphemia von Schlesien (Piasten) Euphemia heiratete Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) in 1297. Otto (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 25 Mai 1310. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 517. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bolesław_III._(Schlesien) Bolesław heiratete Margarethe von Böhmen in vor 13 Jan 1303. Margarethe (Tochter von König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) und Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg) gestorben in 1322. [Familienblatt] [Familientafel]
Bolesław heiratete Fürstin Katharina Šubić in 1326. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 518. | Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(Schlesien) (Okt 2017) Heinrich heiratete Anna von Habsburg in 1310. Anna (Tochter von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1275/80; gestorben in 1326, 1327 oder 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 519. | Herzog Bernhard II. von Schweidnitz Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_II._(Schweidnitz) Bernhard heiratete Kunigunde von Polen in cir 1310. Kunigunde (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in cir 1293; gestorben in 1333/1335. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 520. |  Beatrix von Schlesien-Schweidnitz Beatrix von Schlesien-Schweidnitz Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix hatte mit Ludwig IV. sechs Kinder wovon drei das Erwachsenenalter erreichten: Mechthild, Ludwig V. und Stephan II. Beatrix heiratete Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer in cir 1308. Ludwig (Sohn von Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge und Mathilde von Habsburg) wurde geboren am 1282 oder 1286 in München, Bayern, DE; gestorben am 11 Okt 1347 in Puch bei Fürstenfeldbruck; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 521. |  Graf Eberhard I. von Württemberg Graf Eberhard I. von Württemberg Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Eberhard_I,_Count_of_W%C3%BCrttemberg Familie/Ehepartner: (von Werdenberg?) oder (von Teck?). [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Margarethe von Lothringen. Margarethe (Tochter von Herzog Friedrich III. von Lothringen und Marguerite von Navarra) gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
Eberhard heiratete Markgräfin Irmengard von Baden am 21 Jun 1296. Irmengard (Tochter von Markgraf Rudolf I von Baden und Kunigunde von Eberstein) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 8 Feb 1320. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 522. |  Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf,_Count_Palatine_of_the_Rhine Adolf heiratete Prinzessin Irmengard von Oettingen in 1320. Irmengard (Tochter von Graf Ludwig VI. von Oettingen und Agnes von Württemberg) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 6 Nov 1389. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 523. |  Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Johann III. von Sponheim-Starkenburg in 1331. Johann (Sohn von Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg und Gräfin Loretta von Salm) wurde geboren in 1315; gestorben am 20 Dez 1398; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 524. |  Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde heiratete Herr Nikolaus II. zu Werle in nach 1308. Nikolaus (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in vor 1275; gestorben am 18 Feb 1316 in Pustow (Pustekow). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 525. |  Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia heiratete Herzog Magnus I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen) in 1327. Magnus (Sohn von Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen), der Fette und Herzogin Rixa von Werle) wurde geboren in 1304; gestorben in 1369. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 526. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Grubenhagen. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in cir 1289; gestorben in 1351. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 527. |  Mathilde (Mechthild) von Bayern Mathilde (Mechthild) von Bayern Notizen: Mathilde und Friedrich II. hatten neun Kinder, vier Töchter und fünf Söhne. Mathilde heiratete Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) in 1328 in Nürnberg, Bayern, DE. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) und Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk) wurde geboren am 30 Nov 1310 in Gotha; gestorben am 19 Nov 1349 in Wartburg, Thüringen, DE; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 528. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_V._(Bayern) Ludwig heiratete Margarete von Dänemark am 30 Nov 1324 in Königreich Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ am 10 Feb 1342 in Schloss Tirol. Margarete (Tochter von Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) und Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen)) wurde geboren in 1318 in Grafschaft Tirol; gestorben am 3 Okt 1369 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 529. |  Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stephan mit der Hafte (* 1319; † Mai 1375 in Landshut oder München) war von 1347 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Er war der zweite Sohn Kaiser Ludwigs des Bayern aus dessen erster Ehe mit Beatrix von Schlesien-Schweidnitz. Stephan heiratete Prinzessin Elisabeth (Isabel) von Sizilien (von Aragôn) am 27 Jun 1328 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 21 Mrz 1349 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Stephan heiratete Margarete von Nürnberg in 14 Feb1359 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 530. | Kurfürst Ludwig VI. von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VI._(Bayern) |
| 531. |  Gräfin Elisabeth von Bayern Gräfin Elisabeth von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Bayern_(1329–1402) (Jun 2018) Elisabeth heiratete Herr von Verona Cangrande II. della Scala (Scaliger) am 22 Nov 1350. Cangrande (Sohn von Herr Mastino II. della Scala (Scaliger) und Taddea von Carrara) wurde geboren am 7 Jun 1332; gestorben am 14 Dez 1359 in Verona; wurde beigesetzt in Scalinger-Grabmäler, Verona. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Ulrich von Württemberg in 1362. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner und Elisabeth von Henneberg-Schleusingen) wurde geboren in nach 1340; gestorben am 23 Aug 1388. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 532. |  Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Bayern) Albrecht heiratete Margarete von Liegnitz-Brieg am 19 Jul 1353 in Passau. Margarete (Tochter von Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg und Agnes von Glogau-Sagan) wurde geboren in 1342/43; gestorben in 1386. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 533. |  Agnes von Bayern Agnes von Bayern Familie/Ehepartner: Heinrich IV. von Ortenburg. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich III. von Ortenburg und Sophie von Henneberg-Aschach) gestorben am 8 Apr 1395. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 534. |  Dietrich (Diderik) von Isenberg (von Altena) Dietrich (Diderik) von Isenberg (von Altena) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Altena-Isenberg Dietrich heiratete Adelheid von Sponheim-Starkenberg (von Sayn) in Datum unbekannt. Adelheid (Tochter von Graf Johann I. von Sponheim-Starkenberg (von Sayn) und von Isenberg (von Altena)) wurde geboren in 1228; gestorben in 1297. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 535. |  Sophie von Isenberg (von Altena) Sophie von Isenberg (von Altena) Sophie heiratete Graf Heinrich III. von Volmestein (Volmarstein) in cir 1258. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich II. von Volmestein (Volmarstein)) gestorben in cir 1258. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 536. |  von Isenberg (von Altena) von Isenberg (von Altena) heiratete Graf Johann I. von Sponheim-Starkenberg (von Sayn) in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Graf Gottfried III. von Sponheim und Adelheid von Sayn) wurde geboren in vor 1206; gestorben in 1266; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 537. |  Graf Johann I. von Oldenburg Graf Johann I. von Oldenburg Notizen: Johann I. von Oldenburg Familie/Ehepartner: Richza von Hoya. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 538. |  Bernhard III. von der Lippe Bernhard III. von der Lippe Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_III._(Lippe) Familie/Ehepartner: Sofie (Sophie) von Arnsberg. Sofie (Tochter von Graf Gottfried II. von Arnsberg und Agnes von Rüdenberg) wurde geboren in cir 1210; gestorben in cir 1245. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Sophie von Ravensberg-Vechta. Sophie wurde geboren in cir 1220; gestorben am 3 Jun 1285. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 539. |  Heilwig von der Lippe Heilwig von der Lippe Notizen: Gründerin des Klosters Herwardeshude Familie/Ehepartner: Graf Adolf IV. von Schauenburg (von Holstein). Adolf (Sohn von Adolf III. von Schauenburg (von Holstein) und Adelheid von Querfurt) wurde geboren in 1205; gestorben am 8 Jul 1261 in Kiel; wurde beigesetzt in Marienkloster, Kiel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 540. |  Oda zur Lippe Oda zur Lippe Notizen: Begraben: Oda heiratete Konrad I. von Rietberg in 1237. Konrad (Sohn von Graf Heinrich II. von Arnsberg (von Rietberg) und Ermengarde) wurde geboren in nach 1203; gestorben in 1284/1294. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 541. |  Heinrich III. von Tecklenburg Heinrich III. von Tecklenburg Heinrich heiratete Gräfin Jutta von Ravensberg in 1242/1244. Jutta (Tochter von Otto II. von Ravensberg und Sophie von Oldenburg) wurde geboren in cir 1223 oder cir 1231. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 542. |  Herzog Walram V. von Limburg Herzog Walram V. von Limburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_V._(Limburg) Walram heiratete Jutta (Judith) von Kleve in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Walram heiratete Kunigunde von Brandenburg in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 543. |  Herzog Adolf IV. von Berg (von Limburg) Herzog Adolf IV. von Berg (von Limburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_IV._(Berg) Familie/Ehepartner: Margarete von Hochstaden. Margarete (Tochter von Graf Lothar von Ahr (Are) und Hochstaden (Hostaden) und Mechtild (Mathilde) von Vianden) wurde geboren in cir 1214; gestorben am 30 Jan 1314 in Hückeswagen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 544. |  Graf Hermann III. von Weimar-Orlamünde (Askanier) Graf Hermann III. von Weimar-Orlamünde (Askanier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_III._(Weimar-Orlamünde) Familie/Ehepartner: N N. N gestorben in nach 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 545. |  Graf Otto III. (IV.) von Weimar-Orlamünde Graf Otto III. (IV.) von Weimar-Orlamünde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(Weimar-Orlamünde) (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Agnes von Truhedingen (Leiningen?). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 546. |  Friedrich II. von Truhendingen Friedrich II. von Truhendingen Notizen: Name: Friedrich heiratete Agnes von Württemberg in vor 11 Jan 1282. Agnes (Tochter von Graf Ulrich I. von Württemberg und Gräfin Mechthild von Baden) wurde geboren in vor 1264; gestorben am 27 Sep 1305; wurde beigesetzt in Dominikanerkloster Mergentheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 547. |  Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_IV._(Burgund) Otto heiratete Philippa von Bar in 1263. Philippa (Tochter von Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois und Jeanne von Toucy) gestorben in 1290. [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Mathilde (Mahaut) von Artois in 1285. Mathilde (Tochter von Graf Robert II. von Artois und Amicia von Courtenay) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 27 Nov 1329 in Paris, France; wurde beigesetzt am 30 Nov 1329 in Abtei Maubuisson. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 548. |  Graf Rainald (Renaud) von Burgund (von Chalon) Graf Rainald (Renaud) von Burgund (von Chalon) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Begraben: Rainald heiratete Gräfin Guillemette von Neuenburg in 1282. Guillemette (Tochter von Amadeus von Neuenburg und Jordane von La Sarra) gestorben in 1317 in Château d'Etobon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 549. | Isabel (Elisabeth) von Bourgonne-Comté (von Chalon) Isabel heiratete Graf Hartmann V. von Kyburg in 1254. Hartmann (Sohn von Graf Werner von Kyburg (Kiburg) und Herzogin Alix Berta von Lothringen) wurde geboren in 1223; gestorben am 3 Sep 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 550. |  Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen) Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stammmutter des Hauses Hessen Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen). Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1207; gestorben am 1 Feb 1248 in Löwen, Brabant; wurde beigesetzt in Villers-la-Ville. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 551. |  Hermann II. von Thüringen Hermann II. von Thüringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Thüringen) Familie/Ehepartner: Margaretha von Italien. Margaretha wurde geboren in 1237; gestorben am 8 Aug 1270 in Frankfurt am Main, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Hermann heiratete Helene von Braunschweig am 9 Okt 1239. Helene (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren am 18 Mrz 1223; gestorben am 6 Sep 1273; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 552. |  Anna von Ungarn (Árpáden) Anna von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Grossfürst Rostislaw von Kiew. Rostislaw (Sohn von Grossfürst Michael von Tschernigow) wurde geboren in 1210; gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 553. |  Elisabeth von Ungarn Elisabeth von Ungarn Notizen: Elisabeth und Heinrich XIII. hatten sieben Kinder. Elisabeth heiratete Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) in 1250. Heinrich (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 19 Nov 1235; gestorben am 3 Feb 1290 in Burghausen; wurde beigesetzt in Kloster Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 554. |  König Stephan V. von Ungarn (Árpáden) König Stephan V. von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_V._(Ungarn) Familie/Ehepartner: Königin Elisabeth von Cumania. Elisabeth (Tochter von Khan Kuthen von Cumania und Prinzessin Halitsch N.) wurde geboren in 1240; gestorben in 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 555. |  Prinzessin Jolanta Helena von Ungarn (Árpáden) Prinzessin Jolanta Helena von Ungarn (Árpáden) Jolanta heiratete Bolesław VI. von Kalisch (Piasten), der Fromme in 1257. Bolesław (Sohn von Herzog Władysław Odonic von Kalisch (Piasten)) wurde geboren in 1224/1227; gestorben am 13/14 Apr 1279 in Kalisz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 556. |  Herzog Béla (Bela) von Slawonien (Árpáden) Herzog Béla (Bela) von Slawonien (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Béla heiratete Kunigunde von Brandenburg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 557. | Herzog Boleslaw II. von Schlesien (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Boleslaw_II._(Schlesien) Boleslaw heiratete Hedwig von Anhalt in 1242. Hedwig (Tochter von Fürst Heinrich I. von Anhalt (Askanier) und Irmgard von Thüringen (Ludowinger)) gestorben am 21 Dez 1259. [Familienblatt] [Familientafel]
Boleslaw heiratete Eufemia (Alenta, Adelheid) von Pommerellen in cir 1261, und geschieden in 1275. Eufemia (Tochter von Herzog Sambor II. von Pommerellen und Mathilde (Mechthildis) von Mecklenburg) wurde geboren in 1254. [Familienblatt] [Familientafel] Boleslaw heiratete Sophia von Dyhrn in cir 1277. Sophia wurde geboren in 1255/1257; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 558. | Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Elisabeth und Przemysł I. hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Familie/Ehepartner: Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten). Przemysł (Sohn von Herzog Władysław Odon (von Polen) und Jadwiga N.) wurde geboren in 1220/1221; gestorben in 1257. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 559. |  Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten) Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Konrad II. von Schlesien war Begründer der Glogauer Herzogslinie Konrad heiratete Salome von Polen in 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Sophia von Landsberg. Sophia (Tochter von Dietrich von Landsberg (Meissen, Wettiner) und Helene von Brandenburg) wurde geboren in 1258/1259; gestorben in 14 od 24 Aug 1318 in Weissenfels. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 560. |  Amalia von Henneberg Amalia von Henneberg Notizen: Name: |
| 561. |  Jutta von Henneberg Jutta von Henneberg |
| 562. |  Sophia von Henneberg Sophia von Henneberg Familie/Ehepartner: Herr Friedrich von Hohenlohe-Wernsberg. Friedrich (Sohn von Herr Albrecht I. von Hohenlohe-Möckmühl und Udelhild von Berg-Schelkingen) wurde geboren in vor 1267; gestorben am 23 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 563. |  Alheidis (Adelheid) von Henneberg Alheidis (Adelheid) von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Graf Ludwig II. von Rieneck. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 564. |  Heinrich IV. (III.) von Henneberg-Hartenberg Heinrich IV. (III.) von Henneberg-Hartenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Margarethe von Meissen. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Kunigunde von Wertheim in vor 3 Mai 1287. Kunigunde gestorben in nach 9 Okt 1331. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 565. |  Graf Berthold V. von Henneberg-Schleusingen Graf Berthold V. von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Henneberg,_Grafen_von#Henneberg-Coburg Berthold heiratete Sophia von Schwarzburg-Blankenburg in kurz vor 7 Mrz 1268 in Elgersburg. Sophia (Tochter von Graf Günter IV. (VII.) von Schwarzburg und Prinzessin Sofija von Halicz (Halytsch)) gestorben am 13 Feb 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 566. |  Graf Hermann II. von Henneberg-Aschach Graf Hermann II. von Henneberg-Aschach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Hermann heiratete Adelheid von Trimberg in vor 25 Mrz 1277. Adelheid gestorben in zw 18 Nov 1316 und 7 Jul 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 567. |  Elisabeth von Mecklenburg Elisabeth von Mecklenburg Notizen: Elisabeth und Gerhard I. hatten elf Kinder, vier Töchter und sieben Söhne. Elisabeth heiratete Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe in cir 1250. Gerhard (Sohn von Graf Adolf IV. von Schauenburg (von Holstein) und Heilwig von der Lippe) wurde geboren in 1232; gestorben am 21 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 568. |  Albrecht I. von Mecklenburg Albrecht I. von Mecklenburg |
| 569. |  Fürst Heinrich I. von Mecklenburg Fürst Heinrich I. von Mecklenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Mecklenburg) Heinrich heiratete Anastasia von Pommern (Greifen) in cir 1259. Anastasia (Tochter von Herzog Barnim I. von Pommern (Greifen) und Marianne) wurde geboren in cir 1245; gestorben am 15 Mrz 1317. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 570. |  Herzog Ludwig I. von Teck Herzog Ludwig I. von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 571. |  Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere Notizen: Stammliste der Herzöge von Teck: Familie/Ehepartner: Uta von Zweibrücken. Uta (Tochter von Simon I. von Zweibrücken und von Calw) gestorben in vor 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 572. |  Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau Notizen: Rodolphe II de Neuchâtel-Nidau, (? - 1308/09), comte de Nidau, seigneur de Fenis et de Cerlier. Dès la succession de son père il accorde les franchises à la ville de Nidau en 12615 puis à Cerlier en 1264/66 Familie/Ehepartner: Gertrude von Neuenburg-Strassberg. Gertrude (Tochter von Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg und Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein) wurde geboren am 27 Mrz 1327. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 573. | Richenza von Neuenburg-Nidau |
| 574. |  Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg Notizen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Strassberg Familie/Ehepartner: Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein. Adelheid (Tochter von Otto II. von Ochsenstein und Kunigunde von Habsburg) gestorben am 17 Mai 1314/1332. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 575. |  Graf Wilhelm von Aarberg-Aarberg Graf Wilhelm von Aarberg-Aarberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Wädenswil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 576. |  Kraft von Toggenburg Kraft von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Toggenburger Familie/Ehepartner: Elisabeth von Bussnang. Elisabeth (Tochter von Ritter Albrecht von Bussnang und von Wartenberg) gestorben in spätestens 1276. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 577. |  Lüthold VI. von Regensberg Lüthold VI. von Regensberg Notizen: Zitat aus: https://wikivividly.com/lang-de/wiki/Freiherren_von_Regensberg Familie/Ehepartner: Adelburg von Kaiserstuhl. Adelburg (Tochter von Rudolf von Kaiserstuhl und Adelheid von Tengen) gestorben in spätestens 1282. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 578. |  Ulrich von Regensberg Ulrich von Regensberg Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Regensberg_family Familie/Ehepartner: Berta von Klingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Pfirt. Adelheid (Tochter von Graf Ulrich von Pfirt und Herrin Agnes de Vergy) gestorben in zw 1311 und 1314. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 579. |  Simon I. von Zweibrücken Simon I. von Zweibrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Calw. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 580. |  Elisabeth von Zweibrücken Elisabeth von Zweibrücken Familie/Ehepartner: Graf Gerlach V. von Veldenz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 581. |  Kunigunde von Lichtenberg Kunigunde von Lichtenberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Otto III. von Ochsenstein. Otto (Sohn von Otto II. von Ochsenstein und Kunigunde von Habsburg) gestorben am 2 Jul 1298 in Göllheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 582. |  Agnes von Leiningen Agnes von Leiningen |
| 583. |  Adelheid von Leiningen Adelheid von Leiningen Adelheid heiratete Graf Johann I. von Sponheim-Kreuznach in 1265. Johann (Sohn von Simon I. von Sponheim-Kreuznach und Margarete von Heimbach (Hengebach)) wurde geboren in zw 1245 und 1250; gestorben am 28 Jan 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 584. |  Emich V. von Leiningen Emich V. von Leiningen Emich heiratete Katharina von Ochsenstein in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 585. |  Bischof Friedrich von Bolanden Bischof Friedrich von Bolanden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bolanden |
| 586. |  Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) Gräfin Agnes von Tirol-Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Agnes heiratete Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) am 1 Jan 1286. Friedrich (Sohn von Albrecht II. von Meissen (Wettiner) und Prinzessin Margaretha von Staufen) wurde geboren in 1257 in Wartburg in Eisenach; gestorben am 16 Nov 1323 in Wartburg in Eisenach; wurde beigesetzt in Burg Grimmenstein in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 587. |  Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth hatte mit Albrecht I. 21 Kinder. Elisabeth heiratete König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) am 20 Nov 1274 in Wien. Albrecht (Sohn von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in Jul 1255 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 1 Mai 1308 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Dom von Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 588. |  Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) Herzog Otto III. von Kärnten (Tirol-Görz, Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(Kärnten) Otto heiratete Euphemia von Schlesien (Piasten) in 1297. Euphemia (Tochter von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren in 1281; gestorben in 1347. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 589. |  Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kärnten Familie/Ehepartner: Anna Přemyslovna. Anna (Tochter von König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) und Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg) wurde geboren am 15 Okt 1290 in Prag, Tschechien ; gestorben am 3 Sep 1313 in Kärnten; wurde beigesetzt in Dominikanerkloster Bozen. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen) am 15 Sep 1315 in Innsbruck, Österreich. Adelheid (Tochter von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in 1285; gestorben am 18 Aug 1320. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Beatrice von Savoyen in Feb 1328. Beatrice (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in cir 1310; gestorben in 1331. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 590. |  Graf Engino von Aichelberg Graf Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete Agnes von Helfenstein in Datum unbekannt. Agnes (Tochter von Wilhelm II. von Helfenstein und Irmengarde von Molsberg) wurde geboren in 1212. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 591. |  Herzogin Anna von Teck Herzogin Anna von Teck Anna heiratete Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg in cir 1260. Diepold (Sohn von Graf Engino von Aichelberg und Agnes von Helfenstein) wurde geboren in 1234; gestorben am 6 Mrz 1270. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 592. |  Adelheid von Burgau Adelheid von Burgau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Burgau Adelheid heiratete Rudolf II. von Werdenberg-Sargans in vor 1291. Rudolf (Sohn von Graf Hartmann I. von Werdenberg-Sargans und Elisabeth von Kreiburg-Ortenburg) gestorben in 28 Sep 1322 ? in bei Mühldorf am Inn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 593. |  Heinrich von Burgau Heinrich von Burgau Familie/Ehepartner: Margarethe von Hohenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 594. |  Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Graf Rudolf II. von Montfort-Feldkirch Notizen: Zitat aus: https://regiowiki.at/wiki/Rudolf_II._von_Montfort Rudolf heiratete Agnes von Grüningen (Grieningen) in zw 1255 und 1260. Agnes (Tochter von Graf Hartmann II. von Grüningen) wurde geboren in Grüningen, Baden-Württemberg, DE; gestorben in spätestens 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 595. |  Ulrich I. von Montfort-Bregenz Ulrich I. von Montfort-Bregenz |
| 596. |  Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang Graf Hugo I. von Montfort-Tettnang |
| 597. |  Bischof Friedrich von Montfort Bischof Friedrich von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 598. |  Fürstabt Wilhelm von Montfort Fürstabt Wilhelm von Montfort Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 599. |  Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers) Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Jolanthe und Archambault IX. hatten zwei Töchter. Jolanthe heiratete Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) in 1228. Archambault (Sohn von Herr Archambault VIII. von Dampierre (Bourbon) und Béatrice de Montluçon) wurde geboren in cir 1205; gestorben am 15 Jan 1249 in Zypern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 600. |  Graf Hugo von Brienne Graf Hugo von Brienne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Brienne (Sep 2023) Hugo heiratete Isabella von La Roche in 1227. [Familienblatt] [Familientafel]
Hugo heiratete Helena Komnena Dukaina in vor 14 Sep 1291. Helena (Tochter von Johannes I. von Epirus (Komnenen, Angelos, Dukas) und Hypomone) wurde geboren in 1242; gestorben in 1294. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 601. |  Hugo III. von Lusignan (Antiochia, Zypern) Hugo III. von Lusignan (Antiochia, Zypern) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_III._(Zypern) (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Isabella von Ibelin. Isabella (Tochter von Guido von Ibelin und Philippa Barlais) wurde geboren in 1241; gestorben am 2 Jun 1324. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 602. |  Herzog Johann II. von der Bretagne Herzog Johann II. von der Bretagne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Bretagne) Johann heiratete Prinzessin Beatrix von England (Plantagenêt) in 1260. Beatrix (Tochter von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 25 Jun 1242 in Bordeaux, Frankreich; gestorben am 24 Mrz 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 603. |  Herzog Theobald II. von Lothringen Herzog Theobald II. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_II._(Lothringen) Theobald heiratete Isabelle de Rumigny in 1278. Isabelle (Tochter von Hugo de Rumigny und Philippine d'Oulche) wurde geboren in 1263; gestorben in 1326. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 604. |  Margarethe von Lothringen Margarethe von Lothringen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Eberhard I. von Württemberg. Eberhard (Sohn von Graf Ulrich I. von Württemberg und Herzogin Agnes von Schlesien-Liegnitz) wurde geboren am 13 Mrz 1265 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 5 Jun 1325 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 605. |  Agnes von Lothringen Agnes von Lothringen Familie/Ehepartner: Herr Jean II. von Harcourt. Jean (Sohn von Herr Jean I. von Harcourt und Alix von Beaumont) wurde geboren in 1245; gestorben am 21 Dez 1302. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 606. |  Margarete von Burgund Margarete von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Margarete und Johann I. hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Familie/Ehepartner: Herr Johann I. von Chalon (von Arlay). Johann (Sohn von Graf Johann I. von Chalon (Salins) und Laura von Commercy) gestorben am 13 Feb 1315. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 607. |  Herrin Beatrix von Burgund (von Grignon) Herrin Beatrix von Burgund (von Grignon) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Herr Hugo XIII. von Lusignan, der Braune . Hugo (Sohn von Graf Hugo XII. von Lusignan und Jeanne (Johanna) de Fougères) wurde geboren am 25 Jun 1259; gestorben am 1 Nov 1303 in Angoulême. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 608. |  Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne) Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna von Navarra und Philippe IV. zeugten 7 Kinder, von denen 3 Söhne und eine Tochter das Erwachsenenalter erreichten Johanna heiratete König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne am 16 Aug 1284 in Paris, France. Philipp (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Königin Isabella von Aragón) wurde geboren in 1268 in Fontainebleau, Frankreich; gestorben am 29 Nov 1314 in Fontainebleau, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 609. |  Graf Robert III. von Flandern (Dampierre) Graf Robert III. von Flandern (Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_III._(Flandern) (Jun 2022) Robert heiratete Blanche von Anjou (von Frankreich) in 1266. Blanche (Tochter von König Karl I. von Anjou (von Frankreich) und Königin Beatrix von der Provence) wurde geboren in cir 1250; gestorben am 10 Jan 1269. [Familienblatt] [Familientafel] Robert heiratete Jolanthe von Burgund in 1272. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 610. |  Wilhelm von Flandern (von Dampierre) Wilhelm von Flandern (von Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Alix von Clermont (von Châteaudun). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 611. |  Herzogin Margarete von Flandern (von Dampierre) Herzogin Margarete von Flandern (von Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Flandern,_Herzogin_von_Brabant Margarete heiratete Herzog Johann I. von Brabant in 1273. Johann (Sohn von Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige und Adelheid von Burgund) wurde geboren in 1252/1253 in Löwen, Brabant; gestorben in 3 Mai1294. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 612. |  Beatrix (Béatrice) von Flandern (von Dampierre) Beatrix (Béatrice) von Flandern (von Dampierre) Beatrix heiratete Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) in 1268/1269. Florens (Sohn von Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) und Elisabeth von Lüneburg (von Braunschweig)) wurde geboren in 1254 in Leiden, Holland; gestorben am 27 Jun 1296 in bei Muiden, Holland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 613. |  Margareta von Flandern (von Dampierre) Margareta von Flandern (von Dampierre) Margareta heiratete Alexander von Schottland am 15 Nov 1282 in Roxburgh. Alexander (Sohn von König Alexander III. von Schottland, der Glorreiche und Königin Margarete von England (Plantagenêt)) wurde geboren am 21 Jan 1264 in Jedburgh; gestorben am 28 Jan 1284 in Kloster Lindores Abbey; wurde beigesetzt in Dunfermline Abbey. [Familienblatt] [Familientafel] Margareta heiratete Rainald I. von Geldern in 1286. Rainald (Sohn von Graf Otto II von Geldern, der Lahme und Philippa von Dammartin (von Ponthieu)) wurde geboren in cir 1255; gestorben am 9 Okt 1326 in Montfort. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 614. |  Beatrix von Flandern Beatrix von Flandern Beatrix heiratete Hugo II. von Châtillon (Blois) in 1287. Hugo (Sohn von Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) und Gräfin Mathilde von Brabant) wurde geboren am 9 Apr 1258; gestorben in 1307. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 615. |  Philippine von Flandern Philippine von Flandern Notizen: 1296 verlobt mit dem Prinzen von Wales, dem späteren König Eduard II. von England, eine Ehe kam jedoch nicht zustande. |
| 616. |  Markgraf Johann I. (Jean) von Namur (Dampierre) Markgraf Johann I. (Jean) von Namur (Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Namur) (Sep 2023) Johann heiratete Marguerite von Clermont in 1308. Marguerite (Tochter von Prinz Robert von Frankreich (Clermont) und Gräfin Beatrix von Burgund (von Bourbon)) wurde geboren in 1289; gestorben in 1309. [Familienblatt] [Familientafel] Johann heiratete Marie von Artois in 1309. Marie (Tochter von Graf Philippe von Artois und Blanche (Blanka) von der Bretagne) wurde geboren in 1291; gestorben in 1365. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 617. |  Johann II. (Jean) von Dampierre Johann II. (Jean) von Dampierre Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Isabelle von Brienne in Datum unbekannt. Isabelle (Tochter von Graf Johann II. von Eu (Brienne) und Beatrix von Châtillon (Blois)) gestorben in vor 1307. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 618. |  Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Archambault_IX._(Bourbon) Archambault heiratete Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers) in 1228. Jolanthe (Tochter von Graf Guido I. (IV.) von Saint Pol (de Châtillon) und Gräfin Agnès II. von Donzy (Nevers)) wurde geboren in cir 1222; gestorben in 1254. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 619. |  Marguerite von Bourbon (von Dampierre) Marguerite von Bourbon (von Dampierre) Marguerite heiratete Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger in 1232. Theobald (Sohn von Graf Theobald III. von Champagne (Blois) und Gräfin Blanka von Navarra) wurde geboren am 30 Mai 1201; gestorben am 8 Jul 1253 in Pamplona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 620. |  Béatrice (Agnés) von Bourbon Béatrice (Agnés) von Bourbon Béatrice heiratete Herr Béraud VIII. von Mercœur in Datum unbekannt. Béraud (Sohn von Herr Béraud VII. von Mercœur) gestorben in nach 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 621. |  Marie von Bourbon (von Dampierre) Marie von Bourbon (von Dampierre) Notizen: Marie und Johann I. hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Marie heiratete Graf Johann I. von Dreux in Apr 1240. Johann (Sohn von Graf Robert III. von Dreux und Herrin Aénor von Saint-Valéry) wurde geboren in 1215; gestorben in 1248/49 in Nikosia; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Yved, Braine, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 622. |  Jeanne (Johanna) von Dampierre Jeanne (Johanna) von Dampierre Notizen: Name: Jeanne heiratete Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois in 1243. Theobald (Sohn von Graf Heinrich II. von Bar-Scarponnois und Philippa von Dreux) wurde geboren in 1221; gestorben in 1291. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 623. |  Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_I._(Flandern) (Jun 2022) Guido heiratete Mathilde von Béthune in 1246. Mathilde (Tochter von Herr Robert VII. von Béthune und Elisabeth von Morialmez) gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
Guido heiratete Isabella von Luxemburg in 1264. Isabella (Tochter von Graf Heinrich V. von Limburg-Luxemburg, der Blonde und Herrin Margareta von Bar) wurde geboren in 1247; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 624. |  Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Laura von Lothringen in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 625. |  Henri II. von Sully Henri II. von Sully Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Henri heiratete Pétronille von Joigny in Datum unbekannt. Pétronille (Tochter von Gaucher de Joigny und Amicia von Montfort) gestorben in 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 626. |  Gräfin Marie von Lusignan-Issoudun Gräfin Marie von Lusignan-Issoudun Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Graf Alfons von Brienne. Alfons (Sohn von Johann von Brienne (von Jerusalem) und Kaiserin Berenguela (Berengaria) von León (von Kastilien)) wurde geboren in cir 1227; gestorben am 25 Aug 1270 in vor Tunis. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 627. |  Graf Odo von Burgund (von Nevers) Graf Odo von Burgund (von Nevers) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Odo_(Burgund) Odo heiratete Gräfin Mathilde II. von Bourbon in Feb 1248. Mathilde (Tochter von Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) und Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers)) wurde geboren in cir 1234; gestorben in 1262. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 628. |  Johann von Burgund Johann von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Burgund_(Bourbon) Familie/Ehepartner: Herrin Agnes von Bourbon (de Dampierre). Agnes (Tochter von Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) und Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers)) wurde geboren in 1237; gestorben in 1288. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 629. |  Adelheid von Burgund Adelheid von Burgund Notizen: Adelheid und Heinrich III. hatten vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Adelheid heiratete Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige in 1251. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) und Marie von Schwaben (Staufer)) wurde geboren in cir 1231; gestorben am 28 Feb 1261 in Löwen, Brabant. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 630. |  Herzog Robert II. von Burgund Herzog Robert II. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Burgund) Familie/Ehepartner: Prinzessin Agnes von Frankreich. Agnes (Tochter von König Ludwig IX. von Frankreich und Königin Margarete von der Provence) wurde geboren in 1260; gestorben in 19.12.1325/1327 in Schloss Lantenay (Côte-d’Or); wurde beigesetzt in Abtei Cîteaux. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 631. |  Konstanze von Sizilien (Staufer) Konstanze von Sizilien (Staufer) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Constance_of_Sicily,_Queen_of_Aragon Konstanze heiratete König Peter III. von Aragón am 13 Jun 1262. Peter (Sohn von König Jakob I. von Aragón und Königin Yolanda (Violante) von Ungarn) wurde geboren in 1240 in Valencia; gestorben am 11 Nov 1285 in Vilafranca del Penedès. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 632. |  Hugo II. von Châtillon (Blois) Hugo II. von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_II._(Blois) Hugo heiratete Beatrix von Flandern in 1287. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 633. |  Graf Guido III. (Guy) von Châtillon-Saint-Pol (Blois) Graf Guido III. (Guy) von Châtillon-Saint-Pol (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_III._(St._Pol) Guido heiratete Marie von der Bretagne am 22 Jul 1292. Marie (Tochter von Herzog Johann II. von der Bretagne und Prinzessin Beatrix von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1268; gestorben am 5 Mrz 1339. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 634. |  Jacques von Châtillon (Blois) Jacques von Châtillon (Blois) |
| 635. |  Beatrix von Châtillon (Blois) Beatrix von Châtillon (Blois) Familie/Ehepartner: Graf Johann II. von Eu (Brienne). Johann (Sohn von Graf Alfons von Brienne und Gräfin Marie von Lusignan-Issoudun) gestorben am 12 Jun 1292 in Clermont-en-Beauvaisis; wurde beigesetzt in Abtei von Foucarmont. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 636. |  Graf Walter V. (Gaucher) von Châtillon-Porcéan Graf Walter V. (Gaucher) von Châtillon-Porcéan Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 637. |  Guy von Châtillon (Blois) Guy von Châtillon (Blois) |
| 638. |  Marie von Châtillon (Blois) Marie von Châtillon (Blois) |
| 639. |  Herzog Friedrich III. von Lothringen Herzog Friedrich III. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Friedrich heiratete Marguerite von Navarra in 10 Jul1255. Marguerite (Tochter von Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger und Marguerite von Bourbon (von Dampierre)) wurde geboren in cir 1240; gestorben am 3 Okt 1307. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 640. |  Adeline von Lothringen Adeline von Lothringen Familie/Ehepartner: Herr Ludwig I. (Louis) von der Waadt (von Savoyen). Ludwig (Sohn von Graf Thomas II. von Savoyen und Béatrice (Beatrix) dei Fieschi) wurde geboren in nach 1253; gestorben am 13 Jan 1302 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 641. |  Laura von Lothringen Laura von Lothringen Notizen: Geburt: Laura heiratete Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Guillaume II. (Wilhelm) von Dampierre und Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze ) wurde geboren in 1228; gestorben in 1257/1258. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 642. |  Graf Hartmann V. von Kyburg Graf Hartmann V. von Kyburg Notizen: Name: Hartmann heiratete Isabel (Elisabeth) von Bourgonne-Comté (von Chalon) in 1254. Isabel (Tochter von Hugo von Chalon (Salins) und Adelheid von Meranien (von Andechs)) gestorben am 8 Jul 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 643. |  Gräfin Adelheid von Kyburg Gräfin Adelheid von Kyburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken) und Agnes von Eberstein) gestorben in 1287. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 644. |  Klementa von Kyburg Klementa von Kyburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Rudolf I. von Montfort-Werdenberg. Rudolf (Sohn von Graf Hugo III. von Tübingen (I. von Montfort) und Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg) gestorben in 1243/48. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf von Hohenberg oder Homberg ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 645. |  Graf Heinrich VI. von Luxemburg Graf Heinrich VI. von Luxemburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(Luxemburg) Heinrich heiratete Beatrix von Avesnes in 1260/1261. Beatrix (Tochter von Balduin von Avesnes und Felicite von Coucy (Haus Boves)) gestorben am 1 Mrz 1321. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 646. |  Isabella von Luxemburg Isabella von Luxemburg Notizen: Isabelle und Guido I. hatten acht Kinder, fünf Töchter und drei Söhne. Isabella heiratete Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) in 1264. Guido (Sohn von Guillaume II. (Wilhelm) von Dampierre und Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze ) wurde geboren in cir 1226; gestorben am 7 Mrz 1305 in Compiègne, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 647. |  Philippa von Luxemburg Philippa von Luxemburg Philippa heiratete Graf Johann II. (Jean) von Avesnes in cir 1270. Johann (Sohn von Johann von Hennegau (von Avesnes) und Adelheid von Holland) wurde geboren in 1248; gestorben am 22 Aug 1304 in Valenciennes, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 648. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_I._(Ligny) Familie/Ehepartner: Herrin Johanna von Beauvoir. Johanna (Tochter von Mathieu II. von Beauvoir-en-Arrouaise) gestorben am vor Dez 1300. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 649. |  Graf Heinrich III. von Bar- Scarponnois Graf Heinrich III. von Bar- Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Bar) Heinrich heiratete Prinzessin Eleonore von England in 1293 in Bristol, England. Eleonore (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren am 18 Jun 1269; gestorben am 29 Aug 1298; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 650. |  Philippa von Bar Philippa von Bar Philippa heiratete Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) in 1263. Otto (Sohn von Hugo von Chalon (Salins) und Adelheid von Meranien (von Andechs)) wurde geboren in cir 1238; gestorben am 26 Mrz 1303. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 651. |  Prinzessin Isabella von Frankreich Prinzessin Isabella von Frankreich Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_von_Frankreich_(Navarra) Isabella heiratete König Theobald II. (V.) von Navarra (Blois) in 1255 in Melun. Theobald (Sohn von Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger und Marguerite von Bourbon (von Dampierre)) wurde geboren in 1238; gestorben am 4 Dez 1270 in Trapani; wurde beigesetzt in Kirche der Cordelières, Provins. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 652. |  König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_III._(Frankreich) Philipp heiratete Königin Isabella von Aragón am 28 Mai 1262. Isabella (Tochter von König Jakob I. von Aragón und Königin Yolanda (Violante) von Ungarn) wurde geboren in cir 1243; gestorben am 28 Jan 1271 in Cosenza, Italien; wurde beigesetzt in Saint Denis. [Familienblatt] [Familientafel]
Philipp heiratete Maria von Brabant am 21 Aug 1274 in Schloss Vincennes. Maria (Tochter von Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige und Adelheid von Burgund) wurde geboren am 13 Mai 1254 in Löwen, Brabant; gestorben am 10 Jan 1321 in Murel bei Meulan. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 653. |  Prinzessin Margarete von Frankreich Prinzessin Margarete von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Frankreich_(1254–1271) Margarete heiratete Herzog Johann I. von Brabant in 1270. Johann (Sohn von Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige und Adelheid von Burgund) wurde geboren in 1252/1253 in Löwen, Brabant; gestorben in 3 Mai1294. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 654. |  Prinz Robert von Frankreich (Clermont) Prinz Robert von Frankreich (Clermont) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Clermont (Sep 2018) Robert heiratete Gräfin Beatrix von Burgund (von Bourbon) in 1276 in Clermont-en-Beauvaisis. Beatrix (Tochter von Johann von Burgund und Herrin Agnes von Bourbon (de Dampierre)) wurde geboren am 1257 oder 1258; gestorben am 1 Okt 1310 in Burg Murat, Allier; wurde beigesetzt in Couvent des Cordeliers de Champaigue bei Souvigny. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 655. |  Prinzessin Agnes von Frankreich Prinzessin Agnes von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes und Robert II. hatten zehn Kinder, fünf Söhne und fünf Töchter. Familie/Ehepartner: Herzog Robert II. von Burgund. Robert (Sohn von Herzog Hugo IV. von Burgund und Yolande von Dreux) wurde geboren in cir 1248; gestorben am 21 Mrz 1306 in Vernon-sur-Seine; wurde beigesetzt in Abtei Cîteaux. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 656. | Blanche von Artois Notizen: Das einzige Kind von Blanche mit Heinrich I., Johanna I. wurde die Nachfolgerin Heinrichs. Blanche heiratete König Heinrich I. von Navarra (von Champagne) in 1269 in Melun. Heinrich (Sohn von Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger und Marguerite von Bourbon (von Dampierre)) wurde geboren in cir 1244; gestorben in Jul 1274. [Familienblatt] [Familientafel]
Blanche heiratete Prinz Edmund von England (Plantagenêt), Crouchback in 1276. Edmund (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 16 Jan 1245 in Westminster; gestorben am 5 Jun 1296 in Bayonne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 657. |  Graf Robert II. von Artois Graf Robert II. von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Artois) Robert heiratete Amicia von Courtenay in 1262. Amicia (Tochter von Peter (Pierre) von Courtenay (Kapetinger) und Pétronille von Joigny) wurde geboren in 1250; gestorben in 1275 in Rom, Italien; wurde beigesetzt in Petersdom. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herrin Agnes von Bourbon (de Dampierre). Agnes (Tochter von Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) und Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers)) wurde geboren in 1237; gestorben in 1288. [Familienblatt] [Familientafel] Robert heiratete Margarete von Avesnes in 1298. Margarete (Tochter von Graf Johann II. (Jean) von Avesnes und Philippa von Luxemburg) gestorben am 18 Okt 1342. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 658. |  Blanche von Anjou (von Frankreich) Blanche von Anjou (von Frankreich) Blanche heiratete Graf Robert III. von Flandern (Dampierre) in 1266. Robert (Sohn von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Mathilde von Béthune) wurde geboren in 1249; gestorben am 1 Sep 1322 in Ypern. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 659. |  Beatrix von Anjou Beatrix von Anjou Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix und Philipp hatten eine Tochter. Beatrix heiratete Philipp von Courtenay am 15 Okt 1273 in Foggia, Apulien, Italien. Philipp (Sohn von Kaiser Balduin II. von Courtenay und Kaiserin Maria von Brienne) wurde geboren in 1240/1241 in Konstantinopel; gestorben in 15 oder 25 Dez 1283. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 660. |  Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_II._(Neapel) Karl heiratete Maria von Ungarn in 1270. Maria (Tochter von König Stephan V. von Ungarn (Árpáden) und Königin Elisabeth von Cumania) wurde geboren in 1258; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 661. |  Isabella (Elisabeth) von Anjou (von Frankreich) Isabella (Elisabeth) von Anjou (von Frankreich) Isabella heiratete König Ladislaus IV. von Ungarn (Árpáden), der Kumane in 1270. Ladislaus (Sohn von König Stephan V. von Ungarn (Árpáden) und Königin Elisabeth von Cumania) wurde geboren in 1262; gestorben am 10 Jul 1290 in Cheresig (ungarisch Kőrösszeg). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 662. |  Graf Ferdinand von Aumale (Kastilien) Graf Ferdinand von Aumale (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 663. |  Eleonore von Kastilien Eleonore von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eleonore und Eduard I. hatten vermutlich 14, möglicherweise sogar 16 Kinder, von denen mehrere noch im Kindesalter starben. Eleonore heiratete König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer in 1254. Eduard (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 17 Jun 1239 in Westminster; gestorben am 7 Jul 1307 in Burgh by Sands, Grafschaft Cumberland, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 664. |  Graf Jean III. (Johann) de Roucy (Pierrepont) Graf Jean III. (Johann) de Roucy (Pierrepont) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Jean heiratete Isabelle von Mercœur in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 665. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Judith heiratete Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere in 1 Jan 1317 / 1 Feb 1319. Heinrich (Sohn von Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen und Adelheid von Hessen) wurde geboren in vor 1300; gestorben am 10 Sep 1347 in Schleusingen, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 666. |  Markgraf Johann V. von Brandenburg Markgraf Johann V. von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_V._(Brandenburg) Johann heiratete Katharina von Glogau in Datum unbekannt. Katharina (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 667. |  Mathilde von Brandenburg Mathilde von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Mathilde heiratete Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in 1292; gestorben am 22 Jan 1342 in Sagan, Lebus, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 668. | Elisabeth von Breslau (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Elisabeth und Konrad I. scheinen keine Kinder gehabt zu haben. Elisabeth heiratete Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) in 1322. Konrad (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in cir 1294; gestorben am 22 Dez 1366. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 669. |  Euphemia von Breslau Euphemia von Breslau Notizen: Euphemia und Bolko II. hatten sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Euphemia heiratete Herzog Bolko II. (Boleslaus) von Falkenberg (von Oppeln) in cir 1325. Bolko (Sohn von Herzog Bolko I. (Boleslaw) von Oppeln und Gremislawa (oder Agnes)) wurde geboren in ca 1290/1295; gestorben in ca 1362/1365; wurde beigesetzt in Sankt-Annen-Kapelle, Franziskanerkloster, Oppeln. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 670. |  Herzog Rudolf von Lothringen Herzog Rudolf von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_(Lothringen) Rudolf heiratete Marie von Châtillon (Blois) in 1334. Marie (Tochter von Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) und Marguerite (Margarete) von Valois (Kapetinger)) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Alienor von Bar-Scarponnois am 25 Jun 1329. Alienor (Tochter von Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois und Marie von Burgund) gestorben in 1333. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 671. |  Margarete von Österreich Margarete von Österreich Margarete heiratete Graf Meinhard III. von Tirol in Jun 1359 in Passau. Meinhard (Sohn von Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ ) wurde geboren in 1344 in Landshut, Bayern, DE; gestorben am 13 Jan 1363 in Schloss Tirol oder in Meran. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Markgraf Johann Heinrich von Luxemburg am 26 Feb 1364. Johann wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechien ; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 672. |  Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV._(Österreich) Rudolf heiratete Katharina von Luxemburg (von Böhmen) in Jul 1356. Katharina (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren in 1342 in Prag, Tschechien ; gestorben am 26 Apr 1395 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 673. |  Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_III._(Österreich) Albrecht heiratete Elisabeth von Luxemburg (von Böhmen) in 1366. Elisabeth (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Anna von Schweidnitz) wurde geboren am 19 Mrz 1358 in Prag, Tschechien ; gestorben in 04 od 19 Sept 1373 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Albrecht heiratete Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern) in 1375. Beatrix (Tochter von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) und Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner)) wurde geboren in 1355; gestorben in 1414. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 674. |  Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_III._von_Habsburg (Mai 2018) Leopold heiratete Herzogin Viridis Visconti in 1365 in Wien. Viridis (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in cir 1350; gestorben am 1 Mrz 1414; wurde beigesetzt in Kloster Sittich oder in der Familiengruft zu Mailand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 675. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Habsburg_(1320–1349) Katharina heiratete Herr Enguerrand VI. von Coucy in Nov 1338. Enguerrand (Sohn von Herr Guillaume I. von Coucy) wurde geboren in 1313; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 676. |  Eleonore von Aragón (von Sizilien) Eleonore von Aragón (von Sizilien) Eleonore heiratete König Peter IV. von Aragón in 1349. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Aragón und Gräfin Teresa d’Entença (von Urgell)) wurde geboren am 5 Sep 1319 in Balaguer; gestorben am 6 Jan 1387 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 677. |  Beatrix von Sizilien Beatrix von Sizilien Beatrix heiratete Pfalzgraf Ruprecht II. von der Pfalz (Wittelsbacher) in 1345. Ruprecht (Sohn von Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche und Prinzessin Irmengard von Oettingen) wurde geboren am 12 Mai 1325 in Amberg, Bayern, DE; gestorben am 6 Jan 1398 in Amberg, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 678. |  Graf Meinhard III. von Tirol Graf Meinhard III. von Tirol Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_III. (Sep 2023) Meinhard heiratete Margarete von Österreich in Jun 1359 in Passau. Margarete (Tochter von Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) und Herzogin Johanna von Pfirt) wurde geboren in 1346; gestorben in 1366. [Familienblatt] [Familientafel] |