
| 1. | Jimena Muñoz gestorben in 1156. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Aus einem Konkubinat mit der Adligen Jimena Muñoz gingen zwei illegitime Kinder hervor Familie/Ehepartner: König Alfons VI. von León (von Kastilien). Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von León, der Große und Sancha von León) wurde geboren in 1037; gestorben am 1 Jul 1109 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Abtei Santos Facundo y Primitivo (später San Benito) in Sahagún. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. |  Elvira Alfónsez (von León) Elvira Alfónsez (von León) Elvira heiratete Graf Raimund IV. von Toulouse (Raimundiner) in 1094. Raimund (Sohn von Graf Pons von Toulouse (Raimundiner) und Almodis de la Marche) wurde geboren in 1041/1042 in Toulouse; gestorben am 28 Feb 1105 in Burg Mons Peregrinus, Tripolis. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |  Gräfinn von Portugal Teresa Alfónsez von León Gräfinn von Portugal Teresa Alfónsez von León Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theresia_von_León (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Burgund (von Portugal). Heinrich (Sohn von Heinrich von Burgund (Kapetinger) und Sibylla von Barcelona) wurde geboren in 1069; gestorben am 1 Nov 1112. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Fernando Pérez de Traba. Fernando gestorben in nach 1155. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. |  Alfons Jordan von Toulouse (Raimundiner) Alfons Jordan von Toulouse (Raimundiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_Jordan (Auf 2023) Alfons heiratete Faydive (Faydida) d’Uzès in cir 1125. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. |  König Alfons I. Henriques von Portugal König Alfons I. Henriques von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_I._(Portugal) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Flâmula (Châmoa) Gomez de Trava. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Gräfin Mathilde (Mafalda) von Savoyen und Maurienne in 1146. Mathilde (Tochter von Graf Amadeus III. von Savoyen (Maurienne) und Adelheid) wurde geboren in 1125; gestorben am 4 Nov 1157 in Coimbra. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Elvira Gualtar. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. |  Graf Raimund V. von Toulouse (Raimundiner) Graf Raimund V. von Toulouse (Raimundiner) Raimund heiratete Prinzessin Konstanze (Constance) von Frankreich (Kapetinger) am 10 Aug 1154, und geschieden in 1165/1166. Konstanze (Tochter von König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke und Königin Adelheid von Maurienne (Savoyen)) wurde geboren in cir 1126; gestorben am 16 Aug 1176. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Faidiva von Toulouse Faidiva von Toulouse Familie/Ehepartner: Graf Humbert III. von Savoyen (von Maurienne). Humbert (Sohn von Graf Amadeus III. von Savoyen (Maurienne) und Mathilde von Albon) wurde geboren am 1 Aug 1136; gestorben am 4 Mai 1188 in Veillane. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. |  Urraca von Portugal Urraca von Portugal Urraca heiratete König Ferdinand II. von León (von Kastilien) in 1165, und geschieden in 1175. Ferdinand (Sohn von König Alfons VII. von León (von Kastilien) und Berenguela von Barcelona) wurde geboren in 1137; gestorben am 22 Jan 1188 in Benavente. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. |  König Sancho I. von Portugal, der Besiedler König Sancho I. von Portugal, der Besiedler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sancho_I._(Portugal) (Okt 2017) Sancho heiratete Prinzessin Dulce von Barcelona in 1175. Dulce (Tochter von Graf Raimund Berengar IV. von Barcelona und Petronella von Aragón (Jiménez)) wurde geboren in 1158/1159; gestorben am 1 Sep 1198 in Coimbra. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Maria Pais de Ribeira. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: D. Maria Aires de Fornelos. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. |  Teresa (Mathilde) von Portugal Teresa (Mathilde) von Portugal Teresa heiratete Graf Philipp I. von Flandern (von Elsass) in Aug 1183. Philipp (Sohn von Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) und Sibylle von Anjou-Château-Landon) gestorben am 1 Jun 1191 in Schlachtfeld vor Akkon, Israel. [Familienblatt] [Familientafel] Teresa heiratete Herzog Odo III. von Burgund in 1194. Odo (Sohn von Herzog Hugo III. von Burgund und Alix von Lothringen) wurde geboren in 1166; gestorben am 6 Jul 1218 in Lyon. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. |  Graf Raimund VI. von Toulouse (Raimundiner) Graf Raimund VI. von Toulouse (Raimundiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raimund_VI._(Toulouse) (Aug 2023) Raimund heiratete Ermessende Pelet in nach 1172. Ermessende gestorben in 1176. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Beatrix von Béziers (Trencavel). Beatrix (Tochter von Vizegraf Raimund I. Trencavel (von Béziers)) gestorben in 1193. [Familienblatt] [Familientafel] Raimund heiratete Bourgogne von Lusignan in cir 1193, und geschieden in 1196. [Familienblatt] [Familientafel] Raimund heiratete Prinzessin Johanna von England (Plantagenêt) in 1196. Johanna (Tochter von König Heinrich II. (Henry II.) von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von Aquitanien) wurde geboren in Okt 1165 in Angers; gestorben am 4 Sep 1199 in Fontevraud-l’Abbaye. [Familienblatt] [Familientafel]
Raimund heiratete Komnena (von Zypern) in nach 1199. [Familienblatt] [Familientafel] Raimund heiratete Eleonore von Aragón in 1204. Eleonore (Tochter von König Alfons II. (Raimund) von Aragón (von Barcelona) und Sancha von Kastilien) wurde geboren in 1186; gestorben in 1226. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. |  König Alfons IX. von León (von Kastilien) König Alfons IX. von León (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_IX._(León) (Okt 2017) Alfons heiratete Theresia von Portugal in 1191. Theresia (Tochter von König Sancho I. von Portugal, der Besiedler und Prinzessin Dulce von Barcelona) wurde geboren in 1178 in Coimbra; gestorben am 18 Jun 1250 in Lorvão; wurde beigesetzt in Klosterkirche, Lorvão. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Königin Berenguela von Kastilien in 1198. Berenguela (Tochter von König Alfons VIII. von Kastilien und Königin Eleanore von England (Plantagenêt)) wurde geboren am 1 Jun 1180 in Sergovia; gestorben am 8 Nov 1246 in Las Huelgas. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  Theresia von Portugal Theresia von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theresia_von_Portugal (Jun 2017) Theresia heiratete König Alfons IX. von León (von Kastilien) in 1191. Alfons (Sohn von König Ferdinand II. von León (von Kastilien) und Urraca von Portugal) wurde geboren am 15 Aug 1171 in Zamora; gestorben am 23/24 Sep 1230 in Villanueva bei Sarria. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. |  König Alfons II. von Portugal, der Dicke König Alfons II. von Portugal, der Dicke Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_II._(Portugal) (Okt 2017) Alfons heiratete Prinzessin Urraca von Kastilien (von Portugal) in 1208. Urraca (Tochter von König Alfons VIII. von Kastilien und Königin Eleanore von England (Plantagenêt)) wurde geboren am 1186 od 1187 in Coimbra; gestorben am 3 Nov 1220 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Portugal_(1187–1258) (Aug 2023) Peter heiratete Gräfin Aurembiaix von Urgelll in 1229. Aurembiaix (Tochter von Graf Ermengol VIII. (Armengol) von Urgell und Elvira von Subirats) gestorben in Aug 1231 in Balaguer; wurde beigesetzt in Zisterzienserabtei Sant Hilari in Lleida. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. |  Prinzessin Berengaria von Portugal Prinzessin Berengaria von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Berengaria hatte mit Waldemar II. vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Berengaria heiratete König Waldemar II. von Dänemark in 1214. Waldemar (Sohn von König Waldemar I. von Dänemark, der Grosse und Königin Sophia von Dänemark (von Minsk)) wurde geboren am 28 Jun 1170; gestorben am 28 Mrz 1241. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  Fernando (Ferdinand, Ferrand) von Portugal Fernando (Ferdinand, Ferrand) von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_(Flandern) (Okt 2017) Fernando heiratete Gräfin Johanna von Flandern (von Konstantinopel) am 1 Jan 1212. Johanna (Tochter von Kaiser Balduin I. von Konstantinopel (von Hennegau) und Kaiserin Marie von Champagne (Blois)) wurde geboren in 1200; gestorben am 5 Dez 1244 in Marquette-lez-Lille; wurde beigesetzt in Zisterzienserabtei von Marquette. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. |  Graf Raimund VII. von Toulouse (Raimundiner) Graf Raimund VII. von Toulouse (Raimundiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raimund_VII._(Toulouse) (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Sancha von Aragón. Sancha (Tochter von Peter II. von Aragón, der Katholische und Königin von Aragonien Maria von Montpellier) wurde geboren in 1205; gestorben in 1206. [Familienblatt] [Familientafel] Raimund heiratete Sancha von Aragón in 1211, und geschieden in 1241. Sancha (Tochter von König Alfons II. (Raimund) von Aragón (von Barcelona) und Sancha von Kastilien) wurde geboren in 1186; gestorben in 1242. [Familienblatt] [Familientafel]
Raimund heiratete Margarete von Lusignan in 1243, und geschieden am 25 Sep 1245. Margarete (Tochter von Graf Hugo X. von Lusignan, der Braune und Gräfin Isabella von Angoulême) gestorben am 22 Okt 1288. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. |  König Ferdinand III. von León (von Kastilien) König Ferdinand III. von León (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III._(Kastilien) (Okt 2017) Ferdinand heiratete Königin Beatrix von Schwaben, die Jüngere am 30 Nov 1219 in Burgos. Beatrix (Tochter von König Philipp von Schwaben (Staufer) und Irene (Maria) von Byzanz) wurde geboren in Mai/Jun 1205; gestorben am 5 Nov 1235 in Toro; wurde beigesetzt in Capilla Real in der Kathedrale von Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Ferdinand heiratete Gräfin Johanna von Dammartin (von Ponthieu) am vor Aug 1237. Johanna (Tochter von Graf Simon von Dammartin (von Ponthieu) und Gräfin Marie von Ponthieu (von Montgommery)) gestorben in 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. |  Kaiserin Berenguela (Berengaria) von León (von Kastilien) Kaiserin Berenguela (Berengaria) von León (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Berenguela hatte mit Johann vier Kinder, eine Tochter und drei Söhne. Berenguela heiratete Johann von Brienne (von Jerusalem) in 1224 in Toledo, Spanien. Johann (Sohn von Graf Érard II. (Erhard) von Brienne und Agnes von Montfaucon (Mömpelgard)) wurde geboren in ca 1169 / 1174; gestorben am 23 Mrz 1237 in Konstantinopel; wurde beigesetzt in ? Kirche San Francesco von Assisi. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Herzog Alfons de Molina (von León) Herzog Alfons de Molina (von León) Familie/Ehepartner: Teresa de Lara. Teresa (Tochter von Gonzalo Núñez de Lara) wurde geboren in 1246. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  König Sancho II. von Portugal König Sancho II. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sancho_II._(Portugal) (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Königin von Portugal Mécia Lópes de Haro. Mécia (Tochter von Lope Díaz II. de Haro) wurde geboren in cir 1215 in Bizkaia, Spanien; gestorben in cir 1270 in Palencia. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. |  König Alfons III. von Portugal König Alfons III. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_III._(Portugal) (Okt 2017) Alfons heiratete Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) in cir 1235. Mathilde (Tochter von Graf Rainald I. von Dammartin (Haus Mello) und Gräfin Ida von Elsass) gestorben in 1259. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Prinzessin Beatrix von Kastilien. Beatrix (Tochter von König Alfons X. von León (von Kastilien), der Weise und Prinzessin María Guillén de Guzmán) wurde geboren in 1242; gestorben am 27 Okt 1303. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Madragana. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Maria Peres de Enxara. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. |  Königin Eleonore (Leonor) von Portugal Königin Eleonore (Leonor) von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Portugal_(1211–1231) Eleonore heiratete Herzog Waldemar von Schleswig (von Dänemark) am 24 Jun 1229 in Ribe, Dänemark. Waldemar (Sohn von König Waldemar II. von Dänemark und Prinzessin Dagmar (Markéta) von Böhmen) wurde geboren in 1209; gestorben am 28 Nov 1231 in Refsnæs. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. |  König Erik IV. von Dänemark König Erik IV. von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Erik_IV._(Dänemark) (Aug 2028) Erik heiratete Judith von Sachsen (Askanier) am 17 Nov 1239. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Sophia von Dänemark Sophia von Dänemark Notizen: Sophia und Johann I. hatten fünf Kinder, vier Söhne und eine Tochter. Sophia heiratete Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) in 1230. Johann (Sohn von Albrecht II. von Brandenburg (Askanier) und Mathilde von Groitzsch) wurde geboren in cir 1213; gestorben am 4 Apt 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. |  König Christoph I. von Dänemark König Christoph I. von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_I._(Dänemark) Christoph heiratete Margarete Sambiria von Pommerellen in 1248. Margarete (Tochter von Herzog Sambor II. von Pommerellen und Mathilde (Mechthildis) von Mecklenburg) wurde geboren in cir 1230; gestorben am 1 Dez 1282 in Rostock; wurde beigesetzt in Münster, Doberan. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  Gräfin Johanna von Toulouse (Raimundiner) Gräfin Johanna von Toulouse (Raimundiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_(Toulouse) (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Graf Hugo XI. von Lusignan, der Braune . Hugo (Sohn von Graf Hugo X. von Lusignan, der Braune und Gräfin Isabella von Angoulême) wurde geboren in 1221; gestorben am 6 Apr 1250 in Fariskur, Ägypten. [Familienblatt] [Familientafel] Johanna heiratete Prinz Alfons von Frankreich (von Poitou) in 1241. Alfons (Sohn von König Ludwig VIII. von Frankreich, der Löwe und Königin Blanka von Kastilien) wurde geboren am 11 Nov 1220 in Poissy; gestorben am 21 Aug 1271 in Corneto, Siena. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. |  König Alfons X. von León (von Kastilien), der Weise König Alfons X. von León (von Kastilien), der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_X._(Kastilien) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Prinzessin María Guillén de Guzmán. [Familienblatt] [Familientafel]
Alfons heiratete Violante von Aragón am 26 Dez 1246 in Valladolid, Spanien. Violante (Tochter von König Jakob I. von Aragón und Königin Yolanda (Violante) von Ungarn) wurde geboren in 1236 in Saragossa; gestorben in 1301 in Roncevalles. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Graf Manuel von Kastilien Graf Manuel von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Manuel heiratete Konstanze (Constance) von Aragón in 1260. Konstanze (Tochter von König Jakob I. von Aragón und Königin Yolanda (Violante) von Ungarn) wurde geboren in 1239; gestorben in cir 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
Manuel heiratete Beatrice von Savoyen in 1275. Beatrice (Tochter von Graf Amadeus IV. von Savoyen und Cécile (Passerose) von Baux) wurde geboren in 1250; gestorben in 1292. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Graf Ferdinand von Aumale (Kastilien) Graf Ferdinand von Aumale (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. |  Eleonore von Kastilien Eleonore von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eleonore und Eduard I. hatten vermutlich 14, möglicherweise sogar 16 Kinder, von denen mehrere noch im Kindesalter starben. Eleonore heiratete König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer in 1254. Eduard (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 17 Jun 1239 in Westminster; gestorben am 7 Jul 1307 in Burgh by Sands, Grafschaft Cumberland, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. |  Kaiserin Maria von Brienne Kaiserin Maria von Brienne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_von_Brienne Maria heiratete Kaiser Balduin II. von Courtenay in 1236/1237. Balduin (Sohn von Kaiser Peter II. von Courtenay (Kapetinger) und Gräfin Jolante von Konstantinopel (von Flandern)) wurde geboren in 1217 in Konstantinopel; gestorben in 1274 in Königreich Neapel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  Graf Alfons von Brienne Graf Alfons von Brienne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_von_Brienne (Sep 2018) Familie/Ehepartner: Gräfin Marie von Lusignan-Issoudun. Marie (Tochter von Graf Rudolf II. (Raoul) von Lusignan-Issoudun und Johanna von Burgund) gestorben am 1 Okt 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. |  Königin Maria de Molina Königin Maria de Molina Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria und Sancho IV. hatten sieben Kinder, fünf Söhne und zwei Töchter. Maria heiratete König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere in 1283. Sancho (Sohn von König Alfons X. von León (von Kastilien), der Weise und Violante von Aragón) wurde geboren in 1257/1258; gestorben in 25 Apr1295 in Toledo, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. |  König Dionysius von Portugal König Dionysius von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_of_Portugal Dionysius heiratete Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal am 24 Jun 1282. Isabella (Tochter von König Peter III. von Aragón und Konstanze von Sizilien (Staufer)) wurde geboren am 4 Jan 1271 in Saragossa; gestorben am 4 Jul 1336 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Santa Clara-a-Velha in Coimbra, dann Kloster Santa Clara-a-Nova. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Aldonça Rodrigues Talha. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Grácia Froes. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Marinha Gomes. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. |  Herr Alfonso von Portugal Herr Alfonso von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_de_Portugal,_Senhor_de_Portalegre (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Violante Manuel von Kastilien. Violante (Tochter von Graf Manuel von Kastilien und Konstanze (Constance) von Aragón) wurde geboren in 1265; gestorben in 1306. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. |  Sophia von Dänemark Sophia von Dänemark Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sofia_von_Dänemark (Apr 2018) Sophia heiratete König Waldemar (Valdemar) von Schweden in 1260 in Jönköping. Waldemar (Sohn von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in 1243; gestorben am 26 Dez 1302 in Nyköpingshus. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Jutta von Dänemark Jutta von Dänemark Familie/Ehepartner: König Waldemar (Valdemar) von Schweden. Waldemar (Sohn von Jarl Birger Magnusson von Schweden (von Bjälbo) und Ingeborg Eriksdotter von Schweden) wurde geboren in 1243; gestorben am 26 Dez 1302 in Nyköpingshus. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 40. |  Helene von Brandenburg Helene von Brandenburg Notizen: Helene und Dietrich hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Helene heiratete Dietrich von Landsberg (Meissen, Wettiner) in 1258. Dietrich (Sohn von Markgraf Heinrich III. von Meissen (Wettiner) und Constantia von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in 1242; gestorben am 8 Feb 1285. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. |  Markgraf Konrad I. von Brandenburg (Askanier) Markgraf Konrad I. von Brandenburg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Brandenburg) Familie/Ehepartner: Constanze von Polen (Piasten). Constanze (Tochter von Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten) und Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten)) wurde geboren in 1245/1246; gestorben am 8 Okt 1281. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. |  König Erik V. von Dänemark, Klipping König Erik V. von Dänemark, Klipping Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Erik_V._(Dänemark) Erik heiratete Agnes (Agnete) von Brandenburg in 1273. Agnes (Tochter von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren in 1257; gestorben am 29 Sep 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. |  Mathilde von Dänemark Mathilde von Dänemark Notizen: Mathilde und Albrecht III. hatten vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Mathilde heiratete Markgraf Albrecht III. von Brandenburg in 1268. Albrecht (Sohn von Markgraf Otto III. von Brandenburg (Askanier), der Fromme und Beatrix (Božena) von Böhmen) wurde geboren in cir 1250; gestorben in zw 19 Nov und 04 Dez 1300. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. |  Prinzessin Beatrix von Kastilien Prinzessin Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix hatte mit Alfons III. acht Kinder, vier Töchter und vier Söhne. Familie/Ehepartner: König Alfons III. von Portugal. Alfons (Sohn von König Alfons II. von Portugal, der Dicke und Prinzessin Urraca von Kastilien (von Portugal)) wurde geboren am 5 Mai 1210 in Coimbra; gestorben am 16 Feb 1279 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. |  Prinzessin Beatrix von Kastilien Prinzessin Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Beatrix heiratete Markgraf Wilhelm VII. von Montferrat (Aleramiden), der Grosse in 1271. Wilhelm (Sohn von Markgraf Bonifatius II. von Montferrat (Aleramiden), der Riese und Margarete von Savoyen) gestorben am 8 Feb 1292. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. |  König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Sancho_IV_of_Castile Sancho heiratete Königin Maria de Molina in 1283. Maria (Tochter von Herzog Alfons de Molina (von León) und Teresa de Lara) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 1 Jul 1321 in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. |  Violante Manuel von Kastilien Violante Manuel von Kastilien Familie/Ehepartner: Herr Alfonso von Portugal. Alfonso (Sohn von König Alfons III. von Portugal und Prinzessin Beatrix von Kastilien) wurde geboren am 6/8 Feb 1263; gestorben am 2 Jan 1312. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. |  Don Juan Manuel Don Juan Manuel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel (Aug 2023) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. |  Graf Johann I. von Aumale (Kastilien) Graf Johann I. von Aumale (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Ida von Meulan. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. |  König Eduard II. von England (Plantagenêt) König Eduard II. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_II._(England) Eduard heiratete Prinzessin Isabelle von Frankreich am 25 Jan 1308. Isabelle (Tochter von König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne und Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne)) wurde geboren in cir 1295 in Paris, France; gestorben am 23 Aug 1358 in Hertford Castle; wurde beigesetzt in Christ Church Greyfriars. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. |  Prinzessin Eleonore von England Prinzessin Eleonore von England Notizen: Eleonore und Heinrich III. hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Eleonore heiratete Graf Heinrich III. von Bar- Scarponnois in 1293 in Bristol, England. Heinrich (Sohn von Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois und Jeanne von Toucy) wurde geboren am 1257 / 1260; gestorben in 1302 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. |  Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt) Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Von ihrem Vater wurde sie schon als Fünfjährige mit Hartmann von Habsburg verlobt, dem zweiten Sohn des römisch-deutschen Königs Rudolf I. von Habsburg. Die Ehe sollte ein englisch-deutsches Bündnis gegen Frankreich untermauern, allerdings starb Hartmann bereits 1281 bei einem Unfall. Familie/Ehepartner: Graf Hartmann von Habsburg. Hartmann (Sohn von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in cir 1263 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 20 Dez 1281 in zwischen Breisach und Straßburg im Rhein; wurde beigesetzt in Münster Basel, BS, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel] Johanna heiratete Graf Gilbert de Clare, der Rote am 30 Apr 1290 in Westminster Abbey, London, England. Gilbert (Sohn von Graf Richard de Clare und Maud de Lacy) wurde geboren am 2 Sep 1243 in Christchurch, Enngland; gestorben am 7 Dez 1295 in Monmouth Castle, Wales; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]
Johanna heiratete Baron Ralph de Monthermer in 1297. Ralph wurde geboren in cir 1270; gestorben am 5 Apr 1325 in Grey Friars Church in Salisbury. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 53. |  Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt) Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt) Margaret heiratete Herzog Johann II. von Brabant am 9 Jul 1290 in Westminster Abbey, London, England. Johann (Sohn von Herzog Johann I. von Brabant und Herzogin Margarete von Flandern (von Dampierre)) wurde geboren am 27 Sep 1275; gestorben am 27 Okt 1312 in Tervuren. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(England) Elisabeth heiratete Graf Johann I. von Holland (Gerulfinger) am 7 Jan 1297. Johann (Sohn von Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) und Beatrix (Béatrice) von Flandern (von Dampierre)) wurde geboren in 1284; gestorben am 10 Nov 1299 in Haarlem, Holland. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Humphrey VII. de Bohun, 4. Earl of Hereford am 14 Nov 1302 in Westminster Abbey, London, England. Humphrey (Sohn von Humphrey VI. de Bohun, 3. Earl of Hereford und Maud Fiennes) wurde geboren in cir 1267; gestorben am 16 Mrz 1322 in Boroughbridge, England; wurde beigesetzt in Dominikanerkirche, York, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. |  Philipp von Courtenay Philipp von Courtenay Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Courtenay Philipp heiratete Beatrix von Anjou am 15 Okt 1273 in Foggia, Apulien, Italien. Beatrix (Tochter von König Karl I. von Anjou (von Frankreich) und Königin Beatrix von der Provence) wurde geboren in cir 1252; gestorben in zw 16 Nov und 13 Dez 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 56. |  Graf Johann II. von Eu (Brienne) Graf Johann II. von Eu (Brienne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._von_Eu (Sep 2018) Familie/Ehepartner: Beatrix von Châtillon (Blois). Beatrix (Tochter von Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) und Gräfin Mathilde von Brabant) gestorben in 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. |  Prinzessin Isabella von Kastilien Prinzessin Isabella von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_von_Kastilien_(1283–1328) (Aug 2023) Isabella heiratete König Jakob II. von Aragón in 1291 in Soria, und geschieden in 1295. Jakob (Sohn von König Peter III. von Aragón und Konstanze von Sizilien (Staufer)) wurde geboren am 10 Aug 1267; gestorben am 2 Nov 1327 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 58. |  König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_IV._(Kastilien) (Okt 2017) Ferdinand heiratete Konstanze von Portugal in 1302. Konstanze (Tochter von König Dionysius von Portugal und Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal ) wurde geboren am 3 Jan 1290; gestorben am 18 Nov 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. |  Beatrix von Kastilien Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix von Kastilien hatte mit Alfons IV. sieben Kinder, drei Töchter und vier Söhne. Beatrix heiratete König Alfons IV. von Portugal, der Kühne in 1309. Alfons (Sohn von König Dionysius von Portugal und Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal ) wurde geboren am 8 Feb 1291 in Coimbra; gestorben am 28 Mai 1357 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. |  Konstanze von Portugal Konstanze von Portugal Konstanze heiratete König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) in 1302. Ferdinand (Sohn von König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere und Königin Maria de Molina) wurde geboren am 6 Dez 1285; gestorben am 7 Sep 1312 in Jaén; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. |  König Alfons IV. von Portugal, der Kühne König Alfons IV. von Portugal, der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_IV._(Portugal) (Apr 2018) Alfons heiratete Beatrix von Kastilien in 1309. Beatrix (Tochter von König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere und Königin Maria de Molina) wurde geboren in 1293; gestorben am 25 Okt 1359. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 62. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Beatriz heiratete Herr Pedro Fernandes de Castro in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. |  Prinzessin Ingeborg von Schweden Prinzessin Ingeborg von Schweden Notizen: Ingeborg und Gerhard II. hatten vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Ingeborg heiratete Graf Gerhard II. von Holstein (von Plön), der Blinde am 12 Dez 1275. Gerhard (Sohn von Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe und Elisabeth von Mecklenburg) wurde geboren in 1254; gestorben am 28 Okt 1312. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. |  Richiza (Rixa) von Schweden Richiza (Rixa) von Schweden Notizen: Richiza und Przemysł II. hatten eine Tochter. Richiza heiratete Przemysł II. von Polen am 11 Okt 1285. Przemysł (Sohn von Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten) und Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten)) wurde geboren am 14 Okt 1257 in Posen; gestorben am 8 Feb 1296 in Rogoźno, Polen; wurde beigesetzt in Kathedrale, Posen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. |  Sophia von Landsberg Sophia von Landsberg Notizen: Sophias Ehe mit Konradin wurde wahrscheinlich nie vollzogen. Sophia heiratete König Konradin von Staufen in 1266. Konradin (Sohn von König Konrad IV. von Staufen und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 25 Mrz 1252 in Burg Wolfstein, Landshut; gestorben am 29 Okt 1268 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten). Konrad (Sohn von Herzog Heinrich II von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Fromme und Herzogin Anna von Böhmen) wurde geboren in zw 1232 und 1235; gestorben in 06 Aug 1273 oder 1274 in Glogau. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 66. |  Agnes von Brandenburg (Askanier) Agnes von Brandenburg (Askanier) Familie/Ehepartner: Fürst Albrecht I. von Anhalt-Köthen (Askanier). Albrecht (Sohn von Fürst Siegfried I von Anhalt (von Köthen) (Askanier) und Katharina Birgersdottir von Schweden) gestorben in 1316. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. |  Richsa von Dänemark Richsa von Dänemark Richsa heiratete Herr Nikolaus II. zu Werle in 1292. Nikolaus (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in vor 1275; gestorben am 18 Feb 1316 in Pustow (Pustekow). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. |  König Christoph II. von Dänemark König Christoph II. von Dänemark Notizen: Vor seiner Heirat hatte er eine Geliebte aus dem Geschlecht der Lunge und mit ihr zwei Kinder: Christoph heiratete Euphemia von Pommern in 1300. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Geliebte des Christoph II. von Dänemark, N. Lunge. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 69. | Beatrix von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrix_von_Brandenburg Beatrix heiratete Herr Heinrich II. von Mecklenburg in 1292 in Burg Stargard. Heinrich (Sohn von Fürst Heinrich I. von Mecklenburg und Anastasia von Pommern (Greifen)) wurde geboren in nach 14 Apr 1266; gestorben am 21 Jan 1329 in Sternberg, Pommern. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 70. | Margarete von Brandenburg Notizen: Margarete und Przemysł hatten keine Kinder. Margarete heiratete Przemysł II. von Polen in 1291. Przemysł (Sohn von Herzog Przemysł I. (Przemysław) von Polen (Piasten) und Elisabeth von Polen (von Schlesien) (Piasten)) wurde geboren am 14 Okt 1257 in Posen; gestorben am 8 Feb 1296 in Rogoźno, Polen; wurde beigesetzt in Kathedrale, Posen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 71. |  König Dionysius von Portugal König Dionysius von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_of_Portugal Dionysius heiratete Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal am 24 Jun 1282. Isabella (Tochter von König Peter III. von Aragón und Konstanze von Sizilien (Staufer)) wurde geboren am 4 Jan 1271 in Saragossa; gestorben am 4 Jul 1336 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Santa Clara-a-Velha in Coimbra, dann Kloster Santa Clara-a-Nova. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Aldonça Rodrigues Talha. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Grácia Froes. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Marinha Gomes. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 72. |  Herr Alfonso von Portugal Herr Alfonso von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_de_Portugal,_Senhor_de_Portalegre (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Violante Manuel von Kastilien. Violante (Tochter von Graf Manuel von Kastilien und Konstanze (Constance) von Aragón) wurde geboren in 1265; gestorben in 1306. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. |  Yolande (Violante) (Irene) von Montferrat (Aleramiden) Yolande (Violante) (Irene) von Montferrat (Aleramiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Yolande und Andronikos II. hatten vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Yolande heiratete Andronikos II. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) in 1284. Andronikos (Sohn von Kaiser Michael VIII. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) und Theodora Dukaina Komnene Palaiologina Batatzaina (Byzanz)) wurde geboren am 25 Mrz 1259 in Nikaia; gestorben am 13 Feb 1332 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. |  Prinzessin Isabella von Kastilien Prinzessin Isabella von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_von_Kastilien_(1283–1328) (Aug 2023) Isabella heiratete König Jakob II. von Aragón in 1291 in Soria, und geschieden in 1295. Jakob (Sohn von König Peter III. von Aragón und Konstanze von Sizilien (Staufer)) wurde geboren am 10 Aug 1267; gestorben am 2 Nov 1327 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 75. |  König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_IV._(Kastilien) (Okt 2017) Ferdinand heiratete Konstanze von Portugal in 1302. Konstanze (Tochter von König Dionysius von Portugal und Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal ) wurde geboren am 3 Jan 1290; gestorben am 18 Nov 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. |  Beatrix von Kastilien Beatrix von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beatrix von Kastilien hatte mit Alfons IV. sieben Kinder, drei Töchter und vier Söhne. Beatrix heiratete König Alfons IV. von Portugal, der Kühne in 1309. Alfons (Sohn von König Dionysius von Portugal und Isabella von Aragón, die Heilige Elisabeth von Portugal ) wurde geboren am 8 Feb 1291 in Coimbra; gestorben am 28 Mai 1357 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Beatriz heiratete Herr Pedro Fernandes de Castro in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. |  Constança Manuel de Villena (Castilla) Constança Manuel de Villena (Castilla) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Constança_Manuel (Aug 2023) Constança heiratete König Alfons XI. von Kastilien in cir 1325, und geschieden in 1327. Alfons (Sohn von König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) und Konstanze von Portugal) wurde geboren am 13 Aug 1311 in Salamanca; gestorben am 26 Mrz 1350 in vor Gibraltar; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel] Constança heiratete König Peter I. von Portugal in 1339. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren am 8 Apr 1320 in Coimbra; gestorben am 18 Jan 1367 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 79. |  Juana Manuel de Villena Juana Manuel de Villena Familie/Ehepartner: Heinrich II. von Kastilien (Trastámara). Heinrich (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Leonor Núñez de Guzmán) wurde geboren am 13 Jan 1334 in Sevilla; gestorben am 29 Mai 1379 in Santo Domingo de la Calzada; wurde beigesetzt in Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 80. |  Graf Johann II. von Aumale Graf Johann II. von Aumale Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. |  König Eduard III. von England (Plantagenêt) König Eduard III. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_III._(England) Eduard heiratete Philippa von Hennegau (von Avesnes) in 1328. Philippa (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren am 24 Jun 1311 in Valenciennes, Frankreich; gestorben am 14 Aug 1369 in Windsor. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. |  Johanna von England (Plantagenêt) Johanna von England (Plantagenêt) Johanna heiratete David II. von Schottland am 17 Jul 1328. David (Sohn von König Robert I. (Robert Bruce) von Schottland und Elizabeth de Burgh) wurde geboren am 5 Mrz 1324 in Dunfermline, Fife; gestorben am 22 Feb 1371 in Edinburgh Castle. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 83. |  Eleonore von Bar- Scarponnois Eleonore von Bar- Scarponnois Eleonore heiratete Llywelyn von Deheubarth (ap Owain) in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. |  Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_I._(Bar) Eduard heiratete Marie von Burgund in 1310. Marie (Tochter von Herzog Robert II. von Burgund und Prinzessin Agnes von Frankreich) wurde geboren in 1296; gestorben in vor 1336. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. |  Eleanor de Clare Eleanor de Clare Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleanor_de_Clare Eleanor heiratete Sir Hugh le Despenser, der Jüngere am 26 Mai 1306 in Westminster Abbey, London, England. Hugh (Sohn von Hugh le Despenser, 1. Earl of Winchester und Isabella de Beauchamp) wurde geboren in 1286; gestorben am 24 Nov 1326 in Hereford, England; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey, Plymouth, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Eleanor heiratete William la Zouche, 1. Baron Zouche of Mortimer in 1329. William gestorben am 28 Feb 1337. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 86. |  Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Brabant) Johann heiratete Maria von Évreux in 1311. Maria (Tochter von Graf Ludwig von Évreux und Margarete von Artois) wurde geboren in 1303; gestorben am 31 Okt 1335. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. |  Graf William de Bohun, 1st Earl of Northampton Graf William de Bohun, 1st Earl of Northampton Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/William_de_Bohun,_1._Earl_of_Northampton (Sep 2021) William heiratete Elizabeth de Badlesmere in cir 1335. Elizabeth (Tochter von Bartholomew de Badlesmere, 1 Baron Badlesmere und Margaret de Clare) wurde geboren in 1313; gestorben am 8 Jun 1356. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 88. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Catherine und Karl I. hatten vier Kinder, einen Sohn und drei Töchter. Catherine heiratete Karl I. von Valois (Kapetinger) in 1301. Karl (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Königin Isabella von Aragón) wurde geboren am 12 Mrz 1270 in Schloss Vincennes; gestorben am 05/06 Dez 1325 in Nogent-le-Roi, Frankreich; wurde beigesetzt in Kirche Saint-Jacques, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. |  Graf Johann III. von Brienne Graf Johann III. von Brienne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._von_Eu Familie/Ehepartner: Johanna von Guînes (von Gent). Johanna (Tochter von Herr Enguerrand V. (Balduin?) von Coucy (von Guînes-Gent)) gestorben in 1332. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. |  Isabelle von Brienne Isabelle von Brienne Notizen: Geburt: Isabelle heiratete Johann II. (Jean) von Dampierre in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre und Laura von Lothringen) gestorben in vor 1307. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Prinzessin Eleonore von Kastilien Prinzessin Eleonore von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1307–1359) (Dez 2022) Eleonore heiratete König Alfons IV. von Aragón am 5 Feb 1329 in Tarazona. Alfons (Sohn von König Jakob II. von Aragón und Blanche von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1299 in Neapel, Italien; gestorben am 24 Jan 1336 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 92. | 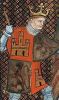 König Alfons XI. von Kastilien König Alfons XI. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_XI. (Okt 2017) Alfons heiratete Constança Manuel de Villena (Castilla) in cir 1325, und geschieden in 1327. Constança (Tochter von Don Juan Manuel) wurde geboren in cir 1318; gestorben am 13 Nov 1345. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Maria von Portugal in Mrz 1328. Maria (Tochter von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren in 1313; gestorben am 18 Jan 1357 in Évora; wurde beigesetzt in Kloster San Clemente de Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Leonor Núñez de Guzmán. Leonor (Tochter von Pedro Núñez de Guzmán Gonzales und Beatriz Ponce de León y Meneses) wurde geboren in 1310 in Sevilla; gestorben in 1351 in Talavera de la Reina. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. |  Maria von Portugal Maria von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria und Alfons XI. hatten zwei Söhne. Maria heiratete König Alfons XI. von Kastilien in Mrz 1328. Alfons (Sohn von König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) und Konstanze von Portugal) wurde geboren am 13 Aug 1311 in Salamanca; gestorben am 26 Mrz 1350 in vor Gibraltar; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 94. |  König Peter I. von Portugal König Peter I. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_I._(Portugal) (Okt 2017) Peter heiratete Branca (Blanche) von Kastilien in 1325, und geschieden. [Familienblatt] [Familientafel] Peter heiratete Constança Manuel de Villena (Castilla) in 1339. Constança (Tochter von Don Juan Manuel) wurde geboren in cir 1318; gestorben am 13 Nov 1345. [Familienblatt] [Familientafel]
Peter heiratete Inês de Castro in 1354. Inês (Tochter von Herr Pedro Fernandes de Castro und Aldonça Lourenço de Valadares) wurde geboren in 1320/1325 in Galizien; gestorben am 7 Jan 1355 in Coimbra; wurde beigesetzt in Kloster von Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Teresa Lourenço. Teresa wurde geboren in 1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 95. |  Prinzessin Eleonore (Leonor) von Portugal Prinzessin Eleonore (Leonor) von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1307–1359) (Aug 2023) Eleonore heiratete König Peter IV. von Aragón in 1347. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Aragón und Gräfin Teresa d’Entença (von Urgell)) wurde geboren am 5 Sep 1319 in Balaguer; gestorben am 6 Jan 1387 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 96. |  Herrin Juana (Joana) de Castro Herrin Juana (Joana) de Castro Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: König Peter I. von Kastilien. Peter (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Maria von Portugal) wurde geboren am 30 Aug 1334 in Provinz Burgos; gestorben am 23 Mrz 1369 in bei Montiel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 97. |  Katharina (Catharina) von Holstein Katharina (Catharina) von Holstein Familie/Ehepartner: Herzog Otto I. von Pommern (Greifen). Otto (Sohn von Herzog Barnim I. von Pommern (Greifen) und Mechtilde (Mathilde) von Brandenburg) wurde geboren in 1279; gestorben am 30/31 Dez 1344. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 98. |  Graf Gerhard IV. von Holstein-Plön Graf Gerhard IV. von Holstein-Plön Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_IV._(Holstein-Plön) (Aug 2023) Gerhard heiratete Anastasia von Schwerin am 30 Jul 1313. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 99. |  Elisabeth (Rixa) von Polen Elisabeth (Rixa) von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Elisabeth und Wenzel II. hatten eine Tochter. Elisabeth heiratete König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) in 1303. Wenzel (Sohn von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren am 27 Sep 1271; gestorben am 21 Jun 1305 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Kirche des Kloster Königsaal. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) am 16 Okt 1306. Rudolf (Sohn von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1282; gestorben am 4 Jul 1307 in bei Horaschdowitz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 100. |  Mathilde von Anhalt-Zerbst Mathilde von Anhalt-Zerbst Mathilde heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in 1339. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 101. |  Herr Johann III. zu Werle Herr Johann III. zu Werle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Werle) (Jun 2021) Johann heiratete Mechthild von Pommern in 1317. Mechthild (Tochter von Herzog Otto I. von Pommern (Greifen) und Elisabeth von Schwerin) gestorben in cir 1331/1332. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Richardis in nach 1332. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 102. | Margarete von Dänemark Notizen: Margarete hatte mit Ludwig V. eine Tochter. Margarete heiratete Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) am 30 Nov 1324 in Königreich Dänemark. Ludwig (Sohn von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Beatrix von Schlesien-Schweidnitz) wurde geboren in Mai 1315; gestorben am 18 Sep 1361 in Zorneding bei München. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 103. |  Konstanze von Portugal Konstanze von Portugal Konstanze heiratete König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) in 1302. Ferdinand (Sohn von König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere und Königin Maria de Molina) wurde geboren am 6 Dez 1285; gestorben am 7 Sep 1312 in Jaén; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. |  König Alfons IV. von Portugal, der Kühne König Alfons IV. von Portugal, der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_IV._(Portugal) (Apr 2018) Alfons heiratete Beatrix von Kastilien in 1309. Beatrix (Tochter von König Sancho IV. von León (von Kastilien), der Tapfere und Königin Maria de Molina) wurde geboren in 1293; gestorben am 25 Okt 1359. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 105. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Beatriz heiratete Herr Pedro Fernandes de Castro in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. |  Prinz Theodor I. (Theodoros) von Montferrat (Byzanz, Palaiologen) Prinz Theodor I. (Theodoros) von Montferrat (Byzanz, Palaiologen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_I._(Montferrat) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Argentina Spinola. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 107. |  Prinzessin Eleonore von Kastilien Prinzessin Eleonore von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1307–1359) (Dez 2022) Eleonore heiratete König Alfons IV. von Aragón am 5 Feb 1329 in Tarazona. Alfons (Sohn von König Jakob II. von Aragón und Blanche von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1299 in Neapel, Italien; gestorben am 24 Jan 1336 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 108. | 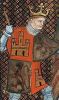 König Alfons XI. von Kastilien König Alfons XI. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_XI. (Okt 2017) Alfons heiratete Constança Manuel de Villena (Castilla) in cir 1325, und geschieden in 1327. Constança (Tochter von Don Juan Manuel) wurde geboren in cir 1318; gestorben am 13 Nov 1345. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Maria von Portugal in Mrz 1328. Maria (Tochter von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren in 1313; gestorben am 18 Jan 1357 in Évora; wurde beigesetzt in Kloster San Clemente de Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Leonor Núñez de Guzmán. Leonor (Tochter von Pedro Núñez de Guzmán Gonzales und Beatriz Ponce de León y Meneses) wurde geboren in 1310 in Sevilla; gestorben in 1351 in Talavera de la Reina. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. |  Maria von Portugal Maria von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria und Alfons XI. hatten zwei Söhne. Maria heiratete König Alfons XI. von Kastilien in Mrz 1328. Alfons (Sohn von König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) und Konstanze von Portugal) wurde geboren am 13 Aug 1311 in Salamanca; gestorben am 26 Mrz 1350 in vor Gibraltar; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 110. |  König Peter I. von Portugal König Peter I. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_I._(Portugal) (Okt 2017) Peter heiratete Branca (Blanche) von Kastilien in 1325, und geschieden. [Familienblatt] [Familientafel] Peter heiratete Constança Manuel de Villena (Castilla) in 1339. Constança (Tochter von Don Juan Manuel) wurde geboren in cir 1318; gestorben am 13 Nov 1345. [Familienblatt] [Familientafel]
Peter heiratete Inês de Castro in 1354. Inês (Tochter von Herr Pedro Fernandes de Castro und Aldonça Lourenço de Valadares) wurde geboren in 1320/1325 in Galizien; gestorben am 7 Jan 1355 in Coimbra; wurde beigesetzt in Kloster von Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Teresa Lourenço. Teresa wurde geboren in 1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 111. |  Prinzessin Eleonore (Leonor) von Portugal Prinzessin Eleonore (Leonor) von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1307–1359) (Aug 2023) Eleonore heiratete König Peter IV. von Aragón in 1347. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Aragón und Gräfin Teresa d’Entença (von Urgell)) wurde geboren am 5 Sep 1319 in Balaguer; gestorben am 6 Jan 1387 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 112. |  Herrin Juana (Joana) de Castro Herrin Juana (Joana) de Castro Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: König Peter I. von Kastilien. Peter (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Maria von Portugal) wurde geboren am 30 Aug 1334 in Provinz Burgos; gestorben am 23 Mrz 1369 in bei Montiel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 113. |  König Ferdinand I. von Portugal König Ferdinand I. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Portugal) (Aug 2023) Ferdinand heiratete Königin Leonore Teles de Menezes in 1371. Leonore wurde geboren in cir 1350 in Provinz Trás-os-Montes e Alto Douro; gestorben am 27 Apr 1386 in Tordesillas; wurde beigesetzt in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 114. |  Eleonore von Kastilien (Trastámara) Eleonore von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1363–1416) (Okt 2017) Eleonore heiratete König Karl III. von Navarra am 27 Mai 1375. Karl (Sohn von König Karl II. von Navarra, der Böse und Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in 1361 in Mantes-la-Jolie, Yvelines, Frankreich; gestorben am 8 Sep 1425 in Olite; wurde beigesetzt in Kathedrale, Pamplona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 115. |  König Johann I. von Kastilien (Trastámara) König Johann I. von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Kastilien) (Okt 2022) Familie/Ehepartner: Eleonore von Aragón. Eleonore (Tochter von König Peter IV. von Aragón und Eleonore von Aragón (von Sizilien)) wurde geboren in 1358; gestorben in 1382. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Beatrix von Portugal in 1382. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 116. |  Gräfin Blanche von Aumale (Ponthieu?) Gräfin Blanche von Aumale (Ponthieu?) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Blanche heiratete Graf Jean V. von Harcourt in Datum unbekannt. Jean (Sohn von Graf Jean IV. von Harcourt und Herrin von Vibraye Isabeau von Parthenay) gestorben in 1355. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 117. |  Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Woodstock Edward heiratete Joan von Kent in 1361. Joan (Tochter von Graf Edmund von Kent (von Woodstock) und Margaret von Liddell) wurde geboren am 29 Sep 1328 in Woodstock, Oxfordshire; gestorben am 7 Aug 1385 in Wallingford, Oxfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 118. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_de_Coucy Isabella heiratete Herr Enguerrand VII. von Coucy in 1365. Enguerrand (Sohn von Herr Enguerrand VI. von Coucy und Katharina von Österreich) wurde geboren in cir 1339; gestorben am 18 Feb 1397 in Bursa, Türkei. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lionel_of_Antwerp,_1._Duke_of_Clarence Lionel heiratete Gräfin Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster am 15 Aug 1342 in Tower of London. Elizabeth (Tochter von William von Burgh, 3. Earl of Ulster und Matilda (Maud) von Lancaster) wurde geboren am 6 Jul 1332 in Carrickfergus Castle; gestorben am 10 Dez 1363 in Dublin, Irland; wurde beigesetzt in Priorat von Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 120. |  Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_of_Gaunt,_1._Duke_of_Lancaster (Okt 2017) John heiratete Blanche von Lancaster in 1359. Blanche (Tochter von Henry of Grosmont (Lancaster) und Isabel von Beaumont) wurde geboren in 25 Mär 1341 od 1345; gestorben am 12 Sep 1368 in Bolingbroke Castle, Lincolnshire; wurde beigesetzt in St Paul’s Cathedral. [Familienblatt] [Familientafel]
John heiratete Konstanze von Kastilien in 1371. Konstanze (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1354; gestorben in 1394. [Familienblatt] [Familientafel]
John heiratete Katherine (Catherine) Swynford (geb: de Roet (Rouet)) am 13 Jan 1396. Katherine (Tochter von Ritter Gilles (Payne) de Roet (Rouet)) wurde geboren in cir 1350 in Mony, Grafschaft Hennegau, Flandern; gestorben am 10 Mai 1403 in Lincoln, England; wurde beigesetzt in Lincoln Cathedral, Lincoln, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Marie de St. Hillaire. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 121. | 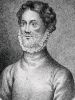 Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_of_Langley,_1._Duke_of_York Edmund heiratete Isabella von Kastilien in 1372 in Hertford Castle. Isabella (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1355 in Morales, Spanien; gestorben am 23 Dez 1392 in Hertford Castle, Hertford, Hertfordshire; wurde beigesetzt am 14 Jan 1393 in Kings Langley Manor House in Hertfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]
Edmund heiratete Johanna Holland in nach 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 122. |  Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria heiratete Herzog Johann V. von Bretagne in 1355. Johann (Sohn von Graf Johann IV. von der Bretagne (von Montfort) und Johanna von Flandern) wurde geboren in 1339; gestorben am 1 Nov 1399 in Nantes; wurde beigesetzt in Kathedrale von Nantes. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 123. |  Herzog Thomas von Woodstock (von England) Herzog Thomas von Woodstock (von England) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_of_Woodstock,_1._Duke_of_Gloucester Thomas heiratete Gräfin Eleanor de Bohun in zw 1374 und 1376. Eleanor (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1366; gestorben am 3 Okt 1399 in Minoritenkloster Aldgate in London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 124. |  Thomas von Deheubarth (ap Llywelyn) Thomas von Deheubarth (ap Llywelyn) Thomas heiratete Eleanor von Iscoed in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 125. |  Graf Heinrich IV. von Bar-Scarponnois Graf Heinrich IV. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(Bar) Heinrich heiratete Yolande de Dampierre in 1338. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 126. |  Alienor von Bar-Scarponnois Alienor von Bar-Scarponnois Alienor heiratete Herzog Rudolf von Lothringen am 25 Jun 1329. Rudolf (Sohn von Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur und Herzogin Elisabeth von Österreich (von Habsburg)) wurde geboren in 1320; gestorben am 26 Aug 1346. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 127. |  Elizabeth le Despenser Elizabeth le Despenser Elizabeth heiratete Maurice de Berkeley in Datum unbekannt. Maurice (Sohn von Sir Thomas de Berkeley und Margaret Mortimer) wurde geboren in cir 1330; gestorben in 1368. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 128. |  Isabel le Despenser Isabel le Despenser Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_le_Despenser_(Adlige,_um_1313) Isabel heiratete Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel am 9 Feb 1321. Richard (Sohn von Graf Edmund FitzAlan, 9. Earl of Arundel und Alice de Warenne) wurde geboren in 1313; gestorben in 1376. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 129. |  Gräfin Margarete von Brabant Gräfin Margarete von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Das einzige überlebende Kind, das aus dieser Beziehung hervorging, war die am 13. April 1350 getaufte Tochter Margarete. Margarete heiratete Graf Ludwig II. von Flandern am 1 Jul 1347. Ludwig (Sohn von Graf Ludwig I. von Flandern (von Nevers) und Gräfin Margarete I. von Frankreich (von Artois)) wurde geboren am 25 Okt 1330 in Male, Belgien; gestorben am 30 Jan 1384 in Lille; wurde beigesetzt in Stiftskirche Saint-Pierre, Lille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 130. |  Graf Humphrey de Bohun Graf Humphrey de Bohun Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Humphrey_de_Bohun,_7._Earl_of_Hereford Humphrey heiratete Joan FitzAlan in nach 09 Sep 1359. Joan (Tochter von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1347; gestorben in 1419. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 131. |  Gräfin Elizabeth de Bohun Gräfin Elizabeth de Bohun Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Bohun Elizabeth heiratete Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel in 1359. Richard (Sohn von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1346; gestorben am 21 Sep 1397. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 132. |  Johanna (Jeanne) von Valois Johanna (Jeanne) von Valois Notizen: Johanna und Robert III. hatten sieben Kinder, zwei Töchter und fünf Söhne. Johanna heiratete Graf Robert III. von Artois in 1318. Robert (Sohn von Graf Philippe von Artois und Blanche (Blanka) von der Bretagne) wurde geboren in 1287; gestorben in 1342 in London, England; wurde beigesetzt in St Paul’s Cathedral in London. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 133. |  Graf Rudolf I. (Raoul) von Brienne (von Eu und Guînes) Graf Rudolf I. (Raoul) von Brienne (von Eu und Guînes) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raoul_I._de_Brienne Rudolf heiratete Herrin Jeanne de Mello in 1315. Jeanne (Tochter von Dreux IV. de Mello und Jeanne von Toucy) gestorben in 1351. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 134. |  Marguerite von Dampierre Marguerite von Dampierre Notizen: Name: Marguerite heiratete Graf Walter II. (Gaucher) von Châtillon-Porcéan in 1305. Walter (Sohn von Graf Walter V. (Gaucher) von Châtillon-Porcéan) gestorben am 25 Aug 1325. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 135. |  König Peter I. von Kastilien König Peter I. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_I._(Kastilien) (Okt 2017) Peter heiratete María de Padilla in 1353. María (Tochter von Juan García de Padilla und María Fernández de Henestrosa) wurde geboren in 1334; gestorben in 1361 in Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Peter heiratete Königin Blanche von Bourbon am 3 Jun 1353 in Valladolid, Spanien. Blanche (Tochter von Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon und Isabella von Valois) wurde geboren in 1339; gestorben in 1361. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herrin Juana (Joana) de Castro. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 136. |  Herr Pedro Alfonso von Aguilar (Kastilien) Herr Pedro Alfonso von Aguilar (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Pedro heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 137. |  Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Trastámara (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel de Villena. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 138. |  Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Sancho heiratete Beatriz von Portugal in Mrz 1373. Beatriz (Tochter von König Peter I. von Portugal und Inês de Castro) wurde geboren in cir 1347 in Coimbra; gestorben am 5 Jul 1381 in Ledesma. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 139. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrice_von_Portugal (Sep 2017) Beatriz heiratete Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) in Mrz 1373. Sancho (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Leonor Núñez de Guzmán) wurde geboren in 1342; gestorben in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 140. |  Johann I. von Portugal (Avis) Johann I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Portugal) (Sep 2017) Johann heiratete Prinzessin Philippa von Lancaster in Feb 1387. Philippa (Tochter von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Blanche von Lancaster) wurde geboren am 31 Mrz 1360 in Leicester Castle; gestorben am 19 Jul 1415 in Sacavém. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Inêz Pirez. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 141. |  Nikolaus IV. zu Werle-Goldberg Nikolaus IV. zu Werle-Goldberg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_IV._(Werle) (Jun 2021) Familie/Ehepartner: Agnes von Lindow-Ruppin. Agnes (Tochter von Ulrich II. von Lindow-Ruppin) gestorben in nach 1361. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 142. |  Prinzessin Eleonore von Kastilien Prinzessin Eleonore von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1307–1359) (Dez 2022) Eleonore heiratete König Alfons IV. von Aragón am 5 Feb 1329 in Tarazona. Alfons (Sohn von König Jakob II. von Aragón und Blanche von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1299 in Neapel, Italien; gestorben am 24 Jan 1336 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 143. | 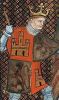 König Alfons XI. von Kastilien König Alfons XI. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_XI. (Okt 2017) Alfons heiratete Constança Manuel de Villena (Castilla) in cir 1325, und geschieden in 1327. Constança (Tochter von Don Juan Manuel) wurde geboren in cir 1318; gestorben am 13 Nov 1345. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Maria von Portugal in Mrz 1328. Maria (Tochter von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren in 1313; gestorben am 18 Jan 1357 in Évora; wurde beigesetzt in Kloster San Clemente de Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Leonor Núñez de Guzmán. Leonor (Tochter von Pedro Núñez de Guzmán Gonzales und Beatriz Ponce de León y Meneses) wurde geboren in 1310 in Sevilla; gestorben in 1351 in Talavera de la Reina. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 144. |  Maria von Portugal Maria von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria und Alfons XI. hatten zwei Söhne. Maria heiratete König Alfons XI. von Kastilien in Mrz 1328. Alfons (Sohn von König Ferdinand IV. von León (von Kastilien) und Konstanze von Portugal) wurde geboren am 13 Aug 1311 in Salamanca; gestorben am 26 Mrz 1350 in vor Gibraltar; wurde beigesetzt in Kirche San Hipólito in Cordoba. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 145. |  König Peter I. von Portugal König Peter I. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_I._(Portugal) (Okt 2017) Peter heiratete Branca (Blanche) von Kastilien in 1325, und geschieden. [Familienblatt] [Familientafel] Peter heiratete Constança Manuel de Villena (Castilla) in 1339. Constança (Tochter von Don Juan Manuel) wurde geboren in cir 1318; gestorben am 13 Nov 1345. [Familienblatt] [Familientafel]
Peter heiratete Inês de Castro in 1354. Inês (Tochter von Herr Pedro Fernandes de Castro und Aldonça Lourenço de Valadares) wurde geboren in 1320/1325 in Galizien; gestorben am 7 Jan 1355 in Coimbra; wurde beigesetzt in Kloster von Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Teresa Lourenço. Teresa wurde geboren in 1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 146. |  Prinzessin Eleonore (Leonor) von Portugal Prinzessin Eleonore (Leonor) von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1307–1359) (Aug 2023) Eleonore heiratete König Peter IV. von Aragón in 1347. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Aragón und Gräfin Teresa d’Entença (von Urgell)) wurde geboren am 5 Sep 1319 in Balaguer; gestorben am 6 Jan 1387 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 147. |  Herrin Juana (Joana) de Castro Herrin Juana (Joana) de Castro Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: König Peter I. von Kastilien. Peter (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Maria von Portugal) wurde geboren am 30 Aug 1334 in Provinz Burgos; gestorben am 23 Mrz 1369 in bei Montiel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 148. |  Violante (Yolanda) von Montferrat (Byzanz, Palaiologen) Violante (Yolanda) von Montferrat (Byzanz, Palaiologen) Violante heiratete Graf Aymon von Savoyen am 1 Mai 1330 in Casale, Vercelli. Aymon (Sohn von Graf Amadeus V. von Savoyen und Sibylle von Bagé) wurde geboren am 15 Dez 1273 in Bourg-en-Bresse; gestorben am 24 Jun 1343 in Montmélian. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 149. |  König Peter I. von Kastilien König Peter I. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_I._(Kastilien) (Okt 2017) Peter heiratete María de Padilla in 1353. María (Tochter von Juan García de Padilla und María Fernández de Henestrosa) wurde geboren in 1334; gestorben in 1361 in Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Peter heiratete Königin Blanche von Bourbon am 3 Jun 1353 in Valladolid, Spanien. Blanche (Tochter von Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon und Isabella von Valois) wurde geboren in 1339; gestorben in 1361. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herrin Juana (Joana) de Castro. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 150. |  Herr Pedro Alfonso von Aguilar (Kastilien) Herr Pedro Alfonso von Aguilar (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Pedro heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 151. |  Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Trastámara (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel de Villena. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 152. |  Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Sancho heiratete Beatriz von Portugal in Mrz 1373. Beatriz (Tochter von König Peter I. von Portugal und Inês de Castro) wurde geboren in cir 1347 in Coimbra; gestorben am 5 Jul 1381 in Ledesma. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 153. |  König Ferdinand I. von Portugal König Ferdinand I. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Portugal) (Aug 2023) Ferdinand heiratete Königin Leonore Teles de Menezes in 1371. Leonore wurde geboren in cir 1350 in Provinz Trás-os-Montes e Alto Douro; gestorben am 27 Apr 1386 in Tordesillas; wurde beigesetzt in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 154. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrice_von_Portugal (Sep 2017) Beatriz heiratete Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) in Mrz 1373. Sancho (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Leonor Núñez de Guzmán) wurde geboren in 1342; gestorben in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 155. |  Johann I. von Portugal (Avis) Johann I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Portugal) (Sep 2017) Johann heiratete Prinzessin Philippa von Lancaster in Feb 1387. Philippa (Tochter von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Blanche von Lancaster) wurde geboren am 31 Mrz 1360 in Leicester Castle; gestorben am 19 Jul 1415 in Sacavém. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Inêz Pirez. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 156. |  Beatrix von Portugal Beatrix von Portugal Beatrix heiratete König Johann I. von Kastilien (Trastámara) in 1382. Johann (Sohn von Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) und Juana Manuel de Villena) wurde geboren am 24 Aug 1358 in Épila, Saragossa; gestorben am 9 Okt 1390 in Alcalá de Henares, Madrid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 157. |  Johanna (Jeanne) von Navarra Johanna (Jeanne) von Navarra Johanna heiratete Graf Johann I. (Jean) von Foix-Grailly in 1402. Johann (Sohn von Archambaud von Grailly und Gräfin Isabelle von Foix (von Castelbon)) wurde geboren in 1382; gestorben am 4 Mai 1436 in Mazères. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 158. |  Königin Blanka von Navarra Königin Blanka von Navarra Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Blanka_(Navarra) (Nov 2018) Blanka heiratete Martin I. von Sizilien (von Aragón), der Junge in Nov 1402. Martin (Sohn von König Martin I. von Aragón und Königin Maria de Luna) wurde geboren in 1376; gestorben am 15 Jul 1409 in Cagliari. [Familienblatt] [Familientafel] Blanka heiratete König Johann II. von von Aragón (Trastámara) in 1420. Johann (Sohn von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 29 Jun 1397 od 1398 in Medina del Campo; gestorben am 19 Jan 1479 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 159. |  Beatrice von Navarra (Evreux) Beatrice von Navarra (Evreux) Beatrice heiratete Graf Jacques II. von Bourbon-La Marche am 14 Sep 1406 in Pamplona. Jacques (Sohn von Graf Jean I. von Bourbon-La Marche und Gräfin Catherine von Vendôme (Montoire)) wurde geboren in 1370; gestorben am 24 Sep 1438 in Besançon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 160. |  Isabella von Navarra Isabella von Navarra Isabella heiratete Graf Jean IV. (Johann) von Armagnac am 10 Mai 1419. Jean (Sohn von Graf Bernard VII. von Armagnac und Bonne (Bona) von Valois (von Berry)) wurde geboren am 15 Okt 1396 in Rodez; gestorben am 5 Nov 1450 in l’Isle-Jourdain. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 161. |  König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Kastilien) (Okt 2017) Heinrich heiratete Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) in 1388. Katharina (Tochter von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Konstanze von Kastilien) wurde geboren in Wahrscheinlich 13.3.1373 in Hertford; gestorben am 2 Jun 1418 in Valladolid, Spanien; wurde beigesetzt in Capilla de los Reyes Nuevos in der Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 162. | 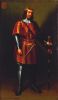 König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Aragón) (Okt 2017) Ferdinand heiratete Eleonore Urraca von Kastilien in 1394. Eleonore (Tochter von Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) und Beatriz von Portugal) wurde geboren in 1374 in Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, Spanien; gestorben am 16 Dez 1435 in Medina del Campo, Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 163. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Jean heiratete Cathérine von Bourbon in 1359. Cathérine (Tochter von Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon und Isabella von Valois) wurde geboren in 1342; gestorben in 1427. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 164. |  König Richard II. von England (Plantagenêt) König Richard II. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_II._(England) Richard heiratete Anne von Luxemburg (von Böhmen) am 20 Jan 1382 in Westminster Abbey, London, England. Anne (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Kaiserin Elisabeth von Pommern) wurde geboren am 11 Mai 1366 in Prag, Tschechien; gestorben am 7 Jun 1394 in Sheen, Richmond. [Familienblatt] [Familientafel] Richard heiratete Prinzessin Isabella von Frankreich (von Valois) am 4 Nov 1396 in Kirche Saint-Nicolas, Calais. Isabella (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 9 Nov 1389 in Paris, France; gestorben am 13 Sep 1409 in Blois; wurde beigesetzt in Kapelle Nôtre Dame des Bonnes Nouvelles der Abtei Saint-Laumer (heute die Kirche Saint-Nicolas) in Blois, dann 1624 Kirche der Cölestiner zu Paris. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 165. |  Herrin Mary von Coucy Herrin Mary von Coucy Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Coucy Mary heiratete Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) in 1383. Heinrich (Sohn von Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois und Maria von Frankreich (Valois)) wurde geboren in 1362; gestorben in Nov 1397 in Treviso. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 166. |  Philippa von Coucy Philippa von Coucy Notizen: Name: Philippa heiratete Graf Robert de Vere, 9. Earl of Oxford in 1376, und geschieden in 1389. Robert (Sohn von Thomas de Vere, 8. Earl of Oxford und Maud Ufford) wurde geboren am 13 Jan 1361; gestorben in 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 167. |  Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippa_Plantagenet,_5._Countess_of_Ulster Philippa heiratete Graf Edmund Mortimer, 3. Earl of March in 1368. Edmund (Sohn von Graf Roger Mortimer, 2. Earl of March und Philippa Montacute (Montagu)) wurde geboren am 1 Feb 1352; gestorben am 27 Dez 1381 in Cork; wurde beigesetzt in Wigmore Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 168. | 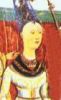 Prinzessin Philippa von Lancaster Prinzessin Philippa von Lancaster Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Philippa und Johann hatten neun Kinder, drei Töchter und sechs Söhne. Philippa heiratete Johann I. von Portugal (Avis) in Feb 1387. Johann (Sohn von König Peter I. von Portugal und Teresa Lourenço) wurde geboren am 11 Apr 1357 in Lissabon; gestorben am 14 Aug 1433 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 169. |  König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Der erste englische König aus dem Hause Lancaster Heinrich heiratete Mary de Bohun in 1380. Mary (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1369; gestorben am 4 Jun 1394; wurde beigesetzt in St. Mary's Church, Leicester.. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Johanna von Navarra in 1402. Johanna (Tochter von König Karl II. von Navarra, der Böse und Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in 1370; gestorben am 9 Jul 1437 in Havering-atte-Bower; wurde beigesetzt in Kathedrale von Canterbury. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 170. |  Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Lancaster (Sep 2017) Katharina heiratete König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche in 1388. Heinrich (Sohn von König Johann I. von Kastilien (Trastámara) und Eleonore von Aragón) wurde geboren am 4 Okt 1379 in Burgos; gestorben am 25 Dez 1406 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Capilla de los Reyes Nuevos in der Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 171. |  Graf John Beaufort, 1. Earl of Somerset Graf John Beaufort, 1. Earl of Somerset Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Beaufort,_1._Earl_of_Somerset John heiratete Margaret Holland in 1397. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 172. |  Joan Beaufort Joan Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Joan und Robert hatten zwei Töchter. Familie/Ehepartner: Robert de Ferrers. Robert wurde geboren in cir 1376; gestorben in zw Mai 1395 und Nov 1396. [Familienblatt] [Familientafel] Joan heiratete Ralph Neville, 1. Earl of Westmorland am 29 Nov 1396. Ralph (Sohn von Baron John Neville und Maud Percy) wurde geboren in 1364 in Raby Castle, England; gestorben am 21 Okt 1425 in Raby Castle, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 173. |  Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_of_Conisburgh,_1._Earl_of_Cambridge Richard heiratete Anne Mortimer in 1406. Anne (Tochter von Roger Mortimer, 4. Earl of March und Eleanor (1) (Alianore) Holland) wurde geboren in 27 Dez 1388 od 1390; gestorben am 21 Sep 1411. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 174. | Constance Langley Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Constance_Langley Constance heiratete Graf Thomas le Despenser in Nov 1379. Thomas (Sohn von Baron Edward le Despenser und Elizabeth Burghersh) wurde geboren am 22 Sep 1373; gestorben am 13 Jan 1400 in Bristol, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Edmund Holland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 175. |  Margaret von Deheubarth (ferch Thomas) (Haus Gwynedd) Margaret von Deheubarth (ferch Thomas) (Haus Gwynedd) Margaret heiratete Herr Tudor Vychan (Fychan) in Datum unbekannt. Tudor (Sohn von Gronw Fychan (ap Tewdwr "Tudor")) gestorben in 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 176. |  Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_I._(Bar) Robert heiratete Maria von Frankreich (Valois) in 1364. Maria (Tochter von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 12 Sep 1344; gestorben am 15 Okt 1404. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 177. |  Gräfin Margarete III. von Flandern Gräfin Margarete III. von Flandern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_III._(Flandern) Margarete heiratete Herzog Philipp II. von Burgund (Valois), der Kühne in 1369. Philipp (Sohn von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 15 Jan 1342 in Pontoise; gestorben am 27 Apr 1404 in Halle im Hennegau; wurde beigesetzt in Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 178. |  Gräfin Eleanor de Bohun Gräfin Eleanor de Bohun Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eleanor und Thomas hatten einen Sohn und vier Töchter. Eleanor heiratete Herzog Thomas von Woodstock (von England) in zw 1374 und 1376. Thomas (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 7 Jan 1355 in Woodstock Palace, Oxfordshire; gestorben am 8 Sep 1397 in Calais. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 179. |  Mary de Bohun Mary de Bohun Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_de_Bohun (Jun 2018) Mary heiratete König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) in 1380. Heinrich (Sohn von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Blanche von Lancaster) wurde geboren in Apr od Mai 1366 od 1367 in Bolingbroke Castle, Lincolnshire; gestorben am 20 Mrz 1413 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 180. |  Lady Elizabeth FitzAlan Lady Elizabeth FitzAlan Elizabeth heiratete William Montagu in cir 1383. William (Sohn von William Montagu, 2. Earl of Salisbury und Elizabeth von Mohun) gestorben am 6 Aug 1383. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 181. |  Thomas FitzAlan, 12 Earl of Arundel Thomas FitzAlan, 12 Earl of Arundel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Fitzalan,_12._Earl_of_Arundel (Aug 2023) |
| 182. |  Graf Johann (Jean) von Artois, Ohneland Graf Johann (Jean) von Artois, Ohneland Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_d’Artois,_comte_d’Eu Familie/Ehepartner: Isabelle von Melun. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 183. |  Graf Rudolf (Raoul) II. von Brienne (von Eu und Guînes) Graf Rudolf (Raoul) II. von Brienne (von Eu und Guînes) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raoul_II._de_Brienne Rudolf heiratete Herrin Katharina von der Waadt (von Savoyen) in 1340. Katharina (Tochter von Herr Ludwig II. von der Waadt (von Savoyen) und Isabelle von Chalon (von Arlay)) gestorben in 1388. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 184. |  Konstanze von Kastilien Konstanze von Kastilien Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanze_von_Kastilien Konstanze heiratete Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt in 1371. John (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 6 Mrz 1340 in Gent; gestorben am 3 Feb 1399 in Leicester. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 185. |  Isabella von Kastilien Isabella von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Isabella und Edmund hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Isabella heiratete Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) in 1372 in Hertford Castle. Edmund (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 5 Jun 1341 in Kings Langley, Hertfordshire; gestorben am 1 Aug 1402 in Kings Langley, Hertfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 186. |  Branca (Blanche) von Kastilien Branca (Blanche) von Kastilien Notizen: Branca und Peter I. hatten keine Kinder. Branca heiratete König Peter I. von Portugal in 1325, und geschieden. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren am 8 Apr 1320 in Coimbra; gestorben am 18 Jan 1367 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 187. |  Herr Alonso Enríquez (Kastilien) Herr Alonso Enríquez (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 188. |  Eleonore von Kastilien (Trastámara) Eleonore von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1363–1416) (Okt 2017) Eleonore heiratete König Karl III. von Navarra am 27 Mai 1375. Karl (Sohn von König Karl II. von Navarra, der Böse und Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in 1361 in Mantes-la-Jolie, Yvelines, Frankreich; gestorben am 8 Sep 1425 in Olite; wurde beigesetzt in Kathedrale, Pamplona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 189. |  König Johann I. von Kastilien (Trastámara) König Johann I. von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Kastilien) (Okt 2022) Familie/Ehepartner: Eleonore von Aragón. Eleonore (Tochter von König Peter IV. von Aragón und Eleonore von Aragón (von Sizilien)) wurde geboren in 1358; gestorben in 1382. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Beatrix von Portugal in 1382. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 190. |  Eleonore Urraca von Kastilien Eleonore Urraca von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eleonore Urraca und Ferdinand I. hatten sieben Kinder, zwei Töchter und fünf Söhne. Eleonore heiratete König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) in 1394. Ferdinand (Sohn von König Johann I. von Kastilien (Trastámara) und Eleonore von Aragón) wurde geboren am 27 Nov 1380 in Medina del Campo; gestorben am 2 Apr 1416 in Igualada. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 191. |  König Eduard I. von Portugal (Avis) König Eduard I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_(Portugal) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel. [Familienblatt] [Familientafel] Eduard heiratete Prinzessin Eleonore von Aragón am 22 Sep 1428. Eleonore (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1402; gestorben am 19 Feb 1445 in Toledo, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 192. |  Herzog Peter von Portugal (Avis) Herzog Peter von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Portugal (Apr 2018) Peter heiratete Elisabeth (Isabel) von Urgell in 1429. Elisabeth (Tochter von Graf Jakob II. von Urgell und Isabel von Aragón) wurde geboren in 1409; gestorben in 1443. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 193. |  Herzog Johann von Portugal Herzog Johann von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Portugal (Apr 2018) Johann heiratete Isabella von Braganza (von Portugal) am 11 Nov 1424. Isabella (Tochter von Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) und Beatriz Pereira de Alvim) wurde geboren in Okt 1402 in Barcelos, Portugal; gestorben am 26 Okt 1465 in Arévalo (Ávila), Spanien; wurde beigesetzt in Mosteiro de Santa Maria da Vitória. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 194. |  Isabel von Portugal (Avis) Isabel von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal_(1397–1471) Isabel heiratete Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute am 25 Jul 1429 in Ferntrauung. Philipp (Sohn von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 31 Jul 1396 in Dijon, Frankreich; gestorben am 15 Jun 1467 in Brügge. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 195. |  Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_von_Braganza Familie/Ehepartner: Beatriz Pereira de Alvim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 196. |  Mechthild von Werle-Goldberg Mechthild von Werle-Goldberg Familie/Ehepartner: Lorenz von Werle-Güstrow. Lorenz (Sohn von Herr Nikolaus III. von Werle-Güstrow und Agnes von Mecklenburg) wurde geboren in zw 1338 und 1340; gestorben in zw 24 Feb 1393 und 6 Mai 1394. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 197. |  König Peter I. von Kastilien König Peter I. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_I._(Kastilien) (Okt 2017) Peter heiratete María de Padilla in 1353. María (Tochter von Juan García de Padilla und María Fernández de Henestrosa) wurde geboren in 1334; gestorben in 1361 in Sevilla. [Familienblatt] [Familientafel]
Peter heiratete Königin Blanche von Bourbon am 3 Jun 1353 in Valladolid, Spanien. Blanche (Tochter von Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon und Isabella von Valois) wurde geboren in 1339; gestorben in 1361. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herrin Juana (Joana) de Castro. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 198. |  Herr Pedro Alfonso von Aguilar (Kastilien) Herr Pedro Alfonso von Aguilar (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Pedro heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 199. |  Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Trastámara (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel de Villena. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 200. |  Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Sancho heiratete Beatriz von Portugal in Mrz 1373. Beatriz (Tochter von König Peter I. von Portugal und Inês de Castro) wurde geboren in cir 1347 in Coimbra; gestorben am 5 Jul 1381 in Ledesma. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 201. |  König Ferdinand I. von Portugal König Ferdinand I. von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Portugal) (Aug 2023) Ferdinand heiratete Königin Leonore Teles de Menezes in 1371. Leonore wurde geboren in cir 1350 in Provinz Trás-os-Montes e Alto Douro; gestorben am 27 Apr 1386 in Tordesillas; wurde beigesetzt in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 202. |  Beatriz von Portugal Beatriz von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrice_von_Portugal (Sep 2017) Beatriz heiratete Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) in Mrz 1373. Sancho (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Leonor Núñez de Guzmán) wurde geboren in 1342; gestorben in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 203. |  Johann I. von Portugal (Avis) Johann I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Portugal) (Sep 2017) Johann heiratete Prinzessin Philippa von Lancaster in Feb 1387. Philippa (Tochter von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Blanche von Lancaster) wurde geboren am 31 Mrz 1360 in Leicester Castle; gestorben am 19 Jul 1415 in Sacavém. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Inêz Pirez. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 204. |  Graf Amadeus VI. von Savoyen, der Grüne Graf Graf Amadeus VI. von Savoyen, der Grüne Graf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Amadeus_VI._(Savoyen) Amadeus heiratete Bonne von Bourbon in 1355. Bonne (Tochter von Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon und Isabella von Valois) wurde geboren in 1341; gestorben in 1402. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 205. |  Konstanze von Kastilien Konstanze von Kastilien Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanze_von_Kastilien Konstanze heiratete Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt in 1371. John (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 6 Mrz 1340 in Gent; gestorben am 3 Feb 1399 in Leicester. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 206. |  Isabella von Kastilien Isabella von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Isabella und Edmund hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Isabella heiratete Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) in 1372 in Hertford Castle. Edmund (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 5 Jun 1341 in Kings Langley, Hertfordshire; gestorben am 1 Aug 1402 in Kings Langley, Hertfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 207. |  Branca (Blanche) von Kastilien Branca (Blanche) von Kastilien Notizen: Branca und Peter I. hatten keine Kinder. Branca heiratete König Peter I. von Portugal in 1325, und geschieden. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Portugal, der Kühne und Beatrix von Kastilien) wurde geboren am 8 Apr 1320 in Coimbra; gestorben am 18 Jan 1367 in Estremoz; wurde beigesetzt in Kloster Alcobaça. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 208. |  Herr Alonso Enríquez (Kastilien) Herr Alonso Enríquez (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 209. |  Eleonore von Kastilien (Trastámara) Eleonore von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Kastilien_(1363–1416) (Okt 2017) Eleonore heiratete König Karl III. von Navarra am 27 Mai 1375. Karl (Sohn von König Karl II. von Navarra, der Böse und Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in 1361 in Mantes-la-Jolie, Yvelines, Frankreich; gestorben am 8 Sep 1425 in Olite; wurde beigesetzt in Kathedrale, Pamplona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 210. |  König Johann I. von Kastilien (Trastámara) König Johann I. von Kastilien (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Kastilien) (Okt 2022) Familie/Ehepartner: Eleonore von Aragón. Eleonore (Tochter von König Peter IV. von Aragón und Eleonore von Aragón (von Sizilien)) wurde geboren in 1358; gestorben in 1382. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Beatrix von Portugal in 1382. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 211. |  Eleonore Urraca von Kastilien Eleonore Urraca von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eleonore Urraca und Ferdinand I. hatten sieben Kinder, zwei Töchter und fünf Söhne. Eleonore heiratete König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) in 1394. Ferdinand (Sohn von König Johann I. von Kastilien (Trastámara) und Eleonore von Aragón) wurde geboren am 27 Nov 1380 in Medina del Campo; gestorben am 2 Apr 1416 in Igualada. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 212. |  Beatrix von Portugal Beatrix von Portugal Beatrix heiratete König Johann I. von Kastilien (Trastámara) in 1382. Johann (Sohn von Heinrich II. von Kastilien (Trastámara) und Juana Manuel de Villena) wurde geboren am 24 Aug 1358 in Épila, Saragossa; gestorben am 9 Okt 1390 in Alcalá de Henares, Madrid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 213. |  König Eduard I. von Portugal (Avis) König Eduard I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_(Portugal) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel. [Familienblatt] [Familientafel] Eduard heiratete Prinzessin Eleonore von Aragón am 22 Sep 1428. Eleonore (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1402; gestorben am 19 Feb 1445 in Toledo, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 214. |  Herzog Peter von Portugal (Avis) Herzog Peter von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Portugal (Apr 2018) Peter heiratete Elisabeth (Isabel) von Urgell in 1429. Elisabeth (Tochter von Graf Jakob II. von Urgell und Isabel von Aragón) wurde geboren in 1409; gestorben in 1443. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 215. |  Herzog Johann von Portugal Herzog Johann von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Portugal (Apr 2018) Johann heiratete Isabella von Braganza (von Portugal) am 11 Nov 1424. Isabella (Tochter von Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) und Beatriz Pereira de Alvim) wurde geboren in Okt 1402 in Barcelos, Portugal; gestorben am 26 Okt 1465 in Arévalo (Ávila), Spanien; wurde beigesetzt in Mosteiro de Santa Maria da Vitória. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 216. |  Isabel von Portugal (Avis) Isabel von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal_(1397–1471) Isabel heiratete Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute am 25 Jul 1429 in Ferntrauung. Philipp (Sohn von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 31 Jul 1396 in Dijon, Frankreich; gestorben am 15 Jun 1467 in Brügge. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 217. |  Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_von_Braganza Familie/Ehepartner: Beatriz Pereira de Alvim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 218. |  König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._(Aragón) Ferdinand heiratete Königin Isabella I. von Kastilien am 19 Okt 1469. Isabella (Tochter von König Johann II. von Kastilien und Isabella von Portugal) wurde geboren am 22 Apr 1451 in Madrigal de las Altas Torres; gestorben am 26 Nov 1504 in Medina del Campo; wurde beigesetzt in Krypta der Capilla Real (Königliche Kapelle) in Granada. [Familienblatt] [Familientafel]
Ferdinand heiratete Germaine von Foix am 22 Mrz 1506 in Dénia. Germaine wurde geboren am 1488 od 1490 in Foix, Narbonne; gestorben am 15 Okt 1538 in Liria Valencia; wurde beigesetzt in Kloster San Miguel de los Reyes in Valencia. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 219. |  Blanka von Aragón Blanka von Aragón Blanka heiratete König Heinrich IV. von Kastilien am 15 Sep 1440, und geschieden in 1453. Heinrich (Sohn von König Johann II. von Kastilien und Marie von Aragón) wurde geboren am 5 Jan 1425 in Valladolid, Spanien; gestorben am 11 Dez 1474 in Madrid. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 220. |  Königin Eleonora (Leonor) von Aragón Königin Eleonora (Leonor) von Aragón Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_(Navarra) Eleonora heiratete Graf Gaston IV. von Foix am 30 Jul 1436. Gaston (Sohn von Graf Johann I. (Jean) von Foix-Grailly und Johanna (Jeanne) von Albret) wurde geboren in 1423; gestorben am 25 Jul 1472 in Roncevalles. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 221. |  Gräfin Éléonore von Bourbon-La-Marche Gräfin Éléonore von Bourbon-La-Marche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Éléonore heiratete Graf Bernard VIII. von Armagnac in 1429. Bernard (Sohn von Graf Bernard VII. von Armagnac und Bonne (Bona) von Valois (von Berry)) wurde geboren am 26 Mrz 1400; gestorben in cir 1462. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 222. |  Maria von Armagnac Maria von Armagnac Maria heiratete Herzog Johann II. von Alençon am 30 Apr 1437 in L’Isle-Jourdain. Johann (Sohn von Herzog Johann I. von Alençon und Marie von der Bretagne) wurde geboren am 2 Mrz 1409 in Argentan; gestorben am 8 Sep 1476 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 223. |  Maria von Kastilien Maria von Kastilien Maria heiratete Alfons V. von Aragón (Trastámara) am 12 Jun 1415. Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1396 in Medina del Campo; gestorben am 27 Jun 1458 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 224. |  König Johann II. von Kastilien König Johann II. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Kastilien) (Okt 2017) Johann heiratete Marie von Aragón in 1420. Marie (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1396; gestorben in 1445. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Isabella von Portugal in Aug 1447. Isabella (Tochter von Herzog Johann von Portugal und Isabella von Braganza (von Portugal)) wurde geboren in zw 1428 und 1431; gestorben am 15 Aug 1496 in Arévalo (Ávila), Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 225. |  Marie von Aragón Marie von Aragón Notizen: Marie und Johann II. hatten einen Sohn, Heinrich IV. der Unvermögende (* 5. Januar 1425; † 14. Dezember 1474) Marie heiratete König Johann II. von Kastilien in 1420. Johann (Sohn von König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche und Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt)) wurde geboren am 6 Mrz 1405 in Toro; gestorben am 20 Jul 1454 in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 226. |  Alfons V. von Aragón (Trastámara) Alfons V. von Aragón (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_V._(Aragón) (Sep 2023) Alfons heiratete Maria von Kastilien am 12 Jun 1415. Maria (Tochter von König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche und Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt)) wurde geboren in 1401; gestorben in 1458. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Giraldona Carlino. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 227. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Aragón) (Okt 2017) Johann heiratete Königin Blanka von Navarra in 1420. Blanka (Tochter von König Karl III. von Navarra und Eleonore von Kastilien (Trastámara)) wurde geboren am 6 Jul 1387; gestorben am 1 Apr 1441 in Santa María la Real de Nieva, Kastilien; wurde beigesetzt in Kirche des ehemaligen Dominikanerklosters Santa María la Real de Nieva. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Juana Enríquez am 1 Apr 1444. Juana (Tochter von Fadrique Enríquez (Kastilien) und Maria Fernández von Córdoba) wurde geboren in 1425 in Torrelobatón; gestorben am 13 Feb 1468 in Saragossa. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Leonor de Escobar. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 228. |  Prinzessin Eleonore von Aragón Prinzessin Eleonore von Aragón Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eleonore und Eduard I. hatten neun Kinder, fünf Söhne und vier Töchter. Eleonore heiratete König Eduard I. von Portugal (Avis) am 22 Sep 1428. Eduard (Sohn von Johann I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Philippa von Lancaster) wurde geboren am 31 Okt 1391; gestorben am 9 Sep 1438. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 229. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_VII._d’Harcourt (Okt 2017) Jean heiratete Marie d’Alençon am 17 Mrz 1389. Marie (Tochter von Graf Peter II. von Alençon und Vizegräfin Marie Chamaillard) wurde geboren in 1373; gestorben in 1417. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 230. |  Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Bar Robert heiratete Vizegräfin Jeanne von Béthune in Datum unbekannt. Jeanne gestorben in 1449. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 231. |  Philippa Mortimer Philippa Mortimer Philippa heiratete Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel in 1390. Richard (Sohn von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1346; gestorben am 21 Sep 1397. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 232. |  Heinrich V. von England (Lancaster) Heinrich V. von England (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(England) Heinrich heiratete Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) am 2 Jun 1420 in Johanneskirche, Troyes. Catherine (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 27 Okt 1401 in Königliche Residenz Hôtel Saint-Paul, Paris; gestorben am 3 Jan 1437 in Bermondsey Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 233. |  Thomas Lancaster Thomas Lancaster Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Thomas hinterliess keine legitimen Nachkommen. Thomas heiratete Margaret Holland in 1411. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 234. |  Blanca von England Blanca von England Blanca heiratete Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Bärtige am 15 Aug 1401 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Ludwig (Sohn von König Ruprecht III. von der Pfalz (Wittelsbacher) und Elisabeth von Hohenzollern (von Nürnberg)) wurde geboren am 23 Jan 1378; gestorben am 30 Dez 1436 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 235. |  Duke John Beaufort Duke John Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Beaufort,_1._Duke_of_Somerset John heiratete Margaret Beauchamp in cir 1442. Margaret (Tochter von John Beauchamp und Edith Stourton) wurde geboren in cir 1410; gestorben in 1482. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 236. |  Joan Beaufort Joan Beaufort Notizen: Joan und Jakob I. hatten acht Kinder, sechs Töchter und zwei Söhne. Joan heiratete König Jakob I. (James) von Schottland (Stuart) am 2 Feb 1424. Jakob (Sohn von König Robert III. (John) von Schottland (Stuart) und Annabella Drummond) wurde geboren am 25 Jul 1394 in Dunfermline Palace; gestorben am 21 Feb 1437 in Perth, Schottland; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster in Perth. [Familienblatt] [Familientafel]
Joan heiratete James Stewart, der schwarze Ritter von Lorn in 1439. James wurde geboren in cir 1395; gestorben in 1448. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 237. |  Edmund Beaufort Edmund Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Beaufort,_1._Duke_of_Somerset Edmund heiratete Eleanor de Beauchamp in 1431/33. Eleanor (Tochter von Graf Richard de Beauchamp und Elizabeth Berkeley) wurde geboren in Sep 1408; gestorben am 6 Mrz 1467. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 238. |  Richard Neville, 5. Earl of Salisbury Richard Neville, 5. Earl of Salisbury Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_5._Earl_of_Salisbury Richard heiratete Alice Montacute (Montagu) am vor Feb 1421. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 239. |  Eleanor Neville Eleanor Neville Eleanor heiratete Baron Richard le Despenser in nach 13 Mai 1412. Richard (Sohn von Graf Thomas le Despenser und Constance Langley) wurde geboren am 30 Nov 1396; gestorben in zw 7 Okt 1413 und 7 Okt 1414; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey, Plymouth, England. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 240. |  Anne Neville Anne Neville Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Neville,_Duchess_of_Buckingham Anne heiratete Humphrey Stafford, 1. Duke of Buckingham in vor 18 Okt 1424 in Raby, Durham, England. Humphrey wurde geboren am 15 Aug 1402 in Stafford, Staffordshire, England ; gestorben am 10 Jul 1460 in Schlachtfeld, Northampton, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Anne heiratete Walter Blount in 1467. Walter wurde geboren in 1416; gestorben in 1474. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 241. |  Herzogin Cecily Neville Herzogin Cecily Neville Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Cecily_Neville (Jul 2023) Cecily heiratete Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) in 1429. Richard (Sohn von Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) und Anne Mortimer) wurde geboren am 21 Sep 1411; gestorben am 30 Dez 1460. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 242. |  Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Plantagenet,_3._Duke_of_York Richard heiratete Herzogin Cecily Neville in 1429. Cecily (Tochter von Ralph Neville, 1. Earl of Westmorland und Joan Beaufort) wurde geboren am 3 Mai 1415 in Raby Castle, England; gestorben am 31 Mai 1495 in Berkhamsted Castle, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 243. |  Baron Richard le Despenser Baron Richard le Despenser Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_le_Despenser,_4._Baron_Burghersh Richard heiratete Eleanor Neville in nach 13 Mai 1412. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 244. |  Baroness Isabel le Despenser Baroness Isabel le Despenser Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_le_Despenser,_5._Baroness_Burghersh Isabel heiratete Baron Richard de Beauchamp am 27 Jul 1411 in Tewkesbury , England. Richard gestorben in 1422 in Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] Isabel heiratete Graf Richard de Beauchamp am 26 Nov 1423 in Hanley Castle, Worcestershire, England. Richard (Sohn von Thomas de Beauchamp, 12. Earl of Warwick und Margaret de Ferrers) wurde geboren in 25 od 28 Jan 1382 in Salwarpe Court; gestorben am 30 Apr 1439 in Rouen; wurde beigesetzt in 1475 in Collegiate Church of St Mary, Warwick, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 245. | Maredudd Vychan (ap Tewdwr "Tudor") Maredudd heiratete Margaret Vychan in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 246. |  Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Bar_(1362–1397) Heinrich heiratete Herrin Mary von Coucy in 1383. Mary (Tochter von Herr Enguerrand VII. von Coucy und Prinzessin Isabella von England (Plantagenêt)) wurde geboren in Apr 1366 in Coucy; gestorben in 1405. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 247. |  Violante (Jolande) von Bar-Scarponnois Violante (Jolande) von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Violante_von_Bar Violante heiratete König Johann I. von Aragón in Mai 1380 in Montpellier, FR. Johann (Sohn von König Peter IV. von Aragón und Eleonore von Aragón (von Sizilien)) wurde geboren am 27 Dez 1350 in Perpignan; gestorben am 19 Mai 1396 in im Wald bei Foixà, Girona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 248. |  Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ohnefurcht Johann heiratete Margarete von Bayern (Wittelsbacher) am 12 Apr 1385 in Cambrai. Margarete (Tochter von Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Liegnitz-Brieg) wurde geboren in 1363 in Den Haag ?; gestorben in 1423 in Dijon, Frankreich; wurde beigesetzt in Kartäuserkirche, Dijon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 249. |  Maria von Burgund Maria von Burgund Maria heiratete GegenPapst Felix V. Amadeus VIII. von Savoyen am 27 Okt 1401 in Arras, Frankreich. Amadeus (Sohn von Graf Amadeus VII. von Savoyen und Bonne (Bona) von Valois (von Berry)) wurde geboren am 4 Sep 1383 in Chambéry, FR; gestorben am 7 Jan 1451 in Genf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 250. |  Graf Philipp von Artois Graf Philipp von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippe_d’Artois,_comte_d’Eu Philipp heiratete Herzogin Marie von Berry (Valois, Auvergne) am 28 Jan 1392 in Paris, France. Marie (Tochter von Herzog Johann (Jean) von Valois (von Berry) und Jeanne von Armagnac) wurde geboren in cir 1367; gestorben in Jun 1434 in Lyon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 251. |  Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Lancaster (Sep 2017) Katharina heiratete König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche in 1388. Heinrich (Sohn von König Johann I. von Kastilien (Trastámara) und Eleonore von Aragón) wurde geboren am 4 Okt 1379 in Burgos; gestorben am 25 Dez 1406 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Capilla de los Reyes Nuevos in der Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 252. |  Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_of_Conisburgh,_1._Earl_of_Cambridge Richard heiratete Anne Mortimer in 1406. Anne (Tochter von Roger Mortimer, 4. Earl of March und Eleanor (1) (Alianore) Holland) wurde geboren in 27 Dez 1388 od 1390; gestorben am 21 Sep 1411. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 253. | Constance Langley Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Constance_Langley Constance heiratete Graf Thomas le Despenser in Nov 1379. Thomas (Sohn von Baron Edward le Despenser und Elizabeth Burghersh) wurde geboren am 22 Sep 1373; gestorben am 13 Jan 1400 in Bristol, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Edmund Holland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 254. |  Fadrique Enríquez (Kastilien) Fadrique Enríquez (Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Maria Fernández von Córdoba. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 255. |  Johanna (Jeanne) von Navarra Johanna (Jeanne) von Navarra Johanna heiratete Graf Johann I. (Jean) von Foix-Grailly in 1402. Johann (Sohn von Archambaud von Grailly und Gräfin Isabelle von Foix (von Castelbon)) wurde geboren in 1382; gestorben am 4 Mai 1436 in Mazères. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 256. |  Königin Blanka von Navarra Königin Blanka von Navarra Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Blanka_(Navarra) (Nov 2018) Blanka heiratete Martin I. von Sizilien (von Aragón), der Junge in Nov 1402. Martin (Sohn von König Martin I. von Aragón und Königin Maria de Luna) wurde geboren in 1376; gestorben am 15 Jul 1409 in Cagliari. [Familienblatt] [Familientafel] Blanka heiratete König Johann II. von von Aragón (Trastámara) in 1420. Johann (Sohn von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 29 Jun 1397 od 1398 in Medina del Campo; gestorben am 19 Jan 1479 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 257. |  Beatrice von Navarra (Evreux) Beatrice von Navarra (Evreux) Beatrice heiratete Graf Jacques II. von Bourbon-La Marche am 14 Sep 1406 in Pamplona. Jacques (Sohn von Graf Jean I. von Bourbon-La Marche und Gräfin Catherine von Vendôme (Montoire)) wurde geboren in 1370; gestorben am 24 Sep 1438 in Besançon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 258. |  Isabella von Navarra Isabella von Navarra Isabella heiratete Graf Jean IV. (Johann) von Armagnac am 10 Mai 1419. Jean (Sohn von Graf Bernard VII. von Armagnac und Bonne (Bona) von Valois (von Berry)) wurde geboren am 15 Okt 1396 in Rodez; gestorben am 5 Nov 1450 in l’Isle-Jourdain. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 259. |  König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Kastilien) (Okt 2017) Heinrich heiratete Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) in 1388. Katharina (Tochter von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Konstanze von Kastilien) wurde geboren in Wahrscheinlich 13.3.1373 in Hertford; gestorben am 2 Jun 1418 in Valladolid, Spanien; wurde beigesetzt in Capilla de los Reyes Nuevos in der Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 260. | 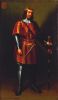 König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Aragón) (Okt 2017) Ferdinand heiratete Eleonore Urraca von Kastilien in 1394. Eleonore (Tochter von Graf Sancho Alfonso von Alburquerque (von Kastilien) und Beatriz von Portugal) wurde geboren in 1374 in Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, Spanien; gestorben am 16 Dez 1435 in Medina del Campo, Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 261. |  König Alfons V. von Portugal (Avis), König Alfons V. von Portugal (Avis), Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_V._(Portugal) (Okt 2017) Alfons heiratete Königin Isabel von Portugal in 1447. Isabel (Tochter von Herzog Peter von Portugal (Avis) und Elisabeth (Isabel) von Urgell) wurde geboren am 1 Mrz 1432 in Coimbra; gestorben am 2 Dez 1455 in Évora. [Familienblatt] [Familientafel]
Alfons heiratete Fürstin Johanna von Kastilien in 1475. Johanna (Tochter von König Heinrich IV. von Kastilien und Prinzessin Johanna von Portugal (Avis)) wurde geboren am 28 Feb 1462 in Madrid; gestorben am 12 Apr 1530 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 262. |  Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Beatrix von Portugal. Beatrix (Tochter von Herzog Johann von Portugal und Isabella von Braganza (von Portugal)) wurde geboren in 1430; gestorben in 1506. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 263. |  Prinzessin Eleonora Helena von Portugal Prinzessin Eleonora Helena von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Aus der Ehe mit Friedrich III. gingen sechs Kinder hervor. Es überlebten jedoch nur der 1459 geborene Maximilian und die 1465 geborene Kunigunde. Eleonora heiratete Kaiser Friedrich III. von Österreich (von Habsburg) am 16 Mrz 1452 in Rom, Italien. Friedrich (Sohn von Erzherzog Ernst I. von Österreich (von Habsburg), der Eiserne und Cimburgis von Masowien) wurde geboren am 21 Sep 1415 in Innsbruck, Österreich; gestorben am 19 Aug 1493 in Linz, Österreich; wurde beigesetzt in 06 und 07 Dez 1493 in Stephansdom, Wien, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 264. |  Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna und Heinrich IV. hatten eine Tochter. Johanna heiratete König Heinrich IV. von Kastilien am 20 Mai 1455 in Córdoba. Heinrich (Sohn von König Johann II. von Kastilien und Marie von Aragón) wurde geboren am 5 Jan 1425 in Valladolid, Spanien; gestorben am 11 Dez 1474 in Madrid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 265. |  Königin Isabel von Portugal Königin Isabel von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_von_Portugal (Aug 2023) Isabel heiratete König Alfons V. von Portugal (Avis), in 1447. Alfons (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 15 Jan 1432 in Sintra; gestorben am 28 Aug 1481 in Sintra. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 266. |  Isabella von Portugal Isabella von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Isabella und Johann II. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Isabella heiratete König Johann II. von Kastilien in Aug 1447. Johann (Sohn von König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche und Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt)) wurde geboren am 6 Mrz 1405 in Toro; gestorben am 20 Jul 1454 in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 267. |  Beatrix von Portugal Beatrix von Portugal Familie/Ehepartner: Herzog Ferdinand von Portugal (Avis). Ferdinand (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 17 Nov 1433; gestorben am 18 Sep 1470. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 268. |  Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Kühne Karl heiratete Prinzessin Catherine von Valois am 19 Mai 1440 in Blois. Catherine (Tochter von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren in 1428; gestorben in Jul 1446 in Brüssel; wurde beigesetzt in Aug 1446 in Kathedrale St. Michel et Gudule. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Isabelle von Bourbon am 30 Okt 1454 in Lille. Isabelle (Tochter von Herzog Charles I. (Karl) von Bourbon und Agnes von Burgund) wurde geboren in 1437; gestorben am 25 Sep 1465 in Antwerpen. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Margaret of York am 3 Jul 1468 in Damme. Margaret (Tochter von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville) wurde geboren am 3 Mai 1446 in Fotheringhay Castle, Northamptonshire, England; gestorben am 23 Nov 1503 in Mechelen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 269. |  Isabella von Braganza (von Portugal) Isabella von Braganza (von Portugal) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_von_Braganza (Sep 2017) Isabella heiratete Herzog Johann von Portugal am 11 Nov 1424. Johann (Sohn von Johann I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Philippa von Lancaster) wurde geboren am 13 Jan 1400 in Santarém; gestorben am 18 Okt 1442 in Alcácer do Sal, Portugal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 270. |  Herr Johann VII. von Werle-Güstrow Herr Johann VII. von Werle-Güstrow Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_VII._(Werle) (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Katharina von Sachsen-Lauenburg (Askanier). Katharina (Tochter von Herzog Erich IV. von Sachsen-Lauenburg (Askanier) und Sophie von Braunschweig-Lüneburg) wurde geboren in cir 1400; gestorben am 22 Sep 1450. [Familienblatt] [Familientafel] |