
| 1. |  Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige gestorben am 21/30 Dez 1069 in Verdun, Frankreich. Gottfried III. von Niederlothringen, der Bärtige gestorben am 21/30 Dez 1069 in Verdun, Frankreich. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_III,_Duke_of_Lower_Lorraine Familie/Ehepartner: Oda (Doda). [Familienblatt] [Familientafel]
Gottfried heiratete Beatrix von Oberlothringen (von Bar) in 1054. Beatrix (Tochter von Herzog Friedrich II. von Oberlothringen (von Bar) und Herzogin Mathilde von Schwaben) wurde geboren in cir 1017; gestorben am 18 Apr 1076. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 2. |  Herzog Gottfried IV. von Niederlothringen, der Bucklige Herzog Gottfried IV. von Niederlothringen, der Bucklige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_IV,_Duke_of_Lower_Lorraine Familie/Ehepartner: Markgräfin Mathilde von Tuszien. Mathilde (Tochter von Bonifatius IV. von Canossa und Beatrix von Oberlothringen (von Bar)) wurde geboren in cir 1046; gestorben am 24 Jul 1115 in Bondeno di Roncore; wurde beigesetzt in Kloster San Benedetto di Polirone in San Benedetto Po. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. |  Ida von Lothringen (Boulogne) Ida von Lothringen (Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_of_Lorraine Familie/Ehepartner: Graf Eustach II. von Boulogne. Eustach (Sohn von Eustach I. von Boulogne und Mathilde von Löwen (Hennegau)) wurde geboren in cir 1020; gestorben in cir 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  Wiltrud von Niederlothringen Wiltrud von Niederlothringen Notizen: Herzogtum Lothringen: Familie/Ehepartner: Graf Adalbert II. von Calw. Adalbert (Sohn von Graf Adalbert I. von Calw und Adelheid ? von Egisheim) gestorben in 1099. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Graf Eustach III. von Boulogne Graf Eustach III. von Boulogne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Marie von Schottland. Marie (Tochter von König Malcolm III. von Schottland, Langhals und Margareta von Schottland) gestorben in 1116. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. |  Graf Balduin I. von Jerusalem (von Boulogne) Graf Balduin I. von Jerusalem (von Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_I._(Jerusalem) Familie/Ehepartner: Godehilde von Tosny. Godehilde (Tochter von Raoul II. von Tosny und Élisabeth (Isabelle) von Montfort) gestorben in 1097. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Oriante von Melitene. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. |  Gottfried von Bouillon (Boulogne) Gottfried von Bouillon (Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_of_Bouillon |
| 8. |  Ida von Boulogne Ida von Boulogne Ida heiratete Graf Conon (Cuno, Kuno) von Montaigu in Datum unbekannt. Conon (Sohn von Graf Gozelo I. (Gozelon) von Montaigu und Ermentrud von Grandpré (?)) gestorben am 1 Mai 1106. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. |  Graf Adalbert III. von Calw Graf Adalbert III. von Calw Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Löwenstein_(Württemberg) Familie/Ehepartner: Kuniza (Cunizza) von Wirsbach (Willsbach). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |  Gottfried II. von Calw Gottfried II. von Calw Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Calw Familie/Ehepartner: Liutgard von Zähringen. Liutgard (Tochter von Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen und Herzogin Agnes von Rheinfelden) wurde geboren in cir 1098; gestorben am 25 Mär 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Königin Mathilda von Boulogne (von England) Königin Mathilda von Boulogne (von England) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilda_von_Boulogne (Jun 2022) Mathilda heiratete König Stephan von England (Haus Blois) in 1125. Stephan (Sohn von Stephan II. (Heinrich) von Blois und Adela von England (von der Normandie)) wurde geboren in 1092 in Blois; gestorben am 25 Okt 1154 in Dover, England; wurde beigesetzt in Faversham Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. |  Graf Gozelo II. von Montaigu Graf Gozelo II. von Montaigu Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: |
| 13. |  Graf Lambert von Montaigu Graf Lambert von Montaigu Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Lambert heiratete Gertrud in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Adalbert IV. von Calw (von Löwenstein) Adalbert IV. von Calw (von Löwenstein) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Uta von Schauenburg (von Calw) Uta von Schauenburg (von Calw) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Uta_von_Schauenburg Familie/Ehepartner: Markgraf Welf VI. (Welfen). Welf (Sohn von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) wurde geboren in 1115; gestorben am 15 Dez 1191 in Memmingen, Schwaben, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Kloster Steingaden in der Klosterkirche St. Johannes Baptist. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Graf Eustach IV. von Boulogne (Blois) Graf Eustach IV. von Boulogne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eustach_IV._(Boulogne) (Jun 2017) Eustach heiratete Prinzessin Konstanze (Constance) von Frankreich (Kapetinger) in Feb 1140. Konstanze (Tochter von König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke und Königin Adelheid von Maurienne (Savoyen)) wurde geboren in cir 1126; gestorben am 16 Aug 1176. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. |  Gräfin Maria von Boulogne (von Blois) Gräfin Maria von Boulogne (von Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Boulogne) Familie/Ehepartner: Graf Matthäus von Elsass (von Flandern). Matthäus (Sohn von Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) und Sibylle von Anjou-Château-Landon) wurde geboren in cir 1137; gestorben am 25 Jul 1173 in Normandie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |  Graf Wilhelm von England (von Blois) Graf Wilhelm von England (von Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Boulogne) Wilhelm heiratete Isabel (Elisabeth) de Warenne in 1148. Isabel (Tochter von Graf William de Warenne und Adela (Ela) von Ponthieu (von Montgommery)) wurde geboren in 1136; gestorben am 12 Jul 1203; wurde beigesetzt in Lewes Priory bei Lewes. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. |  Gertrude von Montaigu Gertrude von Montaigu Gertrude heiratete Herr Radulf (Raoul) von Nesle in Datum unbekannt. Radulf (Sohn von Herr Radulf von Nesle und Rainurde) gestorben in 1153/1160. [Familienblatt] [Familientafel]
Gertrude heiratete Eberhard III. von Tournai in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. |  Graf Adalbert V. von Calw Graf Adalbert V. von Calw Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 21. |  Graf Bertold von Löwenstein (von Calw) Graf Bertold von Löwenstein (von Calw) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_L%C3%B6wenstein Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Graf Konrad von Calw Graf Konrad von Calw Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Vaihingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. |  Elisabeth (Welfen) Elisabeth (Welfen) Elisabeth heiratete Rudolf von Pfullendorf-Bregenz in cir 1150. Rudolf (Sohn von Ulrich von Ramsberg und Adelheid von Bregenz) wurde geboren in ca 1100/1110; gestorben am 9 Jan 1181 in Jerusalem. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. |  Graf Welf VII. (Welfen) Graf Welf VII. (Welfen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Welf_VII. |
| 25. | Gräfin Ida von Elsass Anderer Ereignisse und Attribute:
Ida heiratete Gerhard III. von Geldern in 1181. Gerhard (Sohn von Heinrich I. von Geldern und Agnes von Arnstein) gestorben in 1181. [Familienblatt] [Familientafel] Ida heiratete Herzog Berthold (Berchtold) IV. von Zähringen in 1183. Berthold (Sohn von Herzog Konrad I. von Zähringen und Clementia von Namur) wurde geboren in cir 1125; gestorben am 8 Dez 1186. [Familienblatt] [Familientafel] Ida heiratete Graf Rainald I. von Dammartin (Haus Mello) in 1191. Rainald (Sohn von Graf Aubry II. (Alberich) von Dammartin (Haus Mello) und Mathilde (Mathildis, Mahaut, Mabile) von Clermont) wurde geboren in cir 1165; gestorben in 1227. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Mathilda von Elsass (von Flandern) Mathilda von Elsass (von Flandern) Mathilda heiratete Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) in 1179. Heinrich (Sohn von Gottfried III. von Löwen und Margarete von Limburg) wurde geboren in cir 1165; gestorben am 5 Sep 1235 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. |  Johann (Jean) I. von Nesle Johann (Jean) I. von Nesle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Elisabeth von Peteghem in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  Graf Raoul III. von Soissons (Nesle) Graf Raoul III. von Soissons (Nesle) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Raoul I. der Gute (franz.: Raoul le Bon; † 1236) war Graf von Soissons aus dem Haus Nesle.[1] Er war der jüngste von drei Söhnen Sire Raouls II. von Nesle, Burggraf von Brügge, und seiner Ehefrau Gersende von Montaigu. Obwohl er selbst nie die Stammburg seiner Familie besaß, wird er häufig Raoul III. von Nesle genannt. Raoul heiratete Adèle (Adelheid, Alix) von Dreux in vor 1183. Adèle (Tochter von Robert I. von Dreux und Hedwig (Havise) von Salisbury (von Évreux)) wurde geboren in 1144/1145; gestorben in vor 1210. [Familienblatt] [Familientafel]
Raoul heiratete Yolande von Joinville in Datum unbekannt. Yolande (Tochter von Herr Gottfried IV. von Joinville und Hélius (Helvide) von Dampierre) gestorben in 1223. [Familienblatt] [Familientafel]
Raoul heiratete Ada von Avesnes in Datum unbekannt. Ada (Tochter von Herr Jakob von Avesnes und Adela von Guise) gestorben in nach 1249. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. |  Gottfried I. von Löwenstein Gottfried I. von Löwenstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Graf Konrad von Calw Graf Konrad von Calw Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Ita von Pfullendorf-Bregenz Ita von Pfullendorf-Bregenz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Pfullendorf Ita heiratete Albrecht III. (Albert) von Habsburg, der Reiche in 1164. Albrecht (Sohn von Graf Werner II. (III.) von Habsburg und Ida (Ita) von Starkenberg) gestorben am 10 Feb 1199. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. |  Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_von_Dammartin Mathilde heiratete Prinz Philipp Hurepel von Frankreich (Kapetinger) in cir 1218. Philipp (Sohn von König Philipp II. August von Frankreich (Kapetinger) und Agnes-Maria von Andechs (von Meranien)) wurde geboren in cir 1200; gestorben in Jan 1234. [Familienblatt] [Familientafel] Mathilde heiratete König Alfons III. von Portugal in cir 1235. Alfons (Sohn von König Alfons II. von Portugal, der Dicke und Prinzessin Urraca von Kastilien (von Portugal)) wurde geboren am 5 Mai 1210 in Coimbra; gestorben am 16 Feb 1279 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. |  Margareta von Brabant Margareta von Brabant Margareta heiratete Graf Gerhard IV von Geldern in 1206 in Löwen, Brabant. Gerhard (Sohn von Graf Otto I. von Geldern und Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1185; gestorben am 22 Okt 1229; wurde beigesetzt in Münsterkirche, Roermond, Holland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  Mathilde von Brabant Mathilde von Brabant Mathilde heiratete Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) in 1224. Florens (Sohn von Graf Wilhelm I. von Holland (Gerulfinger) und Adelheid von Geldern) wurde geboren am 24 Jun 1210; gestorben am 13 Jul 1234. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. |  Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Brabant) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Marie von Schwaben (Staufer). Marie (Tochter von König Philipp von Schwaben (Staufer) und Irene (Maria) von Byzanz) wurde geboren in 1201; gestorben in 1235. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen). Sophie (Tochter von Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der Heilige und Elisabeth von Thüringen (von Ungarn)) wurde geboren am 30 Mrz 1224 in Wartburg oder der Creuzburg in Thüringen; gestorben am 29 Mai 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. |  Elisabeth von Brabant Elisabeth von Brabant Elisabeth heiratete Dietrich primogenitus von Kleve in 1233. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve und Nicht klar ?) wurde geboren in cir 1214/15. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. |  Herr Johann (Jean) II. von Nesle Herr Johann (Jean) II. von Nesle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._von_Nesle Johann heiratete Eustachie von Saint-Pol in Datum unbekannt. Eustachie gestorben in vor 1241. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. |  Herrin Gertrude von Nesle Herrin Gertrude von Nesle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Herr Raoul I. von Clermont. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Gertrude von Soissons Gertrude von Soissons Gertrude heiratete Mathieu (Matthias) II. von Montmorency in Datum unbekannt. Mathieu (Sohn von Herr Bouchard (Burkhard) IV. von Montmorency und Laurence (Laurette) von Hennegau) gestorben am 24 Nov 1230. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 40. |  Johann II. (Jean) von Soissons (Nesle) Johann II. (Jean) von Soissons (Nesle) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Marie von Thour in vor 1226. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Gräfin Mathilde (Mahaut) von Amboise in Datum unbekannt. Mathilde gestorben am 12 Mai 1256. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. |  Gottfried II. von Löwenstein Gottfried II. von Löwenstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Gräfin Ruchina (Richenza) von Beilstein-Wolfsölden. Ruchina (Tochter von Bertold von Beilstein (Hessonen) und Adelheid von Bonfeld) wurde geboren in cir 1205; gestorben in nach 1235. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. |  Graf Gottfried von Calw Graf Gottfried von Calw Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Uta. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. |  Rudolf II. von Habsburg, der Gütige Rudolf II. von Habsburg, der Gütige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Agnes von Staufen. Agnes (Tochter von Gottfried von Staufen) wurde geboren in zw 1165 und 1170; gestorben in vor 1232. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. |  Graf Otto II von Geldern, der Lahme Graf Otto II von Geldern, der Lahme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto II. von Geldern (* um 1215; † 10. Januar 1271; genannt der Lahme) war Graf von Geldern vom 22. Oktober 1229 bis zu seinem Tod. Otto heiratete Margarete von Kleve in Datum unbekannt. Margarete (Tochter von Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve und Nicht klar ?) gestorben am 10 Sep 1251. [Familienblatt] [Familientafel]
Otto heiratete Philippa von Dammartin (von Ponthieu) in Datum unbekannt. Philippa gestorben in 1277/81. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. |  Richarda von Geldern Richarda von Geldern Richarda heiratete Graf Wilhelm IV von Jülich in spätestens 1251/1252. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm III. von Jülich) wurde geboren in 1210; gestorben am 16 Mrz 1278 in Aachen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. |  Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Holland Familie/Ehepartner: Elisabeth von Lüneburg (von Braunschweig). Elisabeth (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1230; gestorben am 27 Mai 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. |  Adelheid von Holland Adelheid von Holland Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Holland Adelheid heiratete Johann von Hennegau (von Avesnes) in 1246. Johann (Sohn von Burkhard von Avesnes und Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze ) wurde geboren am 1 Mai 1218 in Houffalize, Wallonien; gestorben am 24 Dez 1257. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. |  Margarete von Holland (von Henneberg) Margarete von Holland (von Henneberg) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Henneberg Margarete heiratete Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg in Pfingsten 1249. Hermann (Sohn von Graf Poppo VII. von Henneberg und Jutta von Thüringen (Ludowinger)) wurde geboren in 1224; gestorben am 18 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Mathilde und Robert I. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Mathilde heiratete Robert I. von Artois (von Frankreich) am 14 Jun 1237 in Compiègne, Frankreich. Robert (Sohn von König Ludwig VIII. von Frankreich, der Löwe und Königin Blanka von Kastilien) wurde geboren am 17 Sep 1216; gestorben am 8 Feb 1250 in Al-Mansura. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) am cir Mai 1254 in Neapel, Italien. Guido (Sohn von Graf Hugo I. (V.) von Châtillon-Saint Pol und Gräfin Maria von Avesnes) gestorben am 12 Feb 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. |  Herzogin Maria von Brabant Herzogin Maria von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria hatte mit Ludwig II. keine Kinder. Maria heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 2 Aug 1254. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. | 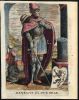 Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Brabant) Heinrich heiratete Adelheid von Burgund in 1251. Adelheid (Tochter von Herzog Hugo IV. von Burgund und Yolande von Dreux) wurde geboren in 1233; gestorben in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. |  Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Heinrich I. von Hessen (* 24. Juni 1244; † 21. Dezember 1308 in Marburg) war erster Landgraf von Hessen und Begründer des hessischen Fürstenhauses. Heinrich heiratete Adelheid von Lüneburg (von Braunschweig) am 10 Sep 1263. Adelheid (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) gestorben am 12 Jun 1274 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Mechtild von Kleve in cir 1275. Mechtild (Tochter von Graf Dietrich V. (VII.) von Kleve und Aleidis (Alheidis) von Heinsberg (Haus Sponheim)) gestorben am 21 Dez 1309. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 53. |  Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth heiratete Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große am 13 Jul 1254. Albrecht (Sohn von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1236; gestorben am 15 Aug 1279. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 54. | Familie/Ehepartner: Graf Gerhard von Durbuy. Gerhard wurde geboren in 1223; gestorben in cir 1303. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. |
| 56. |  Herr Simon II. von Clermont Herr Simon II. von Clermont Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_II._de_Clermont Simon heiratete Adele von Montfort am vor Feb 1242. Adele (Tochter von Amalrich VII. von Montfort und Beatrix von Viennois) gestorben am 28 Mrz 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. |  Élisabeth von Nesle Élisabeth von Nesle Notizen: Geburt: Élisabeth heiratete Nicolas von Barbançon in Datum unbekannt. Nicolas (Sohn von Gilles von Barbançon und Herrin Élisabeth von Merbes) gestorben in 1256. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. |  Gottfried III. von Löwenstein Gottfried III. von Löwenstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Hohenlohe-Weikersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. |  von Calw von Calw Familie/Ehepartner: Simon I. von Zweibrücken. Simon (Sohn von Graf Heinrich II. von Zweibrücken und Agnes von Eberstein) gestorben in 1281. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. |  Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_IV._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. |  Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg), der Schweigsame Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Habsburg) Familie/Ehepartner: Gertrud von Regensberg. Gertrud (Tochter von Lüthold VI. von Regensberg und Adelburg von Kaiserstuhl) wurde geboren in cir 1200. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. |  Gertrud von Habsburg Gertrud von Habsburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Ludwig III. von Froburg (Frohburg). Ludwig (Sohn von Graf Hermann II. von Froburg (Frohburg) und von Kyburg ?) gestorben in 1256/59. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. |  Margarethe von Geldern Margarethe von Geldern Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Dietrich VI. (VIII.) von Kleve. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich V. (VII.) von Kleve und Aleidis (Alheidis) von Heinsberg (Haus Sponheim)) wurde geboren in cir 1256/57; gestorben am 4 Okt 1305. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarethe heiratete Herr Enguerrand IV. von Coucy in cir 1262. Enguerrand (Sohn von Herr Enguerrand III. von Coucy und Marie von Montmirail) gestorben in 1310. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 64. |  Rainald I. von Geldern Rainald I. von Geldern Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_I._(Geldern) Rainald heiratete Irmgard von Limburg in 1270. Irmgard (Tochter von Herzog Walram V. von Limburg und Jutta (Judith) von Kleve) gestorben in 1283. [Familienblatt] [Familientafel] Rainald heiratete Margareta von Flandern (von Dampierre) in 1286. Margareta (Tochter von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Isabella von Luxemburg) gestorben in 1331. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_V._(Jülich) Gerhard heiratete von Kessel in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Gerhard heiratete Elisabeth von Brabant-Arschot in Datum unbekannt. Elisabeth (Tochter von Herr Gottfried von Brabant-Arschot und Jeanne Isabeau von Vierzon) gestorben in 1350. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. | Notizen: Name: Margaretha heiratete Graf Diether V von Katzenelnbogen in cir 1261. Diether (Sohn von Graf Diether IV. von Katzenelnbogen und Hildegunde) gestorben am 13 Jan 1276. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. | Notizen: Name: Blancheflor heiratete Heinrich I. von Sponheim-Starkenburg in 1265. Heinrich (Sohn von Graf Johann I. von Sponheim-Starkenberg (von Sayn) und von Isenberg (von Altena)) wurde geboren in zw 1235 und 1240; gestorben am 1 Aug 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. | Notizen: Name: Peronetta heiratete Graf Ludwig von Arnsberg in vor 1277. Ludwig (Sohn von Graf Gottfried III. von Arnsberg und Adelheid von Blieskastel) wurde geboren in cir 1237; gestorben am 2 Mai 1313. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. |  Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Florens_V._(Holland) Florens heiratete Beatrix (Béatrice) von Flandern (von Dampierre) in 1268/1269. Beatrix (Tochter von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Mathilde von Béthune) wurde geboren in 1253/1254; gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. |  Graf Johann II. (Jean) von Avesnes Graf Johann II. (Jean) von Avesnes Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Holland) Johann heiratete Philippa von Luxemburg in cir 1270. Philippa (Tochter von Graf Heinrich V. von Limburg-Luxemburg, der Blonde und Herrin Margareta von Bar) wurde geboren in 1252; gestorben am 6 Apr 1311. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 71. |  Graf Poppo VIII. von von Henneberg-Coburg Graf Poppo VIII. von von Henneberg-Coburg |
| 72. |  Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg Familie/Ehepartner: Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange . Otto (Sohn von Markgraf Otto III. von Brandenburg (Askanier), der Fromme und Beatrix (Božena) von Böhmen) wurde geboren in cir 1246; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. | Blanche von Artois Notizen: Das einzige Kind von Blanche mit Heinrich I., Johanna I. wurde die Nachfolgerin Heinrichs. Blanche heiratete König Heinrich I. von Navarra (von Champagne) in 1269 in Melun. Heinrich (Sohn von Graf Theobald I. von Champagne (von Navarra), der Sänger und Marguerite von Bourbon (von Dampierre)) wurde geboren in cir 1244; gestorben in Jul 1274. [Familienblatt] [Familientafel]
Blanche heiratete Prinz Edmund von England (Plantagenêt), Crouchback in 1276. Edmund (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 16 Jan 1245 in Westminster; gestorben am 5 Jun 1296 in Bayonne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. |  Graf Robert II. von Artois Graf Robert II. von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_II._(Artois) Robert heiratete Amicia von Courtenay in 1262. Amicia (Tochter von Peter (Pierre) von Courtenay (Kapetinger) und Pétronille von Joigny) wurde geboren in 1250; gestorben in 1275 in Rom, Italien; wurde beigesetzt in Petersdom. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herrin Agnes von Bourbon (de Dampierre). Agnes (Tochter von Archambault IX. von Bourbon (von Dampierre) und Gräfin Jolanthe von Châtillon (Nevers)) wurde geboren in 1237; gestorben in 1288. [Familienblatt] [Familientafel] Robert heiratete Margarete von Avesnes in 1298. Margarete (Tochter von Graf Johann II. (Jean) von Avesnes und Philippa von Luxemburg) gestorben am 18 Okt 1342. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 75. |  Hugo II. von Châtillon (Blois) Hugo II. von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_II._(Blois) Hugo heiratete Beatrix von Flandern in 1287. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. |  Graf Guido III. (Guy) von Châtillon-Saint-Pol (Blois) Graf Guido III. (Guy) von Châtillon-Saint-Pol (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_III._(St._Pol) Guido heiratete Marie von der Bretagne am 22 Jul 1292. Marie (Tochter von Herzog Johann II. von der Bretagne und Prinzessin Beatrix von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1268; gestorben am 5 Mrz 1339. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. |  Jacques von Châtillon (Blois) Jacques von Châtillon (Blois) |
| 78. |  Beatrix von Châtillon (Blois) Beatrix von Châtillon (Blois) Familie/Ehepartner: Graf Johann II. von Eu (Brienne). Johann (Sohn von Graf Alfons von Brienne und Gräfin Marie von Lusignan-Issoudun) gestorben am 12 Jun 1292 in Clermont-en-Beauvaisis; wurde beigesetzt in Abtei von Foucarmont. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 79. |  Herzog Johann I. von Brabant Herzog Johann I. von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Brabant) (Okt 2017) Johann heiratete Prinzessin Margarete von Frankreich in 1270. Margarete (Tochter von König Ludwig IX. von Frankreich und Königin Margarete von der Provence) wurde geboren in 1254/1255; gestorben in Jul 1271. [Familienblatt] [Familientafel] Johann heiratete Herzogin Margarete von Flandern (von Dampierre) in 1273. Margarete (Tochter von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Mathilde von Béthune) wurde geboren in cir 1251; gestorben am 3 Jul 1285. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 80. |  Herr Gottfried von Brabant-Arschot Herr Gottfried von Brabant-Arschot Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Aerschot Gottfried heiratete Jeanne Isabeau von Vierzon in 1277. Jeanne (Tochter von Herr Hervé IV. von Vierzon und Jeanne de Brenne) gestorben in cir 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. |  Maria von Brabant Maria von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria und Philipp III. hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Maria heiratete König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne am 21 Aug 1274 in Schloss Vincennes. Philipp (Sohn von König Ludwig IX. von Frankreich und Königin Margarete von der Provence) wurde geboren am 3 Apr 1245 in Burg Poissy; gestorben am 5 Okt 1285 in Perpignan; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. |  Sophie von Hessen Sophie von Hessen Notizen: Name: Sophie heiratete Graf Otto I von Waldeck in cir 1275. Otto gestorben in Nov 1305; wurde beigesetzt in Grabkapelle St. Nikolaus, Kloster Marienthal, Netze, Waldeck, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 83. |  Heinrich von Hessen Heinrich von Hessen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzogin Agnes von Bayern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. |  Adelheid von Hessen Adelheid von Hessen Notizen: Name: Adelheid heiratete Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen in 1284. Berthold (Sohn von Graf Berthold V. von Henneberg-Schleusingen und Sophia von Schwarzburg-Blankenburg) wurde geboren in 1272 in Schleusingen, Thüringen; gestorben am 13 Apr 1340 in Schleusingen, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. |  Otto I von Hessen Otto I von Hessen Notizen: Otto I. (* um 1272; † 17. Januar 1328 in Kassel) war ein Sohn des Landgrafen Heinrich I. von Hessen und dessen Gemahlin Adelheid von Braunschweig. Familie/Ehepartner: Adelheid von Ravensberg. Adelheid (Tochter von Graf Otto III. von Ravensberg und Hedwig von der Lippe) wurde geboren in cir 1270; gestorben in nach 3 Apr 1338. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 86. |  Herr Raoul II. von Clermont Herr Raoul II. von Clermont Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raoul_II._de_Clermont Raoul heiratete Vizegräfin Yolande von Dreux in vor 1268. [Familienblatt] [Familientafel]
Raoul heiratete Isabella von Hennegau in Jan 1296. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 87. |  Nicolas von Barbançon Nicolas von Barbançon Notizen: Name: Nicolas heiratete Alexandrine von Rœulx in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Nicolas heiratete Ide von Antoing in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 88. |  Richenza von Löwenstein Richenza von Löwenstein Familie/Ehepartner: Graf Berchtold IV. von Neuffen (Neifen). Berchtold (Sohn von Graf Berchtold III. von Neuffen (Neifen) und Jutta von Marstetten) gestorben in spätestens 1291. [Familienblatt] [Familientafel]
Richenza heiratete Eberhard I. von Grüningen-Landau in cir 1261. Eberhard (Sohn von Graf Hartmann II. von Grüningen und Hedwig von Veringen) wurde geboren in 1232; gestorben in 1318/1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. |  Uta von Zweibrücken Uta von Zweibrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Konrad II. von Teck, der Jüngere . Konrad (Sohn von Herzog Konrad I. von Teck und von Henneberg) wurde geboren in cir 1235; gestorben am 1 Mai 1292 in Frankfurt am Main, DE; wurde beigesetzt in Marienkirche, Owen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. |  König Rudolf I. (IV.) von Habsburg König Rudolf I. (IV.) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(HRR) - Feb 2022 Rudolf heiratete Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg in 1253 in Elsass. Gertrud (Tochter von Graf Burkhard V. von Hohenberg und Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen) wurde geboren in 1225 in Deilingen; gestorben am 16 Feb 1281 in Wien; wurde beigesetzt in Münster Basel, dann Kloster St. Blasien, dann Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Kunigunde von Habsburg Kunigunde von Habsburg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich III. von Küssaberg und Stühlingen. Heinrich gestorben in 1250. [Familienblatt] [Familientafel] Kunigunde heiratete Otto II. von Ochsenstein in cir 1240. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 92. |  Graf Gottfried I. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Gottfried I. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_I._(Habsburg-Laufenburg) Familie/Ehepartner: Adelheid von Urach (von Freiburg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. |  Eberhard I. von Habsburg-Laufenburg Eberhard I. von Habsburg-Laufenburg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg-Laufenburg Eberhard heiratete Anna von Kyburg (von Thun und Burgdorf) in 1273. Anna (Tochter von Graf Hartmann V. von Kyburg und Isabel (Elisabeth) von Bourgonne-Comté (von Chalon)) wurde geboren in 1256; gestorben in 1283. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 94. |  Graf Hermann IV. von Froburg (Frohburg) Graf Hermann IV. von Froburg (Frohburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Homberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 95. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto wurde um 1278 als ältester Sohn des Grafen Dietrich VI. von Kleve und dessen erster Ehefrau Margarethe von Geldern, einer Tochter Graf Ottos von Geldern geboren. Seit 1297 wird er als Junggraf von Kleve erwähnt und trat schließlich die Nachfolge seines am 4. Oktober 1305 verstorbenen Vaters an. Dabei hatte er sich mit den Ansprüchen seiner Stiefmutter Margareta von Neu-Kyburg und seiner Halbbrüder Dietrich und Johann auseinanderzusetzen. Otto heiratete Mechtild von Virneburg in 1308. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 96. |  Margarethe von Geldern Margarethe von Geldern Notizen: Name: Margarethe heiratete Graf Dietrich VIII. (IX.) von Kleve am 7 Mai 1308. Dietrich (Sohn von Dietrich VI. (VIII.) von Kleve und Margareta von Neu-Kyburg) gestorben am 7 Jul 1347. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 97. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Jülich) Wilhelm heiratete Johanna von Avesnes (von Holland) in 1324. Johanna (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in 1315; gestorben in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. | Marie heiratete Heinrich II. von Virneburg in Datum unbekannt. Heinrich gestorben in 1338. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Graf Dietrich VIII. (IX.) von Kleve in Datum unbekannt. Dietrich (Sohn von Dietrich VI. (VIII.) von Kleve und Margareta von Neu-Kyburg) gestorben am 7 Jul 1347. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Konrad II. von Saffenberg in Datum unbekannt. Konrad gestorben in nach 17 Sep 1377. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 99. | Elisabeth heiratete Johann II. (III.?) von Sayn in Datum unbekannt. Johann gestorben in 1359. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Gottfried V. von Hatzfeld in Datum unbekannt. Gottfried gestorben in 1371. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 100. |  Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen Notizen: Graf Wilhelm I. von Katzenelnbogen (* 1270 oder 1271; † 18. November 1331) war Graf von Katzenelnbogen aus der älteren Linie der Familie. Sein Vater war Diether V. von Katzenelnbogen, seine Mutter Margarete von Jülich († 1292), Tochter aus der gleichnamigen, einflussreichen Adelsfamilie. Wilhelm heiratete Irmgard (Jutta) von Isenburg-Büdingen in 1284. Irmgard gestorben in 1309. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Waldeck. Adelheid (Tochter von Graf Otto I von Waldeck und Sophie von Hessen) gestorben am 1 Sep 1329; wurde beigesetzt in Stiftskirche St, Goar. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 101. |  Diether VI. von Katzenelnbogen Diether VI. von Katzenelnbogen Notizen: Gestorben: Diether heiratete Katharina von Kleve in vor 1308. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. |  Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Sponheim-Starkenburg) Johann heiratete Katharina von Ochsenstein in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 103. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Arnsberg) Wilhelm heiratete Beatrix von Rietberg in 1296. Beatrix (Tochter von Graf Konrad II. von Rietberg und Mechthild) gestorben in 1328/1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. |  Graf Johann I. von Holland (Gerulfinger) Graf Johann I. von Holland (Gerulfinger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Holland) Johann heiratete Prinzessin Elisabeth von England (von Rhuddlan) am 7 Jan 1297. Elisabeth (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren in Aug 1282 in Rhuddlan, Wales, England; gestorben am (5) Mai 1316; wurde beigesetzt in Walden Abbey, Essex, England. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 105. |  Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III._(Holland) Wilhelm heiratete Johanna von Valois am 19 Mai 1305. Johanna (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Marguerite von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1294; gestorben in 1352. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. |  Margarete von Avesnes Margarete von Avesnes Margarete heiratete Graf Robert II. von Artois in 1298. Robert (Sohn von Robert I. von Artois (von Frankreich) und Gräfin Mathilde von Brabant) wurde geboren in 1250; gestorben am 11 Jul 1302 in Schlachtfeld Kortrijk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 107. |  Marie von Holland (Avesnes) Marie von Holland (Avesnes) Notizen: Marie und Louis hatten sechs Kinder, zwei Söhne und vier Töchter. Marie heiratete Herzog Ludwig I. (Louis) von Bourbon in 1310 in Pontoise. Ludwig (Sohn von Prinz Robert von Frankreich (Clermont) und Gräfin Beatrix von Burgund (von Bourbon)) wurde geboren in 1279 in Clermont, Frankreich; gestorben am 29 Jan 1341 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 108. |  Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_(Brandenburg) Hermann heiratete Anna von Habsburg in 1295. Anna (Tochter von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1275/80; gestorben in 1326, 1327 oder 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. |  Jutta (Brigitte) von Brandenburg Jutta (Brigitte) von Brandenburg Notizen: Geburt: Jutta heiratete Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1298. Rudolf (Sohn von Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg) wurde geboren in 1284 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; gestorben am 12 Mrz 1356 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; wurde beigesetzt in Schlosskirche, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 110. |  Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne) Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna von Navarra und Philippe IV. zeugten 7 Kinder, von denen 3 Söhne und eine Tochter das Erwachsenenalter erreichten Johanna heiratete König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne am 16 Aug 1284 in Paris, France. Philipp (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Königin Isabella von Aragón) wurde geboren in 1268 in Fontainebleau, Frankreich; gestorben am 29 Nov 1314 in Fontainebleau, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 111. |  Graf Henry Plantagenêt (Lancaster) Graf Henry Plantagenêt (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Plantagenet,_3._Earl_of_Lancaster (Apr 2018) Henry heiratete Maud (Matilda) de Chaworth in 1297. Maud (Tochter von Patrick von Chaworth und Isabella de Beauchamp) wurde geboren in cir 1282 in Chaworth; gestorben in cir 1322. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 112. |  Graf Philippe von Artois Graf Philippe von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippe_d’Artois_(Conches) (Nov 2018) Philippe heiratete Blanche (Blanka) von der Bretagne in Nov oder Dez 1281. Blanche (Tochter von Herzog Johann II. von der Bretagne und Prinzessin Beatrix von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1270; gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 113. |  Mathilde (Mahaut) von Artois Mathilde (Mahaut) von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_(Artois) Mathilde heiratete Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) in 1285. Otto (Sohn von Hugo von Chalon (Salins) und Adelheid von Meranien (von Andechs)) wurde geboren in cir 1238; gestorben am 26 Mrz 1303. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 114. |  Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_I._(Blois) Guy heiratete Marguerite (Margarete) von Valois (Kapetinger) am 6 Okt 1310. Marguerite (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Marguerite von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1295; gestorben in Jul 1342. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 115. |  Graf Johann von Châtillon-Saint-Pol (Haus Blois) Graf Johann von Châtillon-Saint-Pol (Haus Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Jeanne de Fiennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 116. |  Mathilde von Châtillon (Blois) Mathilde von Châtillon (Blois) Notizen: Mathilde und Karl I. hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Mathilde heiratete Karl I. von Valois (Kapetinger) in Jun 1308 in Poitiers. Karl (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Königin Isabella von Aragón) wurde geboren am 12 Mrz 1270 in Schloss Vincennes; gestorben am 05/06 Dez 1325 in Nogent-le-Roi, Frankreich; wurde beigesetzt in Kirche Saint-Jacques, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 117. |  Graf Johann III. von Brienne Graf Johann III. von Brienne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._von_Eu Familie/Ehepartner: Johanna von Guînes (von Gent). Johanna (Tochter von Herr Enguerrand V. (Balduin?) von Coucy (von Guînes-Gent)) gestorben in 1332. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 118. |  Isabelle von Brienne Isabelle von Brienne Notizen: Geburt: Isabelle heiratete Johann II. (Jean) von Dampierre in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Vizegraf Johann I. (Jean) von Dampierre und Laura von Lothringen) gestorben in vor 1307. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. |  Herzog Johann II. von Brabant Herzog Johann II. von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Das einzige Kind von Johann II. und Margaret war Johann III. (1300–1355), Herzog von Brabant und Limburg. Johann heiratete Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt) am 9 Jul 1290 in Westminster Abbey, London, England. Margaret (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren am 11 Sep 1275; gestorben in 1333. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 120. |  Königin Margarete von Brabant Königin Margarete von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Brabant (Okt 2017) Margarete heiratete Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) in 1292. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich VI. von Luxemburg und Beatrix von Avesnes) wurde geboren in 1278/1279 in Valenciennes, Frankreich; gestorben am 24 Aug 1313 in Buonconvento bei Siena; wurde beigesetzt in Dom von Pisa. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 121. |  Maria (Marie) von Brabant Maria (Marie) von Brabant Maria heiratete Graf Amadeus V. von Savoyen in 1297. Amadeus (Sohn von Graf Thomas II. von Savoyen und Béatrice (Beatrix) dei Fieschi) wurde geboren in 1252/1253; gestorben am 16 Okt 1323 in Avignon, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 122. |  Elisabeth von Brabant-Arschot Elisabeth von Brabant-Arschot Elisabeth heiratete Graf Gerhard V. von Jülich in Datum unbekannt. Gerhard (Sohn von Graf Wilhelm IV von Jülich und Richarda von Geldern) wurde geboren in vor 1250; gestorben am 29 Jul 1328. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 123. |  Graf Ludwig von Évreux Graf Ludwig von Évreux Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_(Évreux) Ludwig heiratete Margarete von Artois in Anfang 1301. Margarete (Tochter von Graf Philippe von Artois und Blanche (Blanka) von der Bretagne) wurde geboren in cir 1285; gestorben am 24 Apr 1311. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 124. |  Margarethe von Frankreich Margarethe von Frankreich Notizen: Margarethe und Eduard I. hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Margarethe heiratete König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer am 10 Sep 1299 in Canterbury. Eduard (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 17 Jun 1239 in Westminster; gestorben am 7 Jul 1307 in Burgh by Sands, Grafschaft Cumberland, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 125. | Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) Blanka heiratete Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) in 1300. Rudolf (Sohn von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren in 1282; gestorben am 4 Jul 1307 in bei Horaschdowitz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 126. |  Elisabeth von Waldeck Elisabeth von Waldeck Elisabeth heiratete Dietrich III. (V.) von Honstein-Klettenberg (Hohnstein) in zw 1305 und 1310. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich II. (III.) von Honstein-Klettenberg (Hohnstein) und Sophie von Anhalt-Bernburg) wurde geboren in cir 1279; gestorben in zw 29 Sep 1329 und 4 Mai 1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 127. |  Adelheid von Waldeck Adelheid von Waldeck Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen. Wilhelm (Sohn von Graf Diether V von Katzenelnbogen und Margaretha von Jülich) wurde geboren in 1270/71; gestorben am 18 Nov 1331. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 128. |  Agnes von Hessen Agnes von Hessen Notizen: Name: Agnes heiratete Graf Gerlach I von Nassau in vor 1307. Gerlach (Sohn von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1258; gestorben am 7 Jan 1361 in Burg Sonnenberg; wurde beigesetzt in Kloster Klarenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 129. |  Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Heinrich heiratete Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel in 1 Jan 1317 / 1 Feb 1319. Judith (Tochter von Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange und Anna von Habsburg) wurde geboren in 1301; gestorben in 1353. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 130. |  Berthold XI. von Henneberg-Schleusingen Berthold XI. von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 131. |  Ludwig von Henneberg-Schleusingen Ludwig von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 132. |  Graf Johann I. von Henneberg-Schleusingen Graf Johann I. von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Henneberg-Schleusingen) Johann heiratete Elisabeth von Leuchtenberg in 1349. Elisabeth (Tochter von Landgraf Ulrich I. von Leuchtenberg und Anna von Nürnberg) gestorben am 25 Jul 1361. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 133. |  Gräfin Elisabeth von Henneberg Gräfin Elisabeth von Henneberg Notizen: Elisabeth und Johann II. hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Familie/Ehepartner: Burggraf Johann II. von Nürnberg (Hohenzollern). Johann (Sohn von Burggraf Friedrich IV. (Frederick) von Nürnberg (Hohenzollern) und Margarethe (Margareta) von Kärnten) wurde geboren in vor 1320 (ev 1309?); gestorben in 1357. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 134. |  Landgraf Heinrich II von Hessen Landgraf Heinrich II von Hessen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Hessen) (Mai 2020) Heinrich heiratete Elisabeth von Thüringen (Meissen, Wettiner) in 1321. Elisabeth (Tochter von Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) und Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk) wurde geboren in 1306; gestorben in 1367 in Eisenach; wurde beigesetzt in Eisenach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 135. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig der Junker (* 1305; † 2. Februar 1345) war der dritte Sohn des Landgrafen Otto I. von Hessen und dessen Frau Adelheid von Ravensberg, Tochter von Otto III. von Ravensberg. Ludwig heiratete Elisabeth (Elise) von Sponheim am 15 Okt 1340. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 136. |  Alix von Clermont (von Châteaudun) Alix von Clermont (von Châteaudun) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Wilhelm von Flandern (von Dampierre). Wilhelm (Sohn von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Mathilde von Béthune) gestorben in 1311. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 137. |  Herr Nicolas von Barbançon Herr Nicolas von Barbançon Notizen: Name: Nicolas heiratete Marguerite von Looz (Loon) in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 138. |  Graf Albert II. von Neuffen (Neifen) Graf Albert II. von Neuffen (Neifen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Elisabeth von Graisbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 139. |  Eberhard II. von Grüningen-Landau Eberhard II. von Grüningen-Landau Notizen: Name: Eberhard heiratete Irmgard von Pfirt in 1291 in Burg Landau. Irmgard (Tochter von Graf Ulrich von Pfirt und Herrin Agnes de Vergy) wurde geboren in 1272 in Hohenpfirt, Ferrette, Haut-Rhin, Alsace, France; gestorben in cir 1329. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Mechthild von Pfullingen. Mechthild gestorben in nach 1341. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 140. |  Simon von Teck Simon von Teck Familie/Ehepartner: Agnes von Helfenstein. Agnes (Tochter von Graf Ulrich III. von Helfenstein und Adelheid von Graisbach) gestorben in 1335/36. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 141. |  Mathilde von Habsburg Mathilde von Habsburg Mathilde heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 24 Okt 1273 in Aachen, Deutschland. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 142. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(HRR) Albrecht heiratete Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz) am 20 Nov 1274 in Wien. Elisabeth (Tochter von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1262 in München, Bayern, DE; gestorben am 28 Okt 1313 in Königsfelden, Brugg; wurde beigesetzt in Zuerst Kloster Königsfelden, 1770 in das Kloster St. Blasien, 1809 nach Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 143. |  Katharina von Habsburg Katharina von Habsburg Notizen: Katharina hatte mit Otto III. zwei Kinder, die Zwillinge Rudolf und Heinrich, die allerdings schon im Jahr ihrer Geburt, 1280, gestorben waren. Katharina heiratete König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) in cir 1279 in Wien. Otto (Sohn von Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren am 11 Feb 1261; gestorben am 9 Sep 1312 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 144. |  Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Agnes Gertrud (Hagne) von Habsburg Notizen: Agnes hatte mit Albrecht II. sechs Kinder. Agnes heiratete Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in 1273. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) und Helene von Braunschweig) wurde geboren in cir 1250; gestorben am 25 Aug 1298 in Schlachtfeld bei Aken an der Elbe; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 145. | 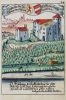 Klementia von Habsburg Klementia von Habsburg Notizen: Klementia und Karl Martell von Ungarn hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Klementia heiratete Karl Martell von Ungarn (von Anjou) am 11 Jan 1281 in Wien. Karl (Sohn von Karl II. von Anjou (von Neapel), der Lahme und Maria von Ungarn) wurde geboren am 8 Sep 1271; gestorben am 19 Aug 1295 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 146. |  Graf Hartmann von Habsburg Graf Hartmann von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmann_von_Habsburg Familie/Ehepartner: Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt). Johanna (Tochter von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren in 1272 in Schlachtfeld vor Akkon, Israel; gestorben am 23 Apr 1307 in Clare Castle, Suffolk; wurde beigesetzt in Augustinerpriorei Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 147. | 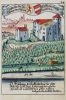 Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf II. von Österreich (von Habsburg) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Österreich) Rudolf heiratete Agnes von Böhmen (Přemysliden) in 1289 in Prag, Tschechien . Agnes (Tochter von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren in 1269; gestorben in 1296. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 148. |  Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guta_von_Habsburg Guta heiratete König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) am 7 Feb 1285 in Prag, Tschechien . Wenzel (Sohn von König Ottokar II. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Königin Kunigunde von Halitsch) wurde geboren am 27 Sep 1271; gestorben am 21 Jun 1305 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Kirche des Kloster Königsaal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 149. |  Otto III. von Ochsenstein Otto III. von Ochsenstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Lichtenberg. Kunigunde (Tochter von Heinrich II von Lichtenberg und Adelheid von Eberstein) gestorben in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 150. |  Katharina von Ochsenstein Katharina von Ochsenstein Katharina heiratete Emich V. von Leiningen in Datum unbekannt. Emich (Sohn von Graf Emich IV. von Leiningen und Elisabeth) gestorben in 1289. [Familienblatt] [Familientafel] Katharina heiratete Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Heinrich I. von Sponheim-Starkenburg und Blancheflor von Jülich) wurde geboren in zw 1265 und 1270; gestorben in 22 Feb oder 29 Mrz 1324. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 151. |  Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein Adelheid (Adélaïde) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Graf Berthold II. von Neuenburg-Strassberg. Berthold (Sohn von Herr Berthold I. von Neuenburg-Strassberg und Jeanne von Granges) gestorben in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 152. |  Graf Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Rudolf III. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III._(Habsburg-Laufenburg) Rudolf heiratete Elisabeth von Rapperswil in 1296. Elisabeth (Tochter von Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) und Mechthild von Neifen) wurde geboren in ca 1251 oder 1261; gestorben in 1309 in Vermutlich Rapperswil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 153. |  Graf Werner I. (III.) von Homberg Graf Werner I. (III.) von Homberg Familie/Ehepartner: Kunigunde. Kunigunde gestorben in 20 Sep. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 154. | Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Adolf II von der Mark. Adolf gestorben in 1347. [Familienblatt] [Familientafel] Irmgard heiratete Herr Johann (Jan) IV. Herbaren von Arkel in cir 1324. Johann (Sohn von Johan (Jan) III. Herbaren von Arkel und Mabelia von Voorne) wurde geboren in 1305 in Gornichem, Holland; gestorben in 5 Mai 1360 (54-55) in Gornichem, Holland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 155. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Gerhard heiratete Margarete von Ravensberg-Berg in 1338. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 156. |  Graf Wilhelm II von Katzenelnbogen Graf Wilhelm II von Katzenelnbogen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Graf Wilhelm II. von Katzenelnbogen (* 1315; † vor dem 23. Oktober 1385) war Mitglied der älteren Linie der Grafen von Katzenelnbogen. Wilhelm heiratete Prinzessin Johanna von Mömpelgard in 1339. Johanna wurde geboren in 1284; gestorben in 1349. [Familienblatt] [Familientafel]
Wilhelm heiratete Elisabeth von Hanau in nach 22 Jun 1355. Elisabeth (Tochter von Ulrich III. von Hanau und Adelheid von Nassau) wurde geboren in zw 1335 und 1340; gestorben in nach 2 Okt 1396. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 157. |  Elisabeth von Katzenelnbogen Elisabeth von Katzenelnbogen Elisabeth heiratete Walram von Sponheim-Kreuznach) in 1330. Walram (Sohn von Simon II. von Sponheim-Kreuznach und Elisabeth von Valkenburg) wurde geboren in cir 1305; gestorben in 1380. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 158. |  Lisa (Elisabeth) von Katzenelnbogen Lisa (Elisabeth) von Katzenelnbogen Lisa heiratete Philipp von Sponheim-Bolanden in Datum unbekannt. Philipp (Sohn von Heinrich I. von Sponheim-Bolanden und Kunigunde von Bolanden) gestorben in 1338. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 159. |  Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Sponheim-Starkenburg) Heinrich heiratete Gräfin Loretta von Salm in Datum unbekannt. Loretta (Tochter von Johann I. von Salm und Jeanne von Joinville (von Geneville)) wurde geboren in 1300; gestorben in 1345/1346; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 160. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_IV._(Arnsberg) Gottfried heiratete Gräfin Anna von Kleve in Datum unbekannt. Anna (Tochter von Dietrich VI. (VIII.) von Kleve und Margareta von Neu-Kyburg) gestorben in nach 1377/78 vor 1 Mai 1392; wurde beigesetzt in Kloster Wedinghausen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 161. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Margarethe und Ludwig hatten zehn Kinder, fünf Töchter und fünf Söhne. Margarethe heiratete Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer am 25 Feb 1324 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Ludwig (Sohn von Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge und Mathilde von Habsburg) wurde geboren am 1282 oder 1286 in München, Bayern, DE; gestorben am 11 Okt 1347 in Puch bei Fürstenfeldbruck; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 162. |  Philippa von Hennegau (von Avesnes) Philippa von Hennegau (von Avesnes) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Philippa und Eduard hatten dreizehn Kinder, darunter sechs Söhne und vier Töchter. Philippa heiratete König Eduard III. von England (Plantagenêt) in 1328. Eduard (Sohn von König Eduard II. von England (Plantagenêt) und Prinzessin Isabelle von Frankreich) wurde geboren am 13 Nov 1312 in Windsor Castle; gestorben am 21 Jun 1377 in Sheen Palace, Richmond; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 163. |  Johanna von Avesnes (von Holland) Johanna von Avesnes (von Holland) Johanna heiratete Herzog Wilhelm I. von Jülich in 1324. Wilhelm (Sohn von Graf Gerhard V. von Jülich und Elisabeth von Brabant-Arschot) wurde geboren in cir 1299; gestorben am 26 Feb 1361. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 164. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_I._de_Bourbon (Nov 2018) Pierre heiratete Isabella von Valois in 1336. Isabella (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Mathilde von Châtillon (Blois)) wurde geboren in 1313; gestorben am 26 Jul 1341 in Paris, France; wurde beigesetzt in Couvent des Cordelières in Saint-Marcel bei Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 165. |  Marguerite von Bourbon Marguerite von Bourbon Marguerite heiratete Herr Jean II. von Sully in Datum unbekannt. Jean (Sohn von Henri IV. von Sully und Jeanne von Vendôme (Montoire)) wurde geboren in 1313; gestorben in 1343. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 166. |  Graf Jacques (Jakob) I. von Bourbon-La Marche Graf Jacques (Jakob) I. von Bourbon-La Marche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_I._de_Bourbon,_comte_de_La_Marche Jacques heiratete Herrin Jeanne von Châtillon in 1335. Jeanne wurde geboren in 1320; gestorben in 1371. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 167. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Judith heiratete Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere in 1 Jan 1317 / 1 Feb 1319. Heinrich (Sohn von Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen und Adelheid von Hessen) wurde geboren in vor 1300; gestorben am 10 Sep 1347 in Schleusingen, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 168. |  Markgraf Johann V. von Brandenburg Markgraf Johann V. von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_V._(Brandenburg) Johann heiratete Katharina von Glogau in Datum unbekannt. Katharina (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 169. |  Mathilde von Brandenburg Mathilde von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Mathilde heiratete Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in 1292; gestorben am 22 Jan 1342 in Sagan, Lebus, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 170. |  Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Name: Agnes heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in 1328. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 171. |  Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Fürst Albrecht II. von Anhalt-Zerbst-Köthen. Albrecht gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 172. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig X. war Vater einer unehelichen Tochter: Ludwig heiratete Königin Margarete von Burgund in 1305. Margarete (Tochter von Herzog Robert II. von Burgund und Prinzessin Agnes von Frankreich) wurde geboren in cir 1290; gestorben am 30 Apr 1315 in Château-Gaillard. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 173. |  Prinzessin Isabelle von Frankreich Prinzessin Isabelle von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Isabella und Eduard II. hatten vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Isabelle heiratete König Eduard II. von England (Plantagenêt) am 25 Jan 1308. Eduard (Sohn von König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer und Eleonore von Kastilien) wurde geboren am 25 Apr 1284 in Caernarvon, Wales; gestorben am 21 Sep 1327 in Berkeley Castle, Gloucestershire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 174. |  König Philipp V. von Frankreich König Philipp V. von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_V._(Frankreich) Philipp heiratete Gräfin Johanna II. von Burgund in Jan 1307. Johanna (Tochter von Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (Salins, Chalon) und Mathilde (Mahaut) von Artois) wurde geboren in cir 1291; gestorben am 21 Jan 1330 in Roye; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 175. |  Henry of Grosmont (Lancaster) Henry of Grosmont (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_of_Grosmont,_1._Duke_of_Lancaster Familie/Ehepartner: Isabel von Beaumont. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 176. | Matilda (Maud) von Lancaster Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Matilda_of_Lancaster Matilda heiratete William von Burgh, 3. Earl of Ulster in 1327. William (Sohn von John de Burgh und Elizabeth de Clare) wurde geboren am 17 Sep 1312; gestorben am 6 Jun 1333 in Belfast. [Familienblatt] [Familientafel]
Matilda heiratete Ralph Ufford am vor Jun 1343. Ralph gestorben am 9 Apr 1346 in Johanniterkommende Kilmainham; wurde beigesetzt in Campsey Ash, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 177. |  Eleanor von Lancaster Eleanor von Lancaster Notizen: Eleanor und Richard hatten mehrere Kinder, darunter drei Söhne und drei Töchter. Eleanor heiratete Baron John von Beaumont, 2. Baron Beaumont am 6 Nov 1330 in London, England. John (Sohn von Baron Henry von Beaumont, 1. Baron Beaumont und Gräfin Alicia Comyn (von Buchan)) wurde geboren in 1318; gestorben am 14 Apr 1342. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel . Richard (Sohn von Graf Edmund FitzAlan, 9. Earl of Arundel und Alice de Warenne) wurde geboren in 1313; gestorben in 1376. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 178. |  Margarete von Artois Margarete von Artois Notizen: Margarete und Ludwig hatten fünf Kinder, zwei Töchter und drei Söhne. Margarete heiratete Graf Ludwig von Évreux in Anfang 1301. Ludwig (Sohn von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in Mai 1276; gestorben am 19 Mai 1319 in Paris, France; wurde beigesetzt in Saint-Jacques, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 179. |  Graf Robert III. von Artois Graf Robert III. von Artois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_III._(Artois) Robert heiratete Johanna (Jeanne) von Valois in 1318. Johanna (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Catherine de Courtenay) wurde geboren in 1304; gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 180. |  Jeanne von Artois Jeanne von Artois Familie/Ehepartner: Graf Gaston I. von Foix. Gaston (Sohn von Graf Roger Bernard III. von Foix und Marguerite von Montcada (Béarn)) wurde geboren in 1287; gestorben am 13 Dez 1315. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 181. |  Marie von Artois Marie von Artois Notizen: Geburt: Marie heiratete Markgraf Johann I. (Jean) von Namur (Dampierre) in 1309. Johann (Sohn von Graf Guido (Guy) I. von Flandern (Dampierre) und Isabella von Luxemburg) wurde geboren in 1267; gestorben am 31 Jan 1330. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 182. |  Gräfin Johanna II. von Burgund Gräfin Johanna II. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna und Philipp hatten sechs oder sieben Kinder, vier oder fünf Töchter und zwei Söhne. Johanna heiratete König Philipp V. von Frankreich in Jan 1307. Philipp (Sohn von König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne und Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne)) wurde geboren am 17 Nov 1293; gestorben am 3 Jan 1322 in Abtei Longchamp. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 183. |  Graf Louis I. von Châtillon (Blois) Graf Louis I. von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): |
| 184. |  Karl (Charles) von Châtillon (Blois), der Selige Karl (Charles) von Châtillon (Blois), der Selige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_(Bretagne) Karl heiratete Gräfin von Penthièvre Johanna von der Bretagne (Dreux) in 1337. Johanna (Tochter von Graf von Penthièvre Guy (Guido) von der Bretagne und Herrin von Goëllo Jeanne (Johanna) von Avaugour) wurde geboren in 1319; gestorben am 10 Sep 1384. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 185. |  Marie von Châtillon (Blois) Marie von Châtillon (Blois) Notizen: Marie und Rudolf hatten mehrere Kinder, darunter zwei (Zwillings)-Töchter und einen Sohn. Marie heiratete Herzog Rudolf von Lothringen in 1334. Rudolf (Sohn von Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur und Herzogin Elisabeth von Österreich (von Habsburg)) wurde geboren in 1320; gestorben am 26 Aug 1346. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 186. |  Gräfin Mathilde von Châtillon-Saint-Pol (Haus Blois) Gräfin Mathilde von Châtillon-Saint-Pol (Haus Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Mathilde heiratete Guido (Guy) von Luxemburg in 1350. Guido (Sohn von Johann I. von Luxemburg und Alix (Alice) von Richebourg (von Flandern, von Dampierre)) gestorben am 22 Aug 1371 in Schlachtfeld Baesweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 187. |  Prinzessin Blanca Margarete von Valois Prinzessin Blanca Margarete von Valois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Blanca Margarete und Karl IV. hatten zwei Töchter. Blanca heiratete Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) in 1323 in Paris, France. Karl (Sohn von König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde und Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden)) wurde geboren am 14 Mai 1316 in Prag, Tschechien ; gestorben am 29 Nov 1378 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 188. |  Isabella von Valois Isabella von Valois Isabella heiratete Herzog Pierre I. (Peter) von Bourbon in 1336. Pierre (Sohn von Herzog Ludwig I. (Louis) von Bourbon und Marie von Holland (Avesnes)) wurde geboren in 1311; gestorben am 19 Sep 1356 in Schlachtfeld bei Nouaillé. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 189. |  Graf Rudolf I. (Raoul) von Brienne (von Eu und Guînes) Graf Rudolf I. (Raoul) von Brienne (von Eu und Guînes) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raoul_I._de_Brienne Rudolf heiratete Herrin Jeanne de Mello in 1315. Jeanne (Tochter von Dreux IV. de Mello und Jeanne von Toucy) gestorben in 1351. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 190. |  Marguerite von Dampierre Marguerite von Dampierre Notizen: Name: Marguerite heiratete Graf Walter II. (Gaucher) von Châtillon-Porcéan in 1305. Walter (Sohn von Graf Walter V. (Gaucher) von Châtillon-Porcéan) gestorben am 25 Aug 1325. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 191. |  Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Brabant) Johann heiratete Maria von Évreux in 1311. Maria (Tochter von Graf Ludwig von Évreux und Margarete von Artois) wurde geboren in 1303; gestorben am 31 Okt 1335. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 192. |  König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Böhmen (Feb 2022) Johann heiratete Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) in 1310 in Speyer, Pfalz, DE. Elisabeth (Tochter von König Wenzel II. von Böhmen (Přemysliden) und Königin Guta (Jutta, Juditha) von Habsburg) wurde geboren am 20 Jan 1292 in Prag, Tschechien ; gestorben am 28 Sep 1330 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Beatrice von Bourbon in 1334 in Schloss Vincennes. Beatrice wurde geboren in vor 1320; gestorben am 23 Dez 1383. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 193. |  Königin Beatrix von Luxemburg Königin Beatrix von Luxemburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrix_von_Luxemburg (Okt 2017) Beatrix heiratete König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) am 24 Jun 1318. Karl (Sohn von Karl Martell von Ungarn (von Anjou) und Klementia von Habsburg) wurde geboren in 1288 in Neapel, Italien; gestorben am 16 Jul 1342 in Visegrád, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 194. |  Anna von Savoyen Anna von Savoyen Anna heiratete Kaiser Andronikos III. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) in 1325. Andronikos (Sohn von Kaiser Michael IX. Palaiologos (Byzanz) (Palaiologen) und Rita (Maria) von Armenien (Hethumiden)) wurde geboren am 25 Mrz 1297 in Konstantinopel; gestorben am 15 Jun 1341 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 195. |  Beatrice von Savoyen Beatrice von Savoyen Notizen: Die Ehe der Beatrice mit Heinrich blieb kinderlos. Beatrice heiratete Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) in Feb 1328. Heinrich (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 2 Apr 1335 in Schloss Tirol. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 196. | Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Savoyen Katharina heiratete Herzog Leopold I. von Österreich (von Habsburg) am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Leopold (Sohn von König Albrecht I. von Österreich (von Habsburg) und Königin Elisabeth von Kärnten (Tirol-Görz)) wurde geboren am 4 Aug 1290 in Wien; gestorben am 28 Feb 1326 in Strassburg, Elsass, Frankreich; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann Dom St. Blasien, dann Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 197. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Jülich) Wilhelm heiratete Johanna von Avesnes (von Holland) in 1324. Johanna (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in 1315; gestorben in 1374. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 198. | Marie heiratete Heinrich II. von Virneburg in Datum unbekannt. Heinrich gestorben in 1338. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Graf Dietrich VIII. (IX.) von Kleve in Datum unbekannt. Dietrich (Sohn von Dietrich VI. (VIII.) von Kleve und Margareta von Neu-Kyburg) gestorben am 7 Jul 1347. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Konrad II. von Saffenberg in Datum unbekannt. Konrad gestorben in nach 17 Sep 1377. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 199. | Elisabeth heiratete Johann II. (III.?) von Sayn in Datum unbekannt. Johann gestorben in 1359. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Gottfried V. von Hatzfeld in Datum unbekannt. Gottfried gestorben in 1371. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 200. |  Maria von Évreux Maria von Évreux Maria heiratete Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator in 1311. Johann (Sohn von Herzog Johann II. von Brabant und Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1300; gestorben am 5 Dez 1355 in Brüssel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 201. |  König Philipp III. von Évreux (von Navarra) König Philipp III. von Évreux (von Navarra) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_III._(Navarra) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Königin Johanna II. von Frankreich (von Navarra). Johanna (Tochter von König Ludwig X. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Zänker und Königin Margarete von Burgund) wurde geboren in 1311; gestorben am 6 Okt 1349 in Château de Conflans. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 202. |  Margarete von Évreux Margarete von Évreux Notizen: Margarete und Wilhelm XII. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Margarete heiratete Graf Wilhelm XII. von Boulogne (von Auvergne) in 1325. Wilhelm (Sohn von Graf Robert VII. von Boulogne (von Auvergne) und Blanche von Bourbon (Clermont)) gestorben am 6 Aug 1332 in Vic-le-Comte. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 203. |  Graf Edmund von Kent (von Woodstock) Graf Edmund von Kent (von Woodstock) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_of_Woodstock,_1._Earl_of_Kent Edmund heiratete Margaret von Liddell in Dez 1325. Margaret wurde geboren in cir 1300; gestorben am 29 Sep 1349. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 204. |  Graf Dietrich V. von Honstein-Heringen (Hohnstein) Graf Dietrich V. von Honstein-Heringen (Hohnstein) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Dietrich heiratete Adelheid von Holstein-Rendsburg in 1326 / vor 22 Feb 1333. Adelheid wurde geboren in cir 1299; gestorben in vor 2 Feb 1350. [Familienblatt] [Familientafel]
Dietrich heiratete Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel in 1360 / vor 24 Aug 1366. Sophie wurde geboren in cir 1340; gestorben in cir 1394. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 205. |  Graf Ulrich (Ulmann) III. von Honstein (Hohnstein) Graf Ulrich (Ulmann) III. von Honstein (Hohnstein) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Ulrich heiratete Agnes von Braunschweig-Grubenhagen in vor 1362. Agnes (Tochter von Fürst Ernst I. von Braunschweig-Grubenhagen und Adelheid von Everstein) wurde geboren in cir 1342; gestorben in nach 5 Nov 1394. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 206. |  Graf Adolf I von Nassau-Wiesbaden-Idstein Graf Adolf I von Nassau-Wiesbaden-Idstein Notizen: Adolf I. (* um 1307; † 17. Januar 1370 in Idstein) war Graf von Nassau und Begründer der Linie Nassau-Idstein. Familie/Ehepartner: Margaretha von Nürnberg. Margaretha (Tochter von Burggraf Friedrich IV. (Frederick) von Nürnberg (Hohenzollern) und Margarethe (Margareta) von Kärnten) wurde geboren in vor 1325; gestorben in nach 13 Nov 1382. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 207. |  Adelheid von Nassau Adelheid von Nassau Adelheid heiratete Ulrich III. von Hanau in Datum unbekannt. Ulrich (Sohn von Ulrich II. von Hanau und Agnes von Hohenlohe-Weikersheim) wurde geboren in cir 1310; gestorben in 1369/1370. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 208. |  Elisabeth von Henneberg-Schleusingen Elisabeth von Henneberg-Schleusingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Henneberg-Schleusingen Elisabeth heiratete Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner in vor 17 Sep 1342. Eberhard (Sohn von Graf Ulrich III. von Württemberg und Sophia von Pfirt) wurde geboren in nach 1315; gestorben am 15 Mrz 1362 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 209. |  Katharina von Henneberg-Schleusingen Katharina von Henneberg-Schleusingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Henneberg Katharina heiratete Markgraf Friedrich III. von Meissen (Wettiner) in 1346. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) und Mathilde (Mechthild) von Bayern) wurde geboren am 14 Dez 1332 in Dresden, DE; gestorben am 21 Mai 1381 in Altenburg, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 210. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Sophie heiratete Burggraf Albrecht von Nürnberg (Hohenzollern), der Schöne in Herbst 1348. Albrecht (Sohn von Burggraf Friedrich IV. (Frederick) von Nürnberg (Hohenzollern) und Margarethe (Margareta) von Kärnten) wurde geboren in cir 1319; gestorben am 4 Apr 1361 in Baiersdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 211. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Henneberg |
| 212. | Elisabeth heiratete Fürst Johann II. von Anhalt-Köthen in cir 1366. Johann (Sohn von Fürst Albrecht II. von Anhalt-Zerbst-Köthen und Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier)) wurde geboren in cir 1340; gestorben in 3 Aug 1380 / 11 Apr 1382. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 213. | Familie/Ehepartner: Herr Gottfried II. von Hohenlohe-Uffenheim-Entsee. Gottfried (Sohn von Herr Ludwig von Hohenlohe-Uffenheim-Entsee und Elisabeth von Nassau) wurde geboren in vor 1344; gestorben in 1387/1390. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 214. |  Graf Heinrich X. (VII.) von Henneberg-Schleusingen Graf Heinrich X. (VII.) von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Heinrich heiratete Mathilde (Mechtildis) von Baden in vor 4 Jul 1376. Mathilde (Tochter von Markgraf Rudolf VI von Baden und Mechtild von Sponheim) wurde geboren in vor 22 Jun 1368; gestorben am 3/6 Aug 1425 in Schleusingen, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 215. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 216. |  Margarete von Nürnberg Margarete von Nürnberg Notizen: Name: Margarete heiratete Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) in 14 Feb1359 in Landshut, Bayern, DE. Stephan (Sohn von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Beatrix von Schlesien-Schweidnitz) wurde geboren in 1319; gestorben am 5 Mai 1375 in Landshut oder München; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 217. |  Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Friedrich V. von Nürnberg (* um 1333; † 21. Januar 1398) war Burggraf von Nürnberg aus dem Haus Hohenzollern. Friedrich heiratete Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner) in 1350. Elisabeth (Tochter von Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) und Mathilde (Mechthild) von Bayern) wurde geboren am 22 Nov 1329 in Wartburg, Thüringen, DE; gestorben am 21 Apr 1375. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 218. |  Prinzessin Adelheid von Hessen Prinzessin Adelheid von Hessen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Adelheid und Kasimir III. hatten keine Kinder. Adelheid heiratete König Kasimir III. von Polen (Piasten) in 1341. Kasimir (Sohn von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren am 30 Apr 1310 in Kowal; gestorben am 5 Nov 1370 in Krakau, Polen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 219. |  prinzessin Elisabeth von Hessen prinzessin Elisabeth von Hessen Elisabeth heiratete Ernst I. von Braunschweig-Göttingen in 1339. Ernst (Sohn von Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen), der Fette und Herzogin Rixa von Werle) wurde geboren in cir 1305; gestorben am 24 Apr 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 220. | Notizen: Hermann II. von Hessen (* 1341 auf Burg Grebenstein; † 24. Mai 1413), auch der Gelehrte genannt, war ab 1367 Mitregent und später Landgraf von Hessen. Hermann heiratete Johanna von Nassau-Weilburg in 1377. [Familienblatt] [Familientafel] Hermann heiratete Margarete von Nürnberg in 1383. Margarete wurde geboren in 1363; gestorben in 11406. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 221. |  Wilhelm von Flandern (von Dampierre) Wilhelm von Flandern (von Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): |
| 222. |  Johann von Flandern (Dampierre) Johann von Flandern (Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 223. |  Guido (Guy) von Richebourg (von Flandern, von Dampierre) Guido (Guy) von Richebourg (von Flandern, von Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 224. |  Maria von Flandern (von Dampierre) Maria von Flandern (von Dampierre) Maria heiratete Graf Robert VII. von Boulogne (von Auvergne) am Dez 1312 ?. Robert (Sohn von Graf Robert VI. von Auvergne und Herrin Beatrix (Beatrice) von Montgascon) wurde geboren in cir 1282; gestorben am 13 Okt 1325 in Saint-Geraldus; wurde beigesetzt in Le Bouchet (heute Ortsteil von Manzat). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 225. |  Alix von Flandern (von Dampierre) Alix von Flandern (von Dampierre) Notizen: Geburt: Alix heiratete Herr Johann I. von Chalon (von Arlay) in 1312. Johann (Sohn von Graf Johann I. von Chalon (Salins) und Laura von Commercy) gestorben am 13 Feb 1315. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 226. |  Jeanne von Barbançon Jeanne von Barbançon Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Herr von Havré Gérard II. von Enghien. Gérard (Sohn von Herr von Havré Gérard I. von Enghien und Herrin Marie von Fagnolle (Rumigny)) gestorben in nach 1385. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 227. |  Graf Berthold V. von Graisbach (von Neifen) Graf Berthold V. von Graisbach (von Neifen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_V._von_Neuffen Familie/Ehepartner: Elisabeth von Truhendingen. Elisabeth (Tochter von Graf Ulrich von Truhendingen und Imagina von Limburg) gestorben am 20 Mrz 1336. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 228. |  Klara von Neuffen (Neifen) Klara von Neuffen (Neifen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herren_von_Neuffen Familie/Ehepartner: Johann Truchsess von Waldburg. Johann (Sohn von Eberhard Truchsess von Waldburg und Elisabeth von Montfort) gestorben in 1338/39. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 229. |  Eberhard III. von Landau Eberhard III. von Landau Notizen: Name: Eberhard heiratete Guta von Gundelfingen in 1330 in Burg Landau. Guta (Tochter von Berthold von Gundelfingen, der Jüngere und von Becht) wurde geboren in cir 1302 in Gundelfingen, Münsingen, DE; gestorben in 1363 in Binswangen, Dillingen an der Donau, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Elisabeth. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 230. |  Agnes von Teck Agnes von Teck Notizen: Stammliste der Herzöge von Teck: Familie/Ehepartner: Eberhard Truchsess von Waldburg. Eberhard (Sohn von Johann Truchsess von Waldburg und Klara von Neuffen (Neifen)) gestorben in 1361/62. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 231. |  Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I,_Duke_of_Bavaria Rudolf heiratete Prinzessin Mechthild von Nassau am 1 Sep 1294 in Nürnberg, Bayern, DE. Mechthild (Tochter von König Adolf von Nassau und Imagina von Limburg (von Isenburg)) wurde geboren in 1280; gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 232. |  Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild (Mathilde) von Bayern (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Fürst Otto II. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) in 1288. Otto (Sohn von Herzog Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) und Liutgard von Holstein) wurde geboren in cir 1266; gestorben am 10 Apr 1330; wurde beigesetzt in Kloster St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 233. |  Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes von Bayern (Wittelsbacher) Agnes heiratete Markgraf Heinrich I. von Brandenburg (Askanier) in 1303. Heinrich (Sohn von Markgraf Johann I. von Brandenburg (Askanier) und Jutta (Brigitte) von Sachsen (Askanier)) wurde geboren am 21 Mrz 1256; gestorben am 14 Feb 1318. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Landgraf Heinrich von Hessen in 1290. Heinrich wurde geboren in 1264; gestorben in 1298. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 234. |  Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(HRR) Ludwig heiratete Beatrix von Schlesien-Schweidnitz in cir 1308. Beatrix (Tochter von Herzog Bolko I. von Schlesien (von Schweidnitz) (Piasten) und Beatrix von Brandenburg) wurde geboren in cir 1290; gestorben am 24 Aug 1322 in München, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Margarethe von Hennegau (von Holland) am 25 Feb 1324 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Margarethe (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren in ca 1307 / 1310 in Valenciennes ?; gestorben am 23 Jun 1356 in Quesnoy; wurde beigesetzt in Minoritenkirche zu Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 235. |  Anna von Habsburg Anna von Habsburg Notizen: Anna und Hermann (III.) der Lange hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Anna heiratete Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange in 1295. Hermann (Sohn von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) wurde geboren in cir 1275; gestorben am 1 Feb 1308 in bei Lübz; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 18 Mrz 1294; gestorben am 24 Nov 1335; wurde beigesetzt in Klarissenkloster, Breslau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 236. |  Agnes von Habsburg (von Ungarn) Agnes von Habsburg (von Ungarn) Notizen: Über Kinder von Agnes mit Andreas III. ist nichts bekannt. Agnes heiratete König Andreas III. von Ungarn (Árpáden), der Venezianer am 13 Feb 1296 in Wien. Andreas (Sohn von Prinz Stephan von Slowenien (von Ungarn) (Árpáden) und Katharina Morosini (Morossini)) wurde geboren in cir 1265; gestorben am 14 Jan 1301. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 237. |  Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Graf Rudolf VI. (I.) von Habsburg (von Böhmen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Böhmen) Rudolf heiratete Blanka (Blanche) von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger) in 1300. Blanka (Tochter von König Philipp III. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Kühne und Maria von Brabant) wurde geboren in cir 1285 in Paris, France; gestorben am 1 Mrz 1305 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Elisabeth (Rixa) von Polen am 16 Okt 1306. Elisabeth (Tochter von Przemysł II. von Polen und Richiza (Rixa) von Schweden) wurde geboren am 1.9.1286 oder 1288 in Posen; gestorben am 19 Okt 1335 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 238. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nancy und Friedrich IV. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Elisabeth heiratete Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur in 1307 in Nancy, FR. Friedrich (Sohn von Herzog Theobald II. von Lothringen und Isabelle de Rumigny) wurde geboren am 15 Apr 1282 in Gondreville; gestorben am 23 Aug 1328 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 239. |  Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(Österreich) (Mai 2018) Albrecht heiratete Herzogin Johanna von Pfirt am 26 Mrz 1324 in Wien. Johanna (Tochter von Ulrich von Pfirt und Prinzessin Johanna von Mömpelgard) wurde geboren in 1300 in Basel, BS, Schweiz; gestorben am 15 Nov 1351 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 240. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: weblink: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(Habsburg) Leopold heiratete Prinzessin Katharina von Savoyen am 26 Mai 1315 in Basel, BS, Schweiz. Katharina (Tochter von Graf Amadeus V. von Savoyen und Maria (Marie) von Brabant) wurde geboren in zw 1297 und 1304 in Brabant; gestorben am 30 Sep 1336 in Rheinfelden, AG, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Königsfelden bei Brugg, dann 1770 Dom St. Blasien, dann 1806 Stift Spital Phyrn, dann 1809 Stiftskirchengruft Kloster Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 241. |  Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(Sachsen-Wittenberg) Rudolf heiratete Jutta (Brigitte) von Brandenburg in 1298. Jutta (Tochter von Markgraf Otto V. von Brandenburg, der Lange und Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg) gestorben am 9 Mai 1328 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Kunigunde von Polen am 28 Aug 1328. Kunigunde (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in cir 1293; gestorben in 1333/1335. [Familienblatt] [Familientafel] Rudolf heiratete Agnes von Lindow-Ruppin in 1333. Agnes (Tochter von Graf Günther ? von Lindow-Ruppin) wurde geboren in cir 1300; gestorben am 9 Mai 1343 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 242. |  König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(Ungarn) Familie/Ehepartner: Maria von Oppeln (von Beuthen). Maria (Tochter von Herzog Kasimir I. von Oppeln (von Beuthen) (Piasten) und Helena N.) gestorben in 1317. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Königin Beatrix von Luxemburg am 24 Jun 1318. Beatrix (Tochter von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren in 1305; gestorben am 11 Nov 1319; wurde beigesetzt in Kathedrale von Varaždin. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Elisabeth von Polen am 6 Jul 1320. Elisabeth (Tochter von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren in 1305; gestorben am 29 Dez 1380 in Budapest. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 243. |  Herzog Johann von Schwaben Herzog Johann von Schwaben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Parricida |
| 244. |  König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) König Wenzel III. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_III._(Böhmen) (Feb 2022) Wenzel heiratete Viola Elisabeth von Teschen in 1305. Viola (Tochter von Herzog Mesko I. (Miezko) von Teschen) wurde geboren in 1290; gestorben am 21 Sep 1317. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 245. | Anna Přemyslovna Notizen: Annas Ehe mit Heinrich blieb kinderlos. Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner). Heinrich (Sohn von Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) und Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1270; gestorben am 2 Apr 1335 in Schloss Tirol. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 246. |  Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Königin Elisabeth von Böhmen (Přemysliden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(Königin_von_Böhmen_1311–1330) (Apr 2018) Elisabeth heiratete König Johann von Luxemburg (von Böhmen), der Blinde in 1310 in Speyer, Pfalz, DE. Johann (Sohn von Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (von Limburg) und Königin Margarete von Brabant) wurde geboren am 10 Aug 1296 in Luxemburg; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 247. | Margarethe von Böhmen Margarethe heiratete Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) in vor 13 Jan 1303. Bolesław (Sohn von Herzog Heinrich V. von Schlesien (Piasten) und Elisabeth von Kalisch) wurde geboren am 23 Sep 1291; gestorben am 21 Apr 1351. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 248. |  Guota (Imagina) von Ochsenstein Guota (Imagina) von Ochsenstein Familie/Ehepartner: Donat von Vaz. Donat (Sohn von Walter V. von Vaz und Luitgard (Liukarda) von Kirchberg) gestorben am 23 Apr 1337/38 in Churwalden, GR, Schweiz; wurde beigesetzt in Churwalden, GR, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 249. |  Gertrude von Neuenburg-Strassberg Gertrude von Neuenburg-Strassberg Familie/Ehepartner: Graf Rudolf II. von Neuenburg-Nidau. Rudolf (Sohn von Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau und Richenza) gestorben in 1308/1309. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 250. |  Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Graf Othon (Otto) II. von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Marguerite von Freiburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 251. |  Graf Johann I. von Habsburg (von Laufenburg) Graf Johann I. von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Habsburg-Laufenburg) Familie/Ehepartner: Agnes von Werd. Agnes (Tochter von Sigismund von Werd) gestorben in nach 9 Feb 1354. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 252. |  Ita von Homberg Ita von Homberg Familie/Ehepartner: Friedrich IV. von Toggenburg. Friedrich (Sohn von Graf Friedrich III. von Toggenburg und Klementa von Werdenberg) gestorben am 15 Nov 1315. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 253. |  Herr Otto I. von Arkel Herr Otto I. von Arkel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Otto heiratete Elisabeth (Isabelle) de Bar-Pierrepont in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 254. |  Graf Wilhelm II. von Berg Graf Wilhelm II. von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Berg) Wilhelm heiratete Prinzessin Anna von der Pfalz in 1360. Anna (Tochter von Pfalzgraf Ruprecht II. von der Pfalz (Wittelsbacher) und Beatrix von Sizilien) wurde geboren in 1346; gestorben am 30 Nov 1415 in Düsseldorf, DE; wurde beigesetzt in Stiftskirche St. Lambertus, Düsseldorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 255. |  Anna von Katzenelnbogen Anna von Katzenelnbogen Notizen: Name: Anna heiratete Johann IV von Katzenelnbogen in 1383. Johann (Sohn von Graf Diether VIII von Katzenelnbogen und Elisabeth von Nassau-Wiesbaden) gestorben in 1444 in Burg Rheinfels, St. Goar, DE; wurde beigesetzt in Kloster Eberbach, Eltville am Rhein, Hessen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 256. |  Elisabeth von Sponheim-Kreuzach Elisabeth von Sponheim-Kreuzach Elisabeth heiratete Johann IV. von Sponheim-Starkenburg in 1346. Johann (Sohn von Johann III. von Sponheim-Starkenburg und Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher)) wurde geboren in vor 1338; gestorben in 1413/1414. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 257. |  Graf Heinrich II. von Sponheim-Bolanden Graf Heinrich II. von Sponheim-Bolanden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Sponheim-Bolanden Heinrich heiratete Adelheid von Katzenelnbogen in 1350. Adelheid (Tochter von Johann II von Katzenelnbogen) gestorben in 1397. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 258. |  Johann III. von Sponheim-Starkenburg Johann III. von Sponheim-Starkenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Sponheim-Starkenburg) Johann heiratete Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) in 1331. Mechthild (Tochter von Herzog Rudolf I. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Stammler und Prinzessin Mechthild von Nassau) wurde geboren in 1312; gestorben in 1375. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 259. | Kurfürst Ludwig VI. von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VI._(Bayern) |
| 260. |  Gräfin Elisabeth von Bayern Gräfin Elisabeth von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Bayern_(1329–1402) (Jun 2018) Elisabeth heiratete Herr von Verona Cangrande II. della Scala (Scaliger) am 22 Nov 1350. Cangrande (Sohn von Herr Mastino II. della Scala (Scaliger) und Taddea von Carrara) wurde geboren am 7 Jun 1332; gestorben am 14 Dez 1359 in Verona; wurde beigesetzt in Scalinger-Grabmäler, Verona. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Ulrich von Württemberg in 1362. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner und Elisabeth von Henneberg-Schleusingen) wurde geboren in nach 1340; gestorben am 23 Aug 1388. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 261. |  Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Bayern) Albrecht heiratete Margarete von Liegnitz-Brieg am 19 Jul 1353 in Passau. Margarete (Tochter von Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg und Agnes von Glogau-Sagan) wurde geboren in 1342/43; gestorben in 1386. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 262. |  Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Woodstock Edward heiratete Joan von Kent in 1361. Joan (Tochter von Graf Edmund von Kent (von Woodstock) und Margaret von Liddell) wurde geboren am 29 Sep 1328 in Woodstock, Oxfordshire; gestorben am 7 Aug 1385 in Wallingford, Oxfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 263. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_de_Coucy Isabella heiratete Herr Enguerrand VII. von Coucy in 1365. Enguerrand (Sohn von Herr Enguerrand VI. von Coucy und Katharina von Österreich) wurde geboren in cir 1339; gestorben am 18 Feb 1397 in Bursa, Türkei. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 264. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lionel_of_Antwerp,_1._Duke_of_Clarence Lionel heiratete Gräfin Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster am 15 Aug 1342 in Tower of London. Elizabeth (Tochter von William von Burgh, 3. Earl of Ulster und Matilda (Maud) von Lancaster) wurde geboren am 6 Jul 1332 in Carrickfergus Castle; gestorben am 10 Dez 1363 in Dublin, Irland; wurde beigesetzt in Priorat von Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 265. |  Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_of_Gaunt,_1._Duke_of_Lancaster (Okt 2017) John heiratete Blanche von Lancaster in 1359. Blanche (Tochter von Henry of Grosmont (Lancaster) und Isabel von Beaumont) wurde geboren in 25 Mär 1341 od 1345; gestorben am 12 Sep 1368 in Bolingbroke Castle, Lincolnshire; wurde beigesetzt in St Paul’s Cathedral. [Familienblatt] [Familientafel]
John heiratete Konstanze von Kastilien in 1371. Konstanze (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1354; gestorben in 1394. [Familienblatt] [Familientafel]
John heiratete Katherine (Catherine) Swynford (geb: de Roet (Rouet)) am 13 Jan 1396. Katherine (Tochter von Ritter Gilles (Payne) de Roet (Rouet)) wurde geboren in cir 1350 in Mony, Grafschaft Hennegau, Flandern; gestorben am 10 Mai 1403 in Lincoln, England; wurde beigesetzt in Lincoln Cathedral, Lincoln, England. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Marie de St. Hillaire. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 266. | 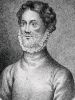 Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_of_Langley,_1._Duke_of_York Edmund heiratete Isabella von Kastilien in 1372 in Hertford Castle. Isabella (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1355 in Morales, Spanien; gestorben am 23 Dez 1392 in Hertford Castle, Hertford, Hertfordshire; wurde beigesetzt am 14 Jan 1393 in Kings Langley Manor House in Hertfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]
Edmund heiratete Johanna Holland in nach 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 267. |  Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria heiratete Herzog Johann V. von Bretagne in 1355. Johann (Sohn von Graf Johann IV. von der Bretagne (von Montfort) und Johanna von Flandern) wurde geboren in 1339; gestorben am 1 Nov 1399 in Nantes; wurde beigesetzt in Kathedrale von Nantes. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 268. |  Herzog Thomas von Woodstock (von England) Herzog Thomas von Woodstock (von England) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_of_Woodstock,_1._Duke_of_Gloucester Thomas heiratete Gräfin Eleanor de Bohun in zw 1374 und 1376. Eleanor (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1366; gestorben am 3 Okt 1399 in Minoritenkloster Aldgate in London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 269. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Gerhard heiratete Margarete von Ravensberg-Berg in 1338. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 270. |  Herzog Louis II. (Ludwig) von Bourbon Herzog Louis II. (Ludwig) von Bourbon Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_II._de_Bourbon (Sep 2023) Louis heiratete Anne von Auvergne in 1371. Anne wurde geboren in 1358; gestorben in 1417. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 271. |  Johanna (Jeanne) von Bourbon Johanna (Jeanne) von Bourbon Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna und Karl V. hatten neun Kinder, sechs Töchter und drei Söhne. Johanna heiratete König Karl V. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Weise am 8 Apr 1350 in Tain-l’Hermitage. Karl (Sohn von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 21 Jan 1338 in Schloss Vincennes; gestorben am 16 Sep 1380 in Schloss Beauté-sur-Marne bei Paris; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 272. |  Königin Blanche von Bourbon Königin Blanche von Bourbon Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Blanche_von_Bourbon (Apr 2018) Blanche heiratete König Peter I. von Kastilien am 3 Jun 1353 in Valladolid, Spanien. Peter (Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und Maria von Portugal) wurde geboren am 30 Aug 1334 in Provinz Burgos; gestorben am 23 Mrz 1369 in bei Montiel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 273. |  Bonne von Bourbon Bonne von Bourbon Notizen: Bonne und Amadeus hatten einen Sohn. Bonne heiratete Graf Amadeus VI. von Savoyen, der Grüne Graf in 1355. Amadeus (Sohn von Graf Aymon von Savoyen und Violante (Yolanda) von Montferrat (Byzanz, Palaiologen)) wurde geboren am 4 Jan 1334 in Chambéry, FR; gestorben am 1 Mrz 1383 in Campobasso. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 274. |  Cathérine von Bourbon Cathérine von Bourbon Cathérine heiratete Graf Jean VI. von Harcourt in 1359. Jean (Sohn von Graf Jean V. von Harcourt und Gräfin Blanche von Aumale (Ponthieu?)) gestorben in 1388. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 275. |  Marguerite von Bourbon Marguerite von Bourbon Familie/Ehepartner: Herr Arnaud Amanieu von Albret. Arnaud (Sohn von Bernard Aiz V. von Albret und Mathe von Armagnac) wurde geboren in Aug 1338; gestorben in 1401. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 276. |  Herr Louis I. von Sully Herr Louis I. von Sully Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Louis heiratete Herrin Isabeau (Isabelle) de Craon in Datum unbekannt. Isabeau (Tochter von Herr Maurice VI. de Craon) gestorben in 1394. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 277. |  Graf Jean I. von Bourbon-La Marche Graf Jean I. von Bourbon-La Marche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_I._de_Bourbon,_comte_de_La_Marche (Jun 2022) Jean heiratete Gräfin Catherine von Vendôme (Montoire) in 1364. Catherine (Tochter von Graf Jean VI. (Johann) von Vendôme (Montoire)) gestorben in 1412. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 278. |  Elisabeth von Henneberg-Schleusingen Elisabeth von Henneberg-Schleusingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Henneberg-Schleusingen Elisabeth heiratete Graf Eberhard II. von Württemberg, der Greiner in vor 17 Sep 1342. Eberhard (Sohn von Graf Ulrich III. von Württemberg und Sophia von Pfirt) wurde geboren in nach 1315; gestorben am 15 Mrz 1362 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 279. |  Katharina von Henneberg-Schleusingen Katharina von Henneberg-Schleusingen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Henneberg Katharina heiratete Markgraf Friedrich III. von Meissen (Wettiner) in 1346. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) und Mathilde (Mechthild) von Bayern) wurde geboren am 14 Dez 1332 in Dresden, DE; gestorben am 21 Mai 1381 in Altenburg, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 280. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Sophie heiratete Burggraf Albrecht von Nürnberg (Hohenzollern), der Schöne in Herbst 1348. Albrecht (Sohn von Burggraf Friedrich IV. (Frederick) von Nürnberg (Hohenzollern) und Margarethe (Margareta) von Kärnten) wurde geboren in cir 1319; gestorben am 4 Apr 1361 in Baiersdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 281. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Henneberg |
| 282. |  Herzog Heinrich V. von Sagan (von Glogau), der Eiserne Herzog Heinrich V. von Sagan (von Glogau), der Eiserne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(Glogau-Sagan) (Feb 2022) Heinrich heiratete Anna von Płock in 1337. Anna (Tochter von Herzog Wacław von Płock und Elisabeth von Litauen) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 283. |  Agnes von Glogau-Sagan Agnes von Glogau-Sagan Agnes heiratete Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg in zw 1341 und 1345. Ludwig (Sohn von Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) und Margarethe von Böhmen) wurde geboren in zw 1313 und 1321; gestorben in 1398. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 284. |  Katharina von Anhalt (von Bernburg) Katharina von Anhalt (von Bernburg) Notizen: Name: Katharina heiratete Fürst Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel am 6 Okt 1356. Magnus (Sohn von Herzog Magnus I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen) und Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier)) wurde geboren in 1324; gestorben am 25 Jul 1373 in Leveste am Deister. [Familienblatt] [Familientafel]
Katharina heiratete Albrecht von Sachsen-Wittenberg am 11 Mai 1374. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 285. |  Fürst Johann II. von Anhalt-Köthen Fürst Johann II. von Anhalt-Köthen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Elisabeth von Henneberg-Schleusingen in cir 1366. Elisabeth (Tochter von Graf Johann I. von Henneberg-Schleusingen und Elisabeth von Leuchtenberg) wurde geboren in 1351; gestorben am 24 Apr 1397. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 286. |  Königin Johanna II. von Frankreich (von Navarra) Königin Johanna II. von Frankreich (von Navarra) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Johanna und Philipp II. hatten acht Kinder, fünf Töchter und drei Söhne. Familie/Ehepartner: König Philipp III. von Évreux (von Navarra). Philipp (Sohn von Graf Ludwig von Évreux und Margarete von Artois) wurde geboren in 1301; gestorben am 16 Sep 1343 in Jerez de la Frontera. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 287. |  König Eduard III. von England (Plantagenêt) König Eduard III. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_III._(England) Eduard heiratete Philippa von Hennegau (von Avesnes) in 1328. Philippa (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren am 24 Jun 1311 in Valenciennes, Frankreich; gestorben am 14 Aug 1369 in Windsor. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 288. |  Johanna von England (Plantagenêt) Johanna von England (Plantagenêt) Johanna heiratete David II. von Schottland am 17 Jul 1328. David (Sohn von König Robert I. (Robert Bruce) von Schottland und Elizabeth de Burgh) wurde geboren am 5 Mrz 1324 in Dunfermline, Fife; gestorben am 22 Feb 1371 in Edinburgh Castle. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 289. |  Gräfin Johanna III. von Frankreich (von Burgund) Gräfin Johanna III. von Frankreich (von Burgund) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_III._(Burgund) Familie/Ehepartner: Herzog Odo IV. von Burgund (von Artois). Odo (Sohn von Herzog Robert II. von Burgund und Prinzessin Agnes von Frankreich) wurde geboren in 1295; gestorben am 3 Apr 1350 in Sens. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 290. |  Gräfin Margarete I. von Frankreich (von Artois) Gräfin Margarete I. von Frankreich (von Artois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Frankreich_(†_1382) Margarete heiratete Graf Ludwig I. von Flandern (von Nevers) am 21 Jul 1320. Ludwig (Sohn von Ludwig I. von Nevers (Dampierre) und Johanna von Rethel) wurde geboren in cir 1304; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 291. |  Blanche von Lancaster Blanche von Lancaster Notizen: Blanche und John hatten sieben Kinder, drei Töchter und vier Söhne. Blanche heiratete Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt in 1359. John (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 6 Mrz 1340 in Gent; gestorben am 3 Feb 1399 in Leicester. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 292. |  Gräfin Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster Gräfin Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_de_Burgh,_4._Countess_of_Ulster Elizabeth heiratete Herzog Lionel von Antwerpen (Plantagenêt) am 15 Aug 1342 in Tower of London. Lionel (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 29 Nov 1338 in Antwerpen; gestorben am 17 Okt 1368 in Alba, Italien; wurde beigesetzt in Priorat von Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 293. |  Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_FitzAlan,_11._Earl_of_Arundel (Okt 2017) Richard heiratete Gräfin Elizabeth de Bohun in 1359. Elizabeth (Tochter von Graf William de Bohun, 1st Earl of Northampton und Elizabeth de Badlesmere) wurde geboren in cir 1350 in Stamford, Lincolnshire, England; gestorben am 3 Apr 1385 in England. [Familienblatt] [Familientafel]
Richard heiratete Philippa Mortimer in 1390. Philippa (Tochter von Graf Edmund Mortimer, 3. Earl of March und Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster ) wurde geboren in 1375; gestorben in 1401. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 294. |  Joan FitzAlan Joan FitzAlan Joan heiratete Graf Humphrey de Bohun in nach 09 Sep 1359. Humphrey (Sohn von Graf William de Bohun, 1st Earl of Northampton und Elizabeth de Badlesmere) wurde geboren am 25 Mrz 1342; gestorben am 16 Jan 1373. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 295. |  Alice FitzAlan Alice FitzAlan Alice heiratete Thomas Holland, 2. Earl of Kent am 1364 od 1366. Thomas (Sohn von Thomas Holland, 1. Earl of Kent und Joan von Kent) wurde geboren in 1350; gestorben am 15 Apr 1397; wurde beigesetzt in Bourne Abbey in Lincolnshire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 296. |  Maria von Évreux Maria von Évreux Maria heiratete Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator in 1311. Johann (Sohn von Herzog Johann II. von Brabant und Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt)) wurde geboren in 1300; gestorben am 5 Dez 1355 in Brüssel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 297. |  König Philipp III. von Évreux (von Navarra) König Philipp III. von Évreux (von Navarra) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_III._(Navarra) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Königin Johanna II. von Frankreich (von Navarra). Johanna (Tochter von König Ludwig X. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Zänker und Königin Margarete von Burgund) wurde geboren in 1311; gestorben am 6 Okt 1349 in Château de Conflans. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 298. |  Margarete von Évreux Margarete von Évreux Notizen: Margarete und Wilhelm XII. hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Margarete heiratete Graf Wilhelm XII. von Boulogne (von Auvergne) in 1325. Wilhelm (Sohn von Graf Robert VII. von Boulogne (von Auvergne) und Blanche von Bourbon (Clermont)) gestorben am 6 Aug 1332 in Vic-le-Comte. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 299. |  Graf Johann (Jean) von Artois, Ohneland Graf Johann (Jean) von Artois, Ohneland Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_d’Artois,_comte_d’Eu Familie/Ehepartner: Isabelle von Melun. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 300. |  Gaston II. von Foix, der Tapfere Gaston II. von Foix, der Tapfere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_II._(Foix) Familie/Ehepartner: Aliénor von Comminges. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 301. |  Roger Bernard IV. von Castelbon Roger Bernard IV. von Castelbon Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vizegrafschaft_Castelbon Familie/Ehepartner: Geraude von Navailles. Geraude wurde geboren in Navailles. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 302. |  Ludwig von Namur (Dampierre) Ludwig von Namur (Dampierre) Anderer Ereignisse und Attribute:
Ludwig heiratete Herrin Isabelle de Roucy (Pierrepont) in Datum unbekannt. Isabelle (Tochter von Graf Robert II. de Roucy (Pierrepont) und Marie von Enghien) gestorben in nach 1396. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 303. |  Graf Jean I. (Johann) von Châtillon (Blois) Graf Jean I. (Johann) von Châtillon (Blois) Jean heiratete Marguerite (Margot) de Clisson am 20 Jan 1387. Marguerite (Tochter von Olivier V. de Clisson) gestorben in 1441. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 304. |  Marie von Châtillon (Blois) Marie von Châtillon (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_von_Châtillon-Blois (Okt 2017) Marie heiratete Ludwig I. von Anjou in 1360. Ludwig (Sohn von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 23 Jul 1339; gestorben am 22 Sep 1384 in Bisceglie bei Bari. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 305. |  Herzog Johann I. von Lothringen Herzog Johann I. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Lothringen) Johann heiratete Sophie von Württemberg am 16 Dez 1361 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. Sophie wurde geboren in 1343; gestorben in 1369. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 306. |  Graf Johann (Jean) von Luxemburg Graf Johann (Jean) von Luxemburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Johann heiratete Marguerite von Enghien in 1387. Marguerite (Tochter von Graf von Brienne Louis von Enghien und Giovanna von Sanseverino) gestorben in 1393. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 307. |  Katharina von Luxemburg (von Böhmen) Katharina von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Luxemburg Katharina heiratete Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) in Jul 1356. Rudolf (Sohn von Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) und Herzogin Johanna von Pfirt) wurde geboren am 1 Nov 1339 in Wien; gestorben am 27 Jul 1365 in Mailand. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 308. |  Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Margarethes kurze Ehe mit Ludwig I. blieb kinderlos. Margarethe heiratete König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse in 1345. Ludwig (Sohn von König Karl I. Robert (Carobert) von Ungarn (von Anjou) und Prinzessin Elisabeth von Polen) wurde geboren am 5 Mrz 1326 in Visegrád, Ungarn; gestorben am 10 Sep 1382 in Trnava; wurde beigesetzt in Székesfehérvá. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 309. |  Graf Rudolf (Raoul) II. von Brienne (von Eu und Guînes) Graf Rudolf (Raoul) II. von Brienne (von Eu und Guînes) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Raoul_II._de_Brienne Rudolf heiratete Herrin Katharina von der Waadt (von Savoyen) in 1340. Katharina (Tochter von Herr Ludwig II. von der Waadt (von Savoyen) und Isabelle von Chalon (von Arlay)) gestorben in 1388. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 310. |  Gräfin Margarete von Brabant Gräfin Margarete von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Das einzige überlebende Kind, das aus dieser Beziehung hervorging, war die am 13. April 1350 getaufte Tochter Margarete. Margarete heiratete Graf Ludwig II. von Flandern am 1 Jul 1347. Ludwig (Sohn von Graf Ludwig I. von Flandern (von Nevers) und Gräfin Margarete I. von Frankreich (von Artois)) wurde geboren am 25 Okt 1330 in Male, Belgien; gestorben am 30 Jan 1384 in Lille; wurde beigesetzt in Stiftskirche Saint-Pierre, Lille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 311. |  Jutta (Bonne) von Luxemburg Jutta (Bonne) von Luxemburg Notizen: Jutta und Johann hatten ab 1336 in zwölf Jahren elf Kinder, von denen sieben das Erwachsenenalter erreichten, vier Söhne und drei Töchter. Jutta heiratete König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute am 23 Jul 1332. Johann (Sohn von König Philipp VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Johanna von Burgund) wurde geboren am 16 Apr 1319 in Schloss Gué de Maulny, Le Mans; gestorben am 8 Apr 1364 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 312. |  Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: 1. Ehe: Karl IV. heiratete 1329 Blanca Margarete von Valois. Karl heiratete Prinzessin Blanca Margarete von Valois in 1323 in Paris, France. Blanca (Tochter von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Mathilde von Châtillon (Blois)) wurde geboren in 1316/1317; gestorben am 1 Aug 1348 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Königin Anna von der Pfalz (Wittelsbacher) in Mrz 1349 in Burg Stahleck. Anna wurde geboren am 26 Sep 1329; gestorben am 2 Feb 1353 in Prag, Tschechien . [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Prinzessin Anna von Schweidnitz in 1353. Anna wurde geboren in 1339; gestorben am 11 Jul 1362 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Kaiserin Elisabeth von Pommern am 21 Mai 1363 in Krakau, Polen. Elisabeth (Tochter von Herzog Bogislaw V. von Pommern (Greifen) und Prinzessin Elisabeth von Polen) wurde geboren in cir 1345; gestorben am 14 Feb 1393 in Prag, Tschechien ; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prager Burg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 313. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Habsburg_(1320–1349) Katharina heiratete Herr Enguerrand VI. von Coucy in Nov 1338. Enguerrand (Sohn von Herr Guillaume I. von Coucy) wurde geboren in 1313; gestorben am 26 Aug 1346 in Schlachtfeld bei Crécy-en-Ponthieu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 314. |  Maria von Navarra Maria von Navarra Maria heiratete König Peter IV. von Aragón in 1338. Peter (Sohn von König Alfons IV. von Aragón und Gräfin Teresa d’Entença (von Urgell)) wurde geboren am 5 Sep 1319 in Balaguer; gestorben am 6 Jan 1387 in Barcelona. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 315. |  Königin Blanka von Évreux (von Navarra) Königin Blanka von Évreux (von Navarra) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Blanka und Philipp VI. hatten eine Tochter. Blanka heiratete König Philipp VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) am 29 Jan 1350. Philipp (Sohn von Karl I. von Valois (Kapetinger) und Marguerite von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in 1293; gestorben am 22 Aug 1350 in Coulombs. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 316. |  König Karl II. von Navarra, der Böse König Karl II. von Navarra, der Böse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_II._(Navarra) Karl heiratete Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) am 3 Nov 1353. Johanna (Tochter von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 24 Jun 1343; gestorben am 3 Nov 1373. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 317. |  Jeanne (Johanna) de Navarra Jeanne (Johanna) de Navarra Jeanne heiratete Jean I. de Rohan, 11. Vicomte de Rohan in 1377. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 318. |  Königin von Frankreich Johanna von Boulogne (von Auvergne) Königin von Frankreich Johanna von Boulogne (von Auvergne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_I._(Auvergne) Johanna heiratete Graf Philipp von Burgund (von Auvergne), „Philippe Monsieur“ am 26 Sep 1338. Philipp (Sohn von Herzog Odo IV. von Burgund (von Artois) und Gräfin Johanna III. von Frankreich (von Burgund)) wurde geboren am 10 Nov 1323; gestorben am 10 Aug 1346 in vor Aiguillon. [Familienblatt] [Familientafel] Johanna heiratete König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute am 19 Feb 1350 in Nanterre. Johann (Sohn von König Philipp VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Johanna von Burgund) wurde geboren am 16 Apr 1319 in Schloss Gué de Maulny, Le Mans; gestorben am 8 Apr 1364 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 319. |  Joan von Kent Joan von Kent Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Kent Joan heiratete Thomas Holland, 1. Earl of Kent in cir 1340. Thomas (Sohn von Robert de Holand (Holland), 1. Baron Holand und Maud la Zouche) wurde geboren am 5 Mai 1314 in Upholland, Lancashire; gestorben am 26 Dez 1360 in Rouen. [Familienblatt] [Familientafel]
Joan heiratete William Montagu, 2. Earl of Salisbury in cir 1341, und geschieden am 13 Nov 1349. William (Sohn von William Montagu, 1. Earl of Salisbury und Katharine Grandison) wurde geboren am 20 Jun 1329; gestorben am 3 Jun 1397. [Familienblatt] [Familientafel] Joan heiratete Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz in 1361. Edward (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 15 Jun 1330 in Woodstock, Oxfordshire; gestorben am 8 Jun 1376 in Palace of Westminster, Westminster, England. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 320. |  Irmgard von Honstein-Heringen (Hohnstein) Irmgard von Honstein-Heringen (Hohnstein) Familie/Ehepartner: Herr Conrad (Konrad) von Tannrode. Conrad wurde geboren in 1330; gestorben in 1393/1394. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 321. |  Agnes von Honstein-Heringen (Hohnstein) Agnes von Honstein-Heringen (Hohnstein) Notizen: Agnes und Christian V. hatten zwei Söhne. Agnes heiratete Graf Christian V. von Oldenburg in 1377. Christian (Sohn von Graf Konrad I. von Oldenburg und Ingeborg von Holstein) wurde geboren in cir 1342; gestorben in nach 6 Apr 1399. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 322. |  Gräfin Adelheid von Honstein (Hohnstein) Gräfin Adelheid von Honstein (Hohnstein) Notizen: Name: Adelheid heiratete Herzog Albrecht II. von Mecklenburg in Datum unbekannt. Albrecht (Sohn von Herr Heinrich II. von Mecklenburg und Anna zu Sachsen-Wittenberg) wurde geboren in 1318; gestorben am 18 Feb 1379; wurde beigesetzt in Münster, Doberan . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 323. |  Elisabeth von Nassau-Wiesbaden Elisabeth von Nassau-Wiesbaden Notizen: Name: Elisabeth heiratete Graf Diether VIII von Katzenelnbogen in 1361. Diether (Sohn von Johann II von Katzenelnbogen) wurde geboren in 1340; gestorben am 17 Feb 1402. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 324. |  Ulrich IV. von Hanau Ulrich IV. von Hanau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_IV._(Hanau) Ulrich heiratete Elisabeth von Wertheim in 1366/1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 325. |  Elisabeth von Hanau Elisabeth von Hanau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Hanau_(Katzenelnbogen) Elisabeth heiratete Graf Wilhelm II von Katzenelnbogen in nach 22 Jun 1355. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm I von Katzenelnbogen und Adelheid von Waldeck) wurde geboren in 1315; gestorben in vor 23 Okt 1385; wurde beigesetzt in Kloster Eberbach, Hessen, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 326. |  Ulrich von Württemberg Ulrich von Württemberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_du_Wurtemberg Ulrich heiratete Gräfin Elisabeth von Bayern in 1362. Elisabeth (Tochter von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Margarethe von Hennegau (von Holland)) wurde geboren in 1329; gestorben am 2 Aug 1402 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 327. |  Kurfürst Friedrich I. (IV.) von Sachsen (von Meissen), der Streitbare Kurfürst Friedrich I. (IV.) von Sachsen (von Meissen), der Streitbare Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Friedrich IV. der Streitbare (* 11. April 1370; † 4. Januar 1428 in Altenburg) war ein Fürst aus dem Hause Wettin. Er war seit dem Tod seines Vaters 1381 Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen und wurde 1423 Herzog, Kurfürst und Pfalzgraf von Sachsen. Friedrich heiratete Prinzessin Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel am 7 Feb 1402. Katharina (Tochter von Fürst Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Milde und Sophie von Pommern) wurde geboren in 1395; gestorben am 28 Dez 1442 in Grimma. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 328. |  Margaretha von Nürnberg Margaretha von Nürnberg Margaretha heiratete Markgraf Balthasar von Meissen (Thüringen, Wettiner) in 1374. Balthasar (Sohn von Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) und Mathilde (Mechthild) von Bayern) wurde geboren am 21 Dez 1336 in Weissenfels, Sachsen-Anhalt, DE; gestorben am 18 Mai 1406 in Wartburg, Thüringen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 329. |  Anna von Nürnberg (Hohenzollern) Anna von Nürnberg (Hohenzollern) |
| 330. | Notizen: Name: Elisabeth heiratete Graf Friedrich I. von Henneberg-Aschach in vor 4 Mai 1393. Friedrich (Sohn von Hermann IV. von Henneberg-Aschach und Agnes von Schwarzburg-Blankenburg) wurde geboren in 1367; gestorben am 24 Sep 1422; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 331. |
| 332. |  Wilhelm II. (I.) von Henneberg-Schleusingen Wilhelm II. (I.) von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Wilhelm heiratete Anna von Braunschweig-Göttingen in vor 30 Mai 1413. Anna (Tochter von Herzog Otto I. von Braunschweig-Göttingen und Margarete von Berg) wurde geboren in 1387; gestorben am 27 Okt 1426. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 333. | Mechthild heiratete Günther XIX. (XXXII.) von Schwarzburg-Wachsenburg am 16 Nov 1407. Günther (Sohn von Günther XVII. (XXIX.) von Schwarzburg-Wachsenburg und Gräfin Jutta von Schwarzburg-Blankenburg) wurde geboren in cir 1380; gestorben in vor 6 Feb 1450 in Schloss Tharandt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 334. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Margarethe heiratete Günther XIV. (XXVIII.) von Schwarzburg-Blankenburg am 23 Jan 1399. Günther (Sohn von Heinrich IX. (XII.) von Schwarzburg-Blankenburg und Gräfin Agnes von Honstein-Sondershausen (Hohnstein)) wurde geboren in cir 1362; gestorben am 30 Apr 1418. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarethe heiratete Ernst VIII. von Gleichen in vor 20 Dez 1421. Ernst (Sohn von Graf Ernst I. (VI./VII.) von Gleichen (zu Wechmar und Ohrdruf) und Agnes von Colditz) gestorben am 16 Jun 1426 in Schlachtfeld bei Aussig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 335. |  Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern) Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern) Notizen: 1377 gebar Beatrix den einzigen Sohn von Albrecht III., den späteren Herzog Albrecht IV. von Österreich. Beatrix überlebte ihren Mann um viele Jahre und verbrachte ihre Witwenjahre vor allem in der alten Burg in Freistadt und in Perchtoldsdorf bei Wien, wo sie auch starb. Beatrix heiratete Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf in 1375. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht II. (VI.) von Österreich (Habsburg) und Herzogin Johanna von Pfirt) wurde geboren in zw 18 Nov 1349 und 16 Mär 1350 in Hofburg, Wien, Österreich; gestorben am 28/29 Aug 1395 in Schloss Laxenburg; wurde beigesetzt in Herzogsgruft im Wiener Stephansdom. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 336. |  Elisabeth von Hohenzollern (von Nürnberg) Elisabeth von Hohenzollern (von Nürnberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Hohenzollern-Nürnberg Elisabeth heiratete König Ruprecht III. von der Pfalz (Wittelsbacher) am 27 Jun 1374 in Amberg, Bayern, DE. Ruprecht (Sohn von Pfalzgraf Ruprecht II. von der Pfalz (Wittelsbacher) und Beatrix von Sizilien) wurde geboren am 5 Mai 1352 in Amberg, Bayern, DE; gestorben am 18 Mai 1410 in Burg Landskron bei Oppenheim; wurde beigesetzt in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 337. |  Burggraf Johann III. von Nürnberg (Hohenzollern) Burggraf Johann III. von Nürnberg (Hohenzollern) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(N%C3%BCrnberg) Johann heiratete Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) in 1375. Margarethe (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Kaiserin Elisabeth von Pommern) wurde geboren in 1373; gestorben in 1410. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 338. |  Kurfürst Friedrich I. (VI.) von Brandenburg (von Nürnberg) (Hohenzollern) Kurfürst Friedrich I. (VI.) von Brandenburg (von Nürnberg) (Hohenzollern) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Brandenburg) Friedrich heiratete Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), die Schöne Else am 18 Sep 1401. Elisabeth (Tochter von Herzog Friedrich von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), der Weise und Maddalena Visconti) wurde geboren in 1383 in Burg Trausnitz, Landshut; gestorben am 13 Nov 1442 in Ansbach, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 339. |  Herzog Otto I. von Braunschweig-Göttingen Herzog Otto I. von Braunschweig-Göttingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Braunschweig-Göttingen) Otto heiratete Miroslawa von Holstein-Plön am 19 Nov 1357. Miroslawa (Tochter von Graf Johann III. von Holstein-Kiel (Schauenburg) und Katharina von Glogau) gestorben in cir 1376. [Familienblatt] [Familientafel] Otto heiratete Margarete von Berg in 1379. Margarete (Tochter von Graf Wilhelm II. von Berg und Prinzessin Anna von der Pfalz) wurde geboren in cir 1364; gestorben in 1442. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 340. |  Margarethe von Hessen Margarethe von Hessen Margarethe heiratete Fürst Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Milde am 30 Jan 1409. Heinrich (Sohn von Fürst Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel und Katharina von Anhalt (von Bernburg)) wurde geboren in cir 1355; gestorben am 14 Okt 1416. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 341. |  Ludwig I von Hessen Ludwig I von Hessen Notizen: Ludwig I. von Hessen (der Friedfertige) (* 6. Februar 1402 in Spangenberg; † 17. Januar 1458 ebenda) wurde als Sohn des Landgrafen Hermann II. von Hessen und dessen Frau Margarethe, Tochter des Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg, geboren. Er folgte, bis 1416 unter Vormundschaft, seinem Vater im Jahre 1413 als Landgraf von Hessen. Ludwig heiratete Margarethe von Kleve in 1424 (Vereinbarung zu Ehe). Margarethe (Tochter von Herzog Adolf II. von Kleve-Mark und Maria von Burgund) wurde geboren am 23/24 Feb 1416; gestorben am 20 Mai 1444 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Prinzessin Anna von Sachsen am 13 Sep 1436. Anna (Tochter von Kurfürst Friedrich I. (IV.) von Sachsen (von Meissen), der Streitbare und Prinzessin Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel) wurde geboren am 5 Jun 1420; gestorben am 17 Sep 1462. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 342. |  Marguerite (Margarete) von Flandern (Dampierre) Marguerite (Margarete) von Flandern (Dampierre) Notizen: Geburt: Marguerite heiratete Vizegraf Guillaume I. de Craon in Datum unbekannt. Guillaume (Sohn von Herr Amaury III. de Craon und Herrin Béatrix de Roucy (Pierrepont)) gestorben in 1387. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 343. |  Alix (Alice) von Richebourg (von Flandern, von Dampierre) Alix (Alice) von Richebourg (von Flandern, von Dampierre) Notizen: Name: Alix heiratete Johann I. von Luxemburg in cir 1330. Johann (Sohn von Herr Walram II. (Waléran) von Luxemburg-Ligny und Burggräfin Guyotte von Lille) gestorben am 17 Mai 1364. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 344. |  Graf Johann I. von Auvergne (von Boulogne) Graf Johann I. von Auvergne (von Boulogne) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Johann heiratete Jeanne de Cleremont in 1328. Jeanne gestorben am 27 Jul 1383. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 345. |  Mathilde (Mahaut) von Boulogne (von Auvergne) Mathilde (Mahaut) von Boulogne (von Auvergne) Mathilde heiratete Amadeus III. von Genf in Jun 1334. Amadeus (Sohn von Wilhelm III. von Genf und Agnes von Savoyen) gestorben in 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 346. |  Katharina von Chalon (von Arlay) Katharina von Chalon (von Arlay) Familie/Ehepartner: Herr Thibaut IV. von Neuenburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 347. |  Herr von Havré Jacques von Enghien Herr von Havré Jacques von Enghien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Beruf / Beschäftigung: Jacques heiratete Jacqueline von Saint-Aubert in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Jacques heiratete Mary von Roucy (Pierrepont) in Datum unbekannt. Mary (Tochter von Graf Simon von Roucy (Pierrepont) und Marie von Châtillon-Porcéan) gestorben in 1416. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 348. |  Elisabeth von Graisbach Elisabeth von Graisbach Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herren_von_Neuffen Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Abensberg. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Abensberg) gestorben am 30 Aug 1367. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 349. |  Eberhard Truchsess von Waldburg Eberhard Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Agnes von Teck. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 350. |  Guta von Landau Guta von Landau Notizen: Name: Guta heiratete Albrecht von Aichelberg in 1350 in Aichelberg, Baden-Württrmberg, DE. Albrecht (Sohn von Graf Diepold II. von Aichelberg und Gräfin Agnes von Rechberg) wurde geboren in 1310 in Eichelberg, Östringen, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 15 Jun 1365 in Köngen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 351. |  Johannes Truchsess von Waldburg Johannes Truchsess von Waldburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Elisabeth von Habsburg-Laufenburg. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Katharina von Cilly. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Magdalena von Montfort. [Familienblatt] [Familientafel] Johannes heiratete Ursula von Abendsberg am 28 Feb 1395. Ursula (Tochter von Graf Ulrich IV. von Abensberg und Katharina von Lichtenstein) gestorben am 30 Jan 1422. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 352. |  Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Pfalzgraf Adolf von der Pfalz (Wittelsbacher), der Redliche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf,_Count_Palatine_of_the_Rhine Adolf heiratete Prinzessin Irmengard von Oettingen in 1320. Irmengard (Tochter von Graf Ludwig VI. von Oettingen und Agnes von Württemberg) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 6 Nov 1389. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 353. |  Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild von der Pfalz (Wittelsbacher) Mechthild heiratete Johann III. von Sponheim-Starkenburg in 1331. Johann (Sohn von Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg und Gräfin Loretta von Salm) wurde geboren in 1315; gestorben am 20 Dez 1398; wurde beigesetzt in Kloster Himmerod. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 354. |  Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) Mathilde heiratete Herr Nikolaus II. zu Werle in nach 1308. Nikolaus (Sohn von Herr Johann I. von Werle und Sophie von Lindau-Ruppin) wurde geboren in vor 1275; gestorben am 18 Feb 1316 in Pustow (Pustekow). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 355. |  Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia (Sophie) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Sophia heiratete Herzog Magnus I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen) in 1327. Magnus (Sohn von Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (Welfen), der Fette und Herzogin Rixa von Werle) wurde geboren in 1304; gestorben in 1369. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 356. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Judith (Jutta) von Brandenburg-Landsberg (Askanier) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Grubenhagen. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen und Markgräfin Agnes von Meissender (Wettiner)) wurde geboren in cir 1289; gestorben in 1351. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 357. |  Mathilde (Mechthild) von Bayern Mathilde (Mechthild) von Bayern Notizen: Mathilde und Friedrich II. hatten neun Kinder, vier Töchter und fünf Söhne. Mathilde heiratete Markgraf Friedrich II. von Meissen (Wettiner) in 1328 in Nürnberg, Bayern, DE. Friedrich (Sohn von Markgraf Friedrich I. von Meissen (Wettiner) und Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk) wurde geboren am 30 Nov 1310 in Gotha; gestorben am 19 Nov 1349 in Wartburg, Thüringen, DE; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 358. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_V._(Bayern) Ludwig heiratete Margarete von Dänemark am 30 Nov 1324 in Königreich Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ am 10 Feb 1342 in Schloss Tirol. Margarete (Tochter von Herzog Heinrich VI. von Kärnten (von Böhmen) (Meinhardiner) und Adelheid von Braunschweig (von Grubenhagen)) wurde geboren in 1318 in Grafschaft Tirol; gestorben am 3 Okt 1369 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 359. |  Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stephan mit der Hafte (* 1319; † Mai 1375 in Landshut oder München) war von 1347 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Er war der zweite Sohn Kaiser Ludwigs des Bayern aus dessen erster Ehe mit Beatrix von Schlesien-Schweidnitz. Stephan heiratete Prinzessin Elisabeth (Isabel) von Sizilien (von Aragôn) am 27 Jun 1328 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 21 Mrz 1349 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Stephan heiratete Margarete von Nürnberg in 14 Feb1359 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 360. |  Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Judith (Jutta) von Brandenburg-Salzwedel Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Judith heiratete Herr Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere in 1 Jan 1317 / 1 Feb 1319. Heinrich (Sohn von Graf Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen und Adelheid von Hessen) wurde geboren in vor 1300; gestorben am 10 Sep 1347 in Schleusingen, Thüringen; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 361. |  Markgraf Johann V. von Brandenburg Markgraf Johann V. von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_V._(Brandenburg) Johann heiratete Katharina von Glogau in Datum unbekannt. Katharina (Tochter von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) gestorben in 1327. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 362. |  Mathilde von Brandenburg Mathilde von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Mathilde heiratete Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) in 1310. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in 1292; gestorben am 22 Jan 1342 in Sagan, Lebus, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 363. | Elisabeth von Breslau (von Schlesien) (Piasten) Notizen: Elisabeth und Konrad I. scheinen keine Kinder gehabt zu haben. Elisabeth heiratete Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) in 1322. Konrad (Sohn von Herzog Heinrich III. von Glogau und Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen)) wurde geboren in cir 1294; gestorben am 22 Dez 1366. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 364. |  Euphemia von Breslau Euphemia von Breslau Notizen: Euphemia und Bolko II. hatten sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Euphemia heiratete Herzog Bolko II. (Boleslaus) von Falkenberg (von Oppeln) in cir 1325. Bolko (Sohn von Herzog Bolko I. (Boleslaw) von Oppeln und Gremislawa (oder Agnes)) wurde geboren in ca 1290/1295; gestorben in ca 1362/1365; wurde beigesetzt in Sankt-Annen-Kapelle, Franziskanerkloster, Oppeln. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 365. |  Herzog Rudolf von Lothringen Herzog Rudolf von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_(Lothringen) Rudolf heiratete Marie von Châtillon (Blois) in 1334. Marie (Tochter von Graf Guy I. (Guido) von Châtillon (Blois) und Marguerite (Margarete) von Valois (Kapetinger)) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
Rudolf heiratete Alienor von Bar-Scarponnois am 25 Jun 1329. Alienor (Tochter von Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois und Marie von Burgund) gestorben in 1333. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 366. |  Margarete von Österreich Margarete von Österreich Margarete heiratete Graf Meinhard III. von Tirol in Jun 1359 in Passau. Meinhard (Sohn von Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Tirol (von Kärnten), „Maultasch“ ) wurde geboren in 1344 in Landshut, Bayern, DE; gestorben am 13 Jan 1363 in Schloss Tirol oder in Meran. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Markgraf Johann Heinrich von Luxemburg am 26 Feb 1364. Johann wurde geboren am 12 Feb 1322 in Prag, Tschechien ; gestorben am 12 Nov 1375 in Brünn, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 367. |  Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Herzog Rudolf IV. von Österreich (von Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV._(Österreich) Rudolf heiratete Katharina von Luxemburg (von Böhmen) in Jul 1356. Katharina (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren in 1342 in Prag, Tschechien ; gestorben am 26 Apr 1395 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 368. |  Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_III._(Österreich) Albrecht heiratete Elisabeth von Luxemburg (von Böhmen) in 1366. Elisabeth (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Anna von Schweidnitz) wurde geboren am 19 Mrz 1358 in Prag, Tschechien ; gestorben in 04 od 19 Sept 1373 in Wien. [Familienblatt] [Familientafel] Albrecht heiratete Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern) in 1375. Beatrix (Tochter von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) und Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner)) wurde geboren in 1355; gestorben in 1414. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 369. |  Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Herzog Leopold III. von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_III._von_Habsburg (Mai 2018) Leopold heiratete Herzogin Viridis Visconti in 1365 in Wien. Viridis (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in cir 1350; gestorben am 1 Mrz 1414; wurde beigesetzt in Kloster Sittich oder in der Familiengruft zu Mailand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 370. |  Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Agnes von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Name: Agnes heiratete Fürst Bernhard III. von Anhalt-Bernburg in 1328. Bernhard gestorben am 20 Aug 1348. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 371. |  Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Beatrix von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Fürst Albrecht II. von Anhalt-Zerbst-Köthen. Albrecht gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 372. |  Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_I._(Sachsen-Wittenberg) Wenzel heiratete Cäcilia (Siliola) von Carrara am 23 Jan 1376. Cäcilia (Tochter von Franz von Carrara und Fina di Pataro) wurde geboren in cir 1350; gestorben in cir 1435 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; wurde beigesetzt in Franziskanerkloster, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 373. |  König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse König Ludwig I. von Ungarn (von Anjou), der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Ungarn) Ludwig heiratete Königin Margarethe von Luxemburg (von Böhmen) in 1345. Margarethe (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Prinzessin Blanca Margarete von Valois) wurde geboren am 25 Mai 1335 in Prag, Tschechien ; gestorben am 7 Sep 1349 in Visegrád, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Königin Elisabeth von Bosnien. Elisabeth (Tochter von Stjepan II. Kotromanić von Bosnien und Elisabeth (Jelisaveta) von Kujawien) wurde geboren in 1340; gestorben am 16 Jan 1387; wurde beigesetzt in Ihr Leichnam wurde in einen Fluss geworfen oder sie verstarb in der Gefangenschaft. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 374. |  Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Liegnitz) Ludwig heiratete Agnes von Glogau-Sagan in zw 1341 und 1345. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) und Mathilde von Brandenburg) gestorben in 1362. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 375. |  Ursula von Vaz Ursula von Vaz Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Rudolf III. von Werdenberg-Sargans. Rudolf (Sohn von Rudolf II. von Werdenberg-Sargans und Adelheid von Burgau) gestorben am 27 Dez 1361 in Chiavenna, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 376. |  Herr Rudolf III. von Neuenburg-Nidau Herr Rudolf III. von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Imier de Neuchâtel-Strassberg, (? - 03 mai 1364), comte de Strassberg. Conseiller du duc d'Autriche. Accablé de dettes il vend en 1327 son domaine de Balm à Rodolphe III de Neuchâtel-Nidau, puis quelque temps avant son décès il cède Büren à Rodolphe IV de Neuchâtel-Nidau. Familie/Ehepartner: Jonata von Neuenburg. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Verena (Varenne) von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont). Verena (Tochter von Herr Thiébaud IV. von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) und Agnes von Geroldseck am Wasichen (Ès-Vosges)) gestorben in 1372. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Gräfin Jeanne von Habsburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 377. | Propst Hartmann von Neuenburg-Nidau Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 378. |  Graf Imier von Neuenburg-Strassberg Graf Imier von Neuenburg-Strassberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Imier de Neuchâtel-Strassberg, (? - 03 mai 1364), comte de Strassberg1,2. Conseiller du duc d'Autriche. Accablé de dettes il vend en 1327 son domaine de Balm à Rodolphe III de Neuchâtel-Nidau, puis quelque temps avant son décès il cède Büren à Rodolphe IV de Neuchâtel-Nidau. Familie/Ehepartner: Marguerite von Wolhusen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 379. |  Graf Johann II. (Hans) von Habsburg (von Laufenburg) Graf Johann II. (Hans) von Habsburg (von Laufenburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Habsburg-Laufenburg) Johann heiratete Verena (Varenne) von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) in 1352. Verena (Tochter von Herr Thiébaud IV. von Neuenburg-Burgund (Neufchâtel-Blamont) und Agnes von Geroldseck am Wasichen (Ès-Vosges)) gestorben in 1372. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 380. |  Diethelm von Toggenburg Diethelm von Toggenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Adelheid von Griessenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|