
| 1. | Gotini (Gottina, Kotoni) Familie/Ehepartner: Graf Sieghard I. (Sighart) von Alemannien (Sieghardinger). Sieghard (Sohn von Graf Sigihart) gestorben in cir 906. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Karantanien Familie/Ehepartner: Engilmut. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Graf Sieghard II. von Salzburggau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  Graf Eberhard I. von Ebersberg Graf Eberhard I. von Ebersberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: |
| 5. |  Bischof Lantpert von Freising (von Ebersberg) Bischof Lantpert von Freising (von Ebersberg) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lantpert_von_Freising |
| 6. |  Markgraf Adalbero I. von Ebersberg Markgraf Adalbero I. von Ebersberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Liutgard von Dillingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Graf Sieghard III. von Chiemgau (Sieghardinger) Graf Sieghard III. von Chiemgau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |  Hadamut (Hadamuod) von Ebersberg Hadamut (Hadamuod) von Ebersberg Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Ebersberg Hadamut heiratete Markgraf Markwart III. von Eppenstein in cir 970. Markwart (Sohn von Graf Markwart II. von Eppenstein) gestorben in vor 13 Apr 1000. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. |  Ulrich von Ebersberg Ulrich von Ebersberg Ulrich heiratete Richildis von Eppenstein in cir 970. Richildis (Tochter von Graf Markwart II. von Eppenstein) gestorben in 1013. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |  Graf Sieghard IV. von Chiemgau (Sieghardiner) Graf Sieghard IV. von Chiemgau (Sieghardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Willa. Willa gestorben in 977. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbero_von_Eppenstein Familie/Ehepartner: Beatrix (Brigitta) von Schwaben. Beatrix (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) gestorben in nach 1025. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. |  Graf Eberhard von Eppenstein Graf Eberhard von Eppenstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Richgard (Sieghardinger). Richgard (Tochter von Friedrich II. (Sieghardiner)) gestorben in cir 1035. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Tuta (Judith) von Ebersberg Familie/Ehepartner: Graf Sieghard VI. (Sizzo) von Chiemgau (Sieghardiner). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Willibirg von Freising (von Ebersberg) Willibirg von Freising (von Ebersberg) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Ebersberg Familie/Ehepartner: Wergigand von Istrien-Friaul. Wergigand (Sohn von Azzo (Adalbert) (von Friaul)) wurde geboren in cir 970; gestorben in cir 1051. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Graf Sieghard V. von Chiemgau (Sieghardiner) Graf Sieghard V. von Chiemgau (Sieghardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Zloubrana. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Friedrich II. (Sieghardiner) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  Engelbert III. von Chiemgau Engelbert III. von Chiemgau Familie/Ehepartner: Adala von Bayern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |  Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) Herzog Markwart IV. von Eppenstein (von Kärnten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Markwart_IV. Familie/Ehepartner: Liutberge von Plain. Liutberge (Tochter von Liutold von Plain) gestorben in vor 1103. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. |  Willibirg von Eppenstein (von Kärnten) Willibirg von Eppenstein (von Kärnten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eppensteiner Familie/Ehepartner: Markgraf Ottokar I. von Steiermark. Ottokar (Sohn von Otakar V. Oci (Traungauer) und Willibirg von Wels-Lambach) gestorben in cir 29 Mrz 1075 in Rom, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. |  Friedrich von Eppenstein Friedrich von Eppenstein Familie/Ehepartner: Christina von Andechs. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. |  Hadamut von Eppenstein Hadamut von Eppenstein Familie/Ehepartner: Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen). Friedrich (Sohn von Friedrich II. von Diessen) wurde geboren in 1005; gestorben in 1075 in St. Blasien, Waldshut, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Marquart (Markwart) (Sieghardinger) Marquart (Markwart) (Sieghardinger) Familie/Ehepartner: Adelheid von Horburg-Lechsgemünd. Adelheid gestorben in 1112. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. |  Graf Engelbert V. von Chiemgau (Sieghardinger) Graf Engelbert V. von Chiemgau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Militär / Gefecht: Familie/Ehepartner: Irmgard von Rott. Irmgard (Tochter von Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) und Uta von Regensburg (III. von Diessen)) gestorben am 14 Jun 1101. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. |  Sieghard VIII. (Sizo) von Chiemgau (Sieghardinger) Sieghard VIII. (Sizo) von Chiemgau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 25. |  Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Poppo I. von Weimar (von Istrien). Poppo (Sohn von Wilhelm II. von Weimar, der Grosse ) wurde geboren in vor 1012; gestorben in 13 Jul cir 1044. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Liutgard von Istrien-Friaul Liutgard von Istrien-Friaul Familie/Ehepartner: Graf Engelbert IV. von Chiemgau (Sieghardinger). Engelbert (Sohn von Engelbert III. von Chiemgau und Adala von Bayern) gestorben in cir 1040. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. |  Graf Sieghard VI. (Sizzo) von Chiemgau (Sieghardiner) Graf Sieghard VI. (Sizzo) von Chiemgau (Sieghardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Tuta (Judith) von Ebersberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Richgard (Sieghardinger) Familie/Ehepartner: Graf Eberhard von Eppenstein. Eberhard (Sohn von Markgraf Markwart III. von Eppenstein und Hadamut (Hadamuod) von Ebersberg) gestorben in nach 1039. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sieghard_VII. Familie/Ehepartner: Pilihild (Bilihild) von Andechs. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Graf Engelbert IV. von Chiemgau (Sieghardinger) Graf Engelbert IV. von Chiemgau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Engelbert IV. Familie/Ehepartner: Liutgard von Istrien-Friaul. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Gräfin Hedwig von Eppenstein Gräfin Hedwig von Eppenstein Notizen: ACHTUNG |
| 32. |  Herzog Heinrich III. von Kärnten (von Eppenstein) Herzog Heinrich III. von Kärnten (von Eppenstein) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Kärnten) Heinrich heiratete Beatrix in cir 1075. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Liutgard in nach 1096. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Sophie von Österreich (Babenberger) in nach 1103. Sophie (Tochter von Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne und Ida (Itha) von Österreich) gestorben am 2 Mai 1154. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Adalbero von Steiermark Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 34. |  Markgraf Ottokar II. von Steiermark Markgraf Ottokar II. von Steiermark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Reformierte Garsten;1082-1122 urkundlich bezeugt. Familie/Ehepartner: Markgräfin Elisabeth von Österreich (Babenberger). Elisabeth (Tochter von Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne und Ida (Itha) von Österreich) gestorben in an einem 10 Okt zw 1107 und 1111. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Haziga (Hadegunde) von Diessen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Haziga_von_Diessen Familie/Ehepartner: Hermann von Kastl. Hermann gestorben am 27 Jan 1056. [Familienblatt] [Familientafel] Haziga heiratete Otto I. von Scheyern (Wittelsbacher) in nach 1050. Otto (Sohn von Graf Otto im Pustertal ?) wurde geboren in cir 1020; gestorben in vor 4 Dez 1078. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Uta von Regensburg (III. von Diessen) Notizen: Kuno war verheiratet mit einer Uta, von der vermutet wird, dass sie die Tochter des Grafen Friedrich II. († 1075) von Dießen-Andechs gewesen sein könnte. ? Familie/Ehepartner: Kuno I. von Rott (Pilgrimiden). Kuno (Sohn von Poppo von Chiemgau und Hazaga von Kärnten) wurde geboren in cir 1015; gestorben in an einem 27 Mär spätestens 1086. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. |  Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._(Istrien-Krain) Ulrich heiratete Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) in zw 1062 und 1063. Sophia (Tochter von König Béla I. von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen) gestorben am 18 Jun 1095. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Begraben: Familie/Ehepartner: Graf Siegfried I. von Spanheim (Sponheim). Siegfried wurde geboren in zw 1010 und 1015 in Burg Sponheim; gestorben am 7 Feb 1065 in Bulgarien; wurde beigesetzt in St. Paul im Lavanttal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Graf Meginhard (Meinhard) von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Graf Meginhard (Meinhard) von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Meinhardiner Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. |  Marquart (Markwart) (Sieghardinger) Marquart (Markwart) (Sieghardinger) Familie/Ehepartner: Adelheid von Horburg-Lechsgemünd. Adelheid gestorben in 1112. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. |  Graf Engelbert V. von Chiemgau (Sieghardinger) Graf Engelbert V. von Chiemgau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Militär / Gefecht: Familie/Ehepartner: Irmgard von Rott. Irmgard (Tochter von Kuno I. von Rott (Pilgrimiden) und Uta von Regensburg (III. von Diessen)) gestorben am 14 Jun 1101. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. |  Sieghard VIII. (Sizo) von Chiemgau (Sieghardinger) Sieghard VIII. (Sizo) von Chiemgau (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 43. |  Friedrich von Eppenstein Friedrich von Eppenstein Familie/Ehepartner: Christina von Andechs. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 44. |  Hadamut von Eppenstein Hadamut von Eppenstein Familie/Ehepartner: Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen). Friedrich (Sohn von Friedrich II. von Diessen) wurde geboren in 1005; gestorben in 1075 in St. Blasien, Waldshut, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | Graf Friedrich von Tengling (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mathilde von Vohburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | Sieghard (Syrus) von Aquileia (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Sieghard von Aquileia (Syrus, Sigehard von Peilstein) († 12. August 1077) aus dem Hause der bayerischen Sieghardinger war 1068 bis 1077 Patriarch von Aquileia. |
| 47. |  Mathilde von Chiemgau (Sieghardinger) Mathilde von Chiemgau (Sieghardinger) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Rapoto IV. von Passau. Rapoto (Sohn von Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen)) gestorben am 15 Okt 1080 in Hohenmölsen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | Leopold I. von Steiermark, der Tapfere, der Starke |
| 49. |  Markgräfin Wilibirg von Steiermark Markgräfin Wilibirg von Steiermark Familie/Ehepartner: Graf Eckbert II. von Formbach von Pütten (Pitten). Eckbert (Sohn von Graf Eckbert I. von Formbach (im Quinziggau) und Markgräfin Mathilde von Lambach (von Pitten)) gestorben in 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | Kunigunde von Steiermark |
| 51. |  Bernhard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Bernhard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_I._von_Scheyern |
| 52. |  Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: Ekkehard I. von Scheyern († vor 11. Mai 1091) war ein Sohn von Otto I. von Scheyern. Seine Mutter kann nicht eindeutig zugeordnet werden, da Otto I. von Scheyern mit Haziga von Sulzbach (Witwe des Grafen Herman von Kastl) und später mit einer unbekannten Tochter des Grafen Meginhardt von Reichersbeuern verheiratet war, von Ekkehard jedoch keine Geburtsdaten bekannt sind. Familie/Ehepartner: Richgard von Weimar-Orlamünde (von Krain). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. |  Irmgard von Rott Irmgard von Rott Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_von_Rott Familie/Ehepartner: Graf Gebhard I. (II.) von Sulzbach. Gebhard (Sohn von Graf Berengar von Sulzbach (im Nordgau) und Adelheid) wurde geboren in 1043; gestorben in 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Engelbert V. von Chiemgau (Sieghardinger). Engelbert (Sohn von Graf Sieghard VI. (Sizzo) von Chiemgau (Sieghardiner) und Tuta (Judith) von Ebersberg) gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Graf Kuno von Horburg-Lechsgemünd. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 54. |  Kuno II. von Rott (Pilgrimiden) Kuno II. von Rott (Pilgrimiden) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Elisabeth von Lothringen. Elisabeth gestorben in 1086. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. |  Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) Markgraf Poppo II. von Istrien (von Weimar) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppo_II._(Istrien) Familie/Ehepartner: Gräfin Richardis (Richarda) von Spanheim. Richardis (Tochter von Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) und Hadwig (Hedwig) von Sachsen) gestorben in cir 1130. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 56. | Richgard von Weimar-Orlamünde (von Krain) Notizen: Richgard und Ekkehard I. hatten drei Söhne, Familie/Ehepartner: Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher). Ekkehard (Sohn von Otto I. von Scheyern (Wittelsbacher) und Haziga (Hadegunde) von Diessen) gestorben in vor 11 Mai 1091. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. |  Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Engelbert I. Familie/Ehepartner: Hadwig (Hedwig) von Sachsen. Hadwig (Tochter von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) wurde geboren in ca 1030/1035; gestorben in an einem 17 Jul ca 1112. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. |  Richilda von Spanheim (Sponheim) Richilda von Spanheim (Sponheim) Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Berchtold von Regensburg. Berchtold (Sohn von Graf Friedrich I. von Regensburg (III. von Diessen) und Tuta von Regensburg) wurde geboren in cir 1042; gestorben in cir 1112. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. |  Hermann von Spanheim (Sponheim) Hermann von Spanheim (Sponheim) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Hermann heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. |  Graf Meinhard I. von Görz (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I._(Görz) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Schwarzenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. |  Graf Engelbert I. von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Graf Engelbert I. von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Engelbert I. |
| 62. | Haziga (Hadegunde) von Diessen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Haziga_von_Diessen Familie/Ehepartner: Hermann von Kastl. Hermann gestorben am 27 Jan 1056. [Familienblatt] [Familientafel] Haziga heiratete Otto I. von Scheyern (Wittelsbacher) in nach 1050. Otto (Sohn von Graf Otto im Pustertal ?) wurde geboren in cir 1020; gestorben in vor 4 Dez 1078. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. | Uta von Regensburg (III. von Diessen) Notizen: Kuno war verheiratet mit einer Uta, von der vermutet wird, dass sie die Tochter des Grafen Friedrich II. († 1075) von Dießen-Andechs gewesen sein könnte. ? Familie/Ehepartner: Kuno I. von Rott (Pilgrimiden). Kuno (Sohn von Poppo von Chiemgau und Hazaga von Kärnten) wurde geboren in cir 1015; gestorben in an einem 27 Mär spätestens 1086. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. |  Graf Sieghard IX. von Tengling (Sieghardinger) Graf Sieghard IX. von Tengling (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Ida von Süpplingenburg (Sachsen). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. |  Pfalzgraf Rapoto V. von Passau (von Bayern) Pfalzgraf Rapoto V. von Passau (von Bayern) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Elisabeth von Lothringen. Elisabeth gestorben in 1086. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 66. |  Ulrich von Passau Ulrich von Passau Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Passau Familie/Ehepartner: Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen). Adelheid (Tochter von Kuno von Frontenhausen) wurde beigesetzt in Kloster Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. | Gräfin Kunigunde (Hedwig) von Pütten Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. |  Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: Otto V. von Scheyern, nach anderer Zählart Otto IV. von Scheyern, (* 1083/1084; † 4. August 1156) stammt aus dem Geschlecht der Grafen von Scheyern, deren Name sich durch die Umsiedlung auf die Burg Wittelsbach in Grafen von Wittelsbach änderte. Er war Sohn von Ekkehardt I. von Scheyern und Richgard von Krain-Orlamünde. Er ist in dem Kloster Ensdorf, das von ihm gegründet wurde, begraben.[1] Familie/Ehepartner: Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe. Heilika (Tochter von Graf Friedrich III. von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe und Helwic von Schwaben ?) wurde geboren in cir 1103; gestorben am 14 Sep 1170 in Lengenfeld; wurde beigesetzt in Kloster Engsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_I._von_Sulzbach Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen). Adelheid (Tochter von Kuno von Frontenhausen) wurde beigesetzt in Kloster Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. |  Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 72. |  Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_(Kärnten) Familie/Ehepartner: Uta von Passau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. | Graf Botho von Schwarzenburg Familie/Ehepartner: Petrissa Ne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. |  Richardis (Richgard) von Spanheim (Sponheim) Richardis (Richgard) von Spanheim (Sponheim) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Richgard von Sponheim oder Richardis Richardis heiratete Rudolf I. von Stade (der Nordmark) (Udonen) in Datum unbekannt. Rudolf (Sohn von Graf Lothar Udo II. von Stade (der Nordmark) (Udonen) und Oda von Werl) gestorben am 7 Dez 1124. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 75. |  Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_II._(Görz) Familie/Ehepartner: Adelheid von Dachau-Valley. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. |  Bernhard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Bernhard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_I._von_Scheyern |
| 77. |  Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Ekkehard I. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: Ekkehard I. von Scheyern († vor 11. Mai 1091) war ein Sohn von Otto I. von Scheyern. Seine Mutter kann nicht eindeutig zugeordnet werden, da Otto I. von Scheyern mit Haziga von Sulzbach (Witwe des Grafen Herman von Kastl) und später mit einer unbekannten Tochter des Grafen Meginhardt von Reichersbeuern verheiratet war, von Ekkehard jedoch keine Geburtsdaten bekannt sind. Familie/Ehepartner: Richgard von Weimar-Orlamünde (von Krain). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. |  Irmgard von Rott Irmgard von Rott Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_von_Rott Familie/Ehepartner: Graf Gebhard I. (II.) von Sulzbach. Gebhard (Sohn von Graf Berengar von Sulzbach (im Nordgau) und Adelheid) wurde geboren in 1043; gestorben in 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Engelbert V. von Chiemgau (Sieghardinger). Engelbert (Sohn von Graf Sieghard VI. (Sizzo) von Chiemgau (Sieghardiner) und Tuta (Judith) von Ebersberg) gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Graf Kuno von Horburg-Lechsgemünd. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 79. |  Kuno II. von Rott (Pilgrimiden) Kuno II. von Rott (Pilgrimiden) Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Elisabeth von Lothringen. Elisabeth gestorben in 1086. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 80. |  Graf Sieghard X. von Tengling (Sieghardinger) Graf Sieghard X. von Tengling (Sieghardinger) Sieghard heiratete Sophie von Österreich (Babenberger) in 1108. Sophie (Tochter von Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne und Ida (Itha) von Österreich) gestorben am 2 Mai 1154. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. |  Uta von Passau Uta von Passau Familie/Ehepartner: Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten). Engelbert (Sohn von Graf Engelbert I. von Spanheim (Sponheim) und Hadwig (Hedwig) von Sachsen) gestorben am 13 Apr 1141 in Kloster Seon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. | Mathilde von Andechs (von Diessen) |
| 83. | Euphemia von Andechs (von Diessen) |
| 84. | Kunigunde von Andechs (von Diessen) |
| 85. |  Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto I. der Rotkopf (* um 1117 wohl in Kelheim; † 11. Juli 1183 in Pfullendorf) aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war der Sohn des Pfalzgrafen Otto V. von Scheyern († 1156) und dessen Frau Heilika von Lengenfeld. Er war 1156 als Otto VI. Pfalzgraf von Bayern und von 1180 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Mit seinem Aufstieg zum Herzog begann die Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern, die erst im Jahre 1918 endete. Otto heiratete Agnes von Loon und Rieneck in 1169 in Kelheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 86. |  Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach Hedwig heiratete Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Bertold (Sohn von Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen) und Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar)) wurde geboren in 1110/1115; gestorben am 14 Dez 1188; wurde beigesetzt in Kloster Diessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. |  Adelheid von Sulzbach Adelheid von Sulzbach Notizen: Adelheid hatte mit Boleslaw I. sechs Kinder, vier Söhne und zwei Töchter. Familie/Ehepartner: Herzog Boleslaw I. von Schlesien (von Polen) (Piasten), der Lange . Boleslaw (Sohn von Władysław von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Vertriebene und Agnes von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in 1127; gestorben am 18 Dez 1201; wurde beigesetzt in Kloster Leubus. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 88. |  Gertrud von Sulzbach Gertrud von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Konrad III. zwei Söhne. Gertrud heiratete König Konrad III. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) in 1135/36. Konrad (Sohn von Herzog Friedrich I. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) und Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen)) wurde geboren in 1093/94; gestorben am 15 Feb 1152 in Bamberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. |  Bertha (Irene) von Sulzbach Bertha (Irene) von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Bertha hatte mit Manuel I. zwei Töchter. Bertha heiratete Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) in 1146. Manuel (Sohn von Johannes II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Piroska (Eirene) von Ungarn) wurde geboren am 28 Nov 1118; gestorben am 24 Sep 1180. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. |  Luitgard von Sulzbach Luitgard von Sulzbach Familie/Ehepartner: Graf Gottfried II. von Löwen. Gottfried (Sohn von Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige und Ida von Chiny) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 13 Jun 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Hugo II. von Dagsburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Mathilde von Sulzbach Mathilde von Sulzbach Familie/Ehepartner: Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) und Uta von Passau) wurde geboren in vor 1124; gestorben am 6 Okz 1173. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 92. |  Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mathilde von Bayern (Welfen). Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) gestorben am 16 Mrz 1183. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. |  Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Andechs) Bertold heiratete Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Hedwig (Tochter von Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) und Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe) gestorben am 16 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Luccardis (Liutgarde) von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 94. | Otto VI. von Andechs (von Diessen) |
| 95. | Familie/Ehepartner: Graf Diepold von Berg-Schelklingen. Diepold (Sohn von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) gestorben in spätestens 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 96. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._von_Schwarzenburg |
| 97. | Notizen: Name: Familie/Ehepartner: aus der Steiermark. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. |  Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien Familie/Ehepartner: Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen). Bertold (Sohn von Arnold von Reichenbeuren (von Diessen) und Gisela von Schwaben) wurde geboren in zw 1096 und 1114; gestorben am 27 Jun 1151. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 99. |  Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._(Kärnten) (Mai 2020) Familie/Ehepartner: Judith von Baden (von Verona). Judith (Tochter von Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) und Judith von Backnang (Hessonen)) gestorben in 1162. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. |  Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten) Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Spanheim) Familie/Ehepartner: Mathilde von Sulzbach. Mathilde (Tochter von Graf Berengar I. (II.) von Sulzbach und Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen)) gestorben in 1165. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 101. |  Ida (Adelheid) von Spanheim (von Kärnten) Ida (Adelheid) von Spanheim (von Kärnten) Familie/Ehepartner: Graf Wilhelm III. von Nevers (Monceaux). Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm II. von Nevers (Monceaux) und Adelheid N.) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 21 Nov 1161; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Germain, Auxerre. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. |  Graf Rapoto I. von Ortenburg Graf Rapoto I. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ortenburg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Sulzbach. Elisabeth (Tochter von Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach und Mathilde von Bayern (Welfen)) gestorben am 23 Jan 1206; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 103. |  Gräfin Mathilde von Spanheim (von Kärnten) Gräfin Mathilde von Spanheim (von Kärnten) Notizen: Mathilde hatte mit Theobald II. elf Kinder. Mathilde heiratete Graf Theobald II. (IV.) (Diebold) von Champagne (Blois) in 1123. Theobald (Sohn von Stephan II. (Heinrich) von Blois und Adela von England (von der Normandie)) wurde geboren in 1093; gestorben am 10 Jan 1152. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. | Elisabeth von Schwarzenburg Notizen: Elisabeth hatte mit Meinhard I. vier Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Meinhard I. von Görz (Meinhardiner). Meinhard (Sohn von Graf Meginhard (Meinhard) von Görz (im Pustertal) (Meinhardiner)) wurde geboren in cir 1070; gestorben in 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 105. |  Liutgard von Stade (Udonen) Liutgard von Stade (Udonen) Liutgard heiratete Friedrich II. von Sommerschenburg in Datum unbekannt, und geschieden in cir 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
Liutgard heiratete König Erik III. von Dänemark in 1144, und geschieden in 1146. Erik (Sohn von Jarl Håkon und Ragnhild) wurde geboren in cir 1100 bis 1105 in Fünen; gestorben am 27 Aug 1146 in Odense. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 106. |  Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Görz) Familie/Ehepartner: Mathilde (Mechthild) von Andechs (von Istrien). Mathilde (Tochter von Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) und Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher)) gestorben in 1245. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 107. |  Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) Notizen: Otto V. von Scheyern, nach anderer Zählart Otto IV. von Scheyern, (* 1083/1084; † 4. August 1156) stammt aus dem Geschlecht der Grafen von Scheyern, deren Name sich durch die Umsiedlung auf die Burg Wittelsbach in Grafen von Wittelsbach änderte. Er war Sohn von Ekkehardt I. von Scheyern und Richgard von Krain-Orlamünde. Er ist in dem Kloster Ensdorf, das von ihm gegründet wurde, begraben.[1] Familie/Ehepartner: Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe. Heilika (Tochter von Graf Friedrich III. von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe und Helwic von Schwaben ?) wurde geboren in cir 1103; gestorben am 14 Sep 1170 in Lengenfeld; wurde beigesetzt in Kloster Engsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 108. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_I._von_Sulzbach Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Megling-Frontenhausen (von Diessen-Wolfratshausen). Adelheid (Tochter von Kuno von Frontenhausen) wurde beigesetzt in Kloster Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. |  Graf Heinrich III. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Graf Heinrich III. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 110. |  Graf Sieghard XI. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Graf Sieghard XI. von Burghausen-Schala (Sieghardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 111. |  Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: Name: Richardis heiratete Graf Otto I. von Geldern in cir 1185. Otto (Sohn von Heinrich I. von Geldern und Agnes von Arnstein) wurde geboren in cir 1150; gestorben in nach 30.4.1207; wurde beigesetzt in Kloster Kamp, Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 112. |  Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Name: Sophia heiratete Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) in 1196. Hermann (Sohn von Landgraf Ludwig II. von Thüringen, der Eiserne und Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen)) wurde geboren in cir 1155; gestorben am 25 Apr 1217 in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 113. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig I. (* 23. Dezember 1173 in Kelheim; † 15. September 1231 ebenda) war Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein. Er gehörte dem Geschlecht der Wittelsbacher an. Den Beinamen der Kelheimer erhielt er, da er in Kelheim einem Attentat zum Opfer fiel. Ludwig heiratete Herzogin Ludmilla von Böhmen in 1204. Ludmilla (Tochter von Bedřich (Friedrich) von Böhmen (Přemysliden) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren in cir 1170; gestorben am 4 Aug 1240 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 114. |  Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bayerisches_Wappen Familie/Ehepartner: Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg. Rapoto (Sohn von Graf Rapoto I. von Ortenburg und Elisabeth von Sulzbach) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 115. |  Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_IV._(Andechs) Berthold heiratete Agnes von Rochlitz in 1180. Agnes (Tochter von Dedo III. von Wettin (von Lausitz), der Feiste und Mathilde (Mechthilde) von Heinsberg) wurde geboren in 1152; gestorben am 25 Mrz 1195 in Dießen am Ammersee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 116. | Notizen: Name: Sophia heiratete Graf Poppo VI. von Henneberg in vor 1182. Poppo (Sohn von Burggraf Bertold I. von Henneberg und Bertha von Putelendorf (von Goseck)) wurde geboren in vor 1160; gestorben in Jun/Sep 1190 in Margat (Marqab). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 117. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Eberhard III. von Eberstein. Eberhard (Sohn von Berthold IV. von Eberstein und Uta von Lauffen) wurde geboren in Grafschaft Eberstein; gestorben in zw 1218 und 1219. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 118. | Notizen: Mathilde hatte mit Engelbert III. vermutlich zwei Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) und Adelheid von Dachau-Valley) wurde geboren in ca 1164/1172; gestorben am 5 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. |  Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Polen) Heinrich heiratete Hedwig von Andechs in 1186. Hedwig (Tochter von Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) und Agnes von Rochlitz) wurde geboren in 1174 in Andechs; gestorben am 15 Okt 1243 in Trebnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 120. |  Friedrich IV. von Schwaben Friedrich IV. von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_IV._(Schwaben) Friedrich heiratete Königin Gertrud von Bayern (von Sachsen) in 1166. Gertrud (Tochter von Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe und Clementina von Zähringen) wurde geboren in cir 1154; gestorben am 1 Jul 1197; wurde beigesetzt in Marienkirche Vä, Schonen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 121. |  Maria Komnena (Byzanz, Komnenen, Montferrat) Maria Komnena (Byzanz, Komnenen, Montferrat) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Komnene_(Montferrat) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Rainer von Montferrat (Aleramiden). Rainer (Sohn von Markgraf Wilhelm V. von Montferrat (Aleramiden) und Judith von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in cir 1162; gestorben in 1183. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden). Béla (Sohn von König Géza II von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Euphrosina Mstislawna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in cir 1148; gestorben am 24 Apr 1196. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 122. |  Gottfried III. von Löwen Gottfried III. von Löwen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_III._(Löwen) Familie/Ehepartner: Margarete von Limburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 123. |  Luitgard von Dagsburg und Moha Luitgard von Dagsburg und Moha Familie/Ehepartner: Graf Dietrich (Theodericus) von Ahr und Hochstaden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 124. |  Graf Berengar II. von Sulzbach Graf Berengar II. von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 125. | Nicht klar ? Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich III. (V) von Kleve und Margarethe von Holland) wurde geboren in cir 1185; gestorben in 13 Mai oder 26 Jun 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 126. |  Sophie von Sulzbach Sophie von Sulzbach Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Gerhard I. von Grögling. Gerhard gestorben in 1170. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 127. |  Elisabeth von Sulzbach Elisabeth von Sulzbach Notizen: Begraben: Familie/Ehepartner: Graf Rapoto I. von Ortenburg. Rapoto (Sohn von Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) und Uta von Passau) gestorben in 1186; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 128. |  Bertha von Sulzbach Bertha von Sulzbach Familie/Ehepartner: Heinrich II. von Altendorf. Heinrich gestorben in 1194. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 129. |  Graf Ulrich von Berg Graf Ulrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berg_(Ehingen) Familie/Ehepartner: Adelheid (Udelhild) von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 130. |  Bischof Heinrich von Berg Bischof Heinrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Berg |
| 131. |  Bischof Diepold von Berg Bischof Diepold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_von_Berg |
| 132. |  Bischof Manegold von Berg Bischof Manegold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manegold_von_Berg |
| 133. |  Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Berg |
| 134. | Notizen: Name: |
| 135. |
| 136. |
| 137. | Notizen: Name: Irmgard? heiratete Adolf II. von Berg in spätestens 1131. Adolf (Sohn von Graf Adolf I. von Berg und Adelheid von Lauffen) wurde geboren in 1090er; gestorben in 12 Okt 1160 bis 1170 in Burg Berge, Altenberg, Odenthal; wurde beigesetzt in Abtei Altenberg, Odenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 138. |  Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Andechs) Bertold heiratete Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Hedwig (Tochter von Otto V. von Scheyern (Wittelsbacher) und Heilika von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe) gestorben am 16 Jul 1174. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Luccardis (Liutgarde) von Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 139. | Otto VI. von Andechs (von Diessen) |
| 140. | Familie/Ehepartner: Graf Diepold von Berg-Schelklingen. Diepold (Sohn von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)) gestorben in spätestens 1166. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 141. |  Herzog Hermann II. von Kärnten Herzog Hermann II. von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_(Kärnten) (Apr 2018) Hermann heiratete Herzogin Agnes von Österreich (Babenberger) in 1173. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich II. von Österreich, Jasomirgott und Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in 1151; gestorben am 13 Jan 1182; wurde beigesetzt in Krypta der Wiener Schottenkirche. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 142. |  Graf Guido von Nevers (Monceaux) Graf Guido von Nevers (Monceaux) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_von_Nevers Guido heiratete Mathilde von Burgund in cir 1168. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 143. |  Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mathilde von Bayern (Wittelsbacher). Mathilde (Tochter von Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf und Agnes von Loon und Rieneck) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Kastel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 144. |  Graf Heinrich I. von Ortenburg Graf Heinrich I. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Bogislawa (Božislava) von Böhmen (Přemysliden). Bogislawa (Tochter von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Adelheid von Meissen) gestorben in cir 1223. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgräfin Richgard von Hohenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 145. |  Graf Heinrich I. von Champagne (Blois) Graf Heinrich I. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Champagne) Heinrich heiratete Prinzessin Marie von Frankreich (Kapetinger) in 1164. Marie (Tochter von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin Eleonore von Aquitanien) wurde geboren in 1145; gestorben am 11 Mrz 1198. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 146. |  Marie von Champagne (Blois) Marie von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Marie und Odo II. hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Marie heiratete Herzog Odo II. von Burgund in 1145. Odo (Sohn von Herzog Hugo II. von Burgund und Mathilde de Mayenne) wurde geboren in cir 1118; gestorben am 27 Sep 1162. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 147. |  Graf Theobald V. von Champagne (Blois) Graf Theobald V. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_V._(Blois) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Sibylle von Château-Renault. [Familienblatt] [Familientafel] Theobald heiratete Prinzessin Alix von Frankreich (Kapetinger) in 1164. Alix (Tochter von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin Eleonore von Aquitanien) wurde geboren in 1150; gestorben in 1197/1198. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 148. |  Isabelle (Elisabeth) von Champagne (Blois) Isabelle (Elisabeth) von Champagne (Blois) Notizen: Geburt: Isabelle heiratete Herzog Roger III. von Apulien (Hauteville) in 1139/1140/1143. Roger (Sohn von König Roger II. von Sizilien (Hauteville) und Königin Elvira Alfónsez (von León)) wurde geboren in 1118; gestorben am 2 Mai 1149. [Familienblatt] [Familientafel] Isabelle heiratete Guillaume IV. Gouët in vor 1155. Guillaume (Sohn von Herr Guillaume III. Gouët und Mabile (Mabel, Eustachia, Richilde) von England) wurde geboren in cir 1125; gestorben in 1168/1171. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 149. |  Mathilde von Champagne (Blois) Mathilde von Champagne (Blois) Mathilde heiratete Graf Rotrou IV. von Le Perche in Datum unbekannt. Rotrou (Sohn von Rotrou III. von Le Perche und Hedwig (Havise) von Salisbury (von Évreux)) gestorben am 27 Jul 1191. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 150. |  Herrin von Ligny Agnes von Champagne (Blois) Herrin von Ligny Agnes von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Agnes heiratete Graf Rainald II. von Bar, (von Mousson) (Scarponnois), der Junge in zw 1155 und 1158. Rainald (Sohn von Graf Rainald I. von Bar, (von Mousson) (Scarponnois), der Einäugige und Gräfin Gisela von Vaudémont (von Lothringen)) wurde geboren in 1115; gestorben am 25 Jul 1170; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Mihiel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 151. |  Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois) Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adela_von_Champagne Adela heiratete König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere am 13 Nov 1160 in Kathedrale Notre-Dame, Paris. Ludwig (Sohn von König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke und Königin Adelheid von Maurienne (Savoyen)) wurde geboren in 1120; gestorben am 18 Sep 1180 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 152. |  Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_II._(Görz) Familie/Ehepartner: Adelheid von Dachau-Valley. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 153. | Äbtissin Adelheid von Sommerschenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Adelheid IV., geboren als Adelheid von Sommerschenburg (* um 1130; † 1. Mai 1184 in Quedlinburg) war von 1152/53 an Äbtissin von Gandersheim und ab 1160/61 zusätzlich als Adelheid III. Äbtissin des Damenstifts in Quedlinburg. |
| 154. |  Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I. Meinhard heiratete Adelheid von Tirol in vor 9 Sep 1237. Adelheid (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) gestorben in Okt/Nov 1278. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 155. |  Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto I. der Rotkopf (* um 1117 wohl in Kelheim; † 11. Juli 1183 in Pfullendorf) aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war der Sohn des Pfalzgrafen Otto V. von Scheyern († 1156) und dessen Frau Heilika von Lengenfeld. Er war 1156 als Otto VI. Pfalzgraf von Bayern und von 1180 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Mit seinem Aufstieg zum Herzog begann die Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern, die erst im Jahre 1918 endete. Otto heiratete Agnes von Loon und Rieneck in 1169 in Kelheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 156. |  Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach Hedwig heiratete Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) in vor 1153, und geschieden in cir 1180. Bertold (Sohn von Graf Bertold I. (II.) von Andechs (von Diessen) und Markgräfin Sophie von Istrien (von Weimar)) wurde geboren in 1110/1115; gestorben am 14 Dez 1188; wurde beigesetzt in Kloster Diessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 157. |  Adelheid von Sulzbach Adelheid von Sulzbach Notizen: Adelheid hatte mit Boleslaw I. sechs Kinder, vier Söhne und zwei Töchter. Familie/Ehepartner: Herzog Boleslaw I. von Schlesien (von Polen) (Piasten), der Lange . Boleslaw (Sohn von Władysław von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Vertriebene und Agnes von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in 1127; gestorben am 18 Dez 1201; wurde beigesetzt in Kloster Leubus. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 158. |  Gertrud von Sulzbach Gertrud von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Konrad III. zwei Söhne. Gertrud heiratete König Konrad III. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) in 1135/36. Konrad (Sohn von Herzog Friedrich I. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) und Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen)) wurde geboren in 1093/94; gestorben am 15 Feb 1152 in Bamberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 159. |  Bertha (Irene) von Sulzbach Bertha (Irene) von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Bertha hatte mit Manuel I. zwei Töchter. Bertha heiratete Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) in 1146. Manuel (Sohn von Johannes II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) und Piroska (Eirene) von Ungarn) wurde geboren am 28 Nov 1118; gestorben am 24 Sep 1180. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 160. |  Luitgard von Sulzbach Luitgard von Sulzbach Familie/Ehepartner: Graf Gottfried II. von Löwen. Gottfried (Sohn von Gottfried VI. von Löwen (von Niederlothringen), der Bärtige und Ida von Chiny) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 13 Jun 1142. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Hugo II. von Dagsburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 161. |  Mathilde von Sulzbach Mathilde von Sulzbach Familie/Ehepartner: Engelbert III. von Spanheim (von Kärnten). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) und Uta von Passau) wurde geboren in vor 1124; gestorben am 6 Okz 1173. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 162. |  Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach Graf Gebhard II. (III.) von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mathilde von Bayern (Welfen). Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) gestorben am 16 Mrz 1183. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 163. |  Graf Gerhard IV von Geldern Graf Gerhard IV von Geldern Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gerhard IV. von Geldern (* um 1185; † 22. Oktober 1229) war von 1207 bis zu seinem Tod Graf von Geldern. Gerhard heiratete Margareta von Brabant in 1206 in Löwen, Brabant. Margareta (Tochter von Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) und Mathilda von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in 1192; gestorben in 1231. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 164. |  Adelheid von Geldern Adelheid von Geldern Adelheid heiratete Graf Wilhelm I. von Holland (Gerulfinger) in 1197. Wilhelm (Sohn von Florens III. von Holland (Gerulfinger) und Adelheid (Ada) von Huntingdon (von Schottland)) wurde geboren in cir 1170; gestorben am 4 Feb 1222. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 165. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Thüringen) Ludwig heiratete Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) in 1221. Elisabeth (Tochter von König Andreas II. von Ungarn (Árpáden) und Gertrud von Andechs) wurde geboren am 7 Jul 1207 in Pressburg; gestorben am 17 Nov 1231 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 166. |  Agnes von Thüringen (Ludowinger) Agnes von Thüringen (Ludowinger) Notizen: Name: Agnes heiratete Herzog Heinrich von Österreich (Babenberger) am 29 Nov 1225 in Nürnberg, Bayern, DE. Heinrich (Sohn von Herzog Leopold VI. von Österreich (Babenberger, der Glorreiche und Theodora Angela von Byzanz) wurde geboren in 1208; gestorben am 29 Nov 1227/1228. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) in 1238. Albrecht (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in cir 1175; gestorben am 7 Okt 1260; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 167. |  Irmgard von Thüringen (Ludowinger) Irmgard von Thüringen (Ludowinger) Irmgard heiratete Fürst Heinrich I. von Anhalt (Askanier) in 1211. Heinrich (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in 1170; gestorben in 1252. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 168. |  Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto II. der Erlauchte (* 7. April 1206 in Kelheim; † 29. November 1253 in Landshut) aus dem Geschlecht der Wittelsbacher war von 1231 bis 1253 Herzog von Bayern und von 1214 bis 1253 Pfalzgraf bei Rhein. Familie/Ehepartner: Agnes von Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 169. |  Pfalzgraf Rapoto III. von Ortenburg in Kreiburg Pfalzgraf Rapoto III. von Ortenburg in Kreiburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Adelheid von Zollern. Adelheid (Tochter von Burggraf Konrad I. von Nürnberg (Hohenzollern), der Fromme und Adelheid von Frontenhausen) gestorben am 19 Okt 1304. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 170. |  Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) Herzog Otto VII. von Meranien (von Andechs) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_VII._(Meranien) Otto heiratete Beatrix II. von Burgund (Staufern) in 1208. Beatrix (Tochter von Pfalzgraf Otto I. von Burgund (Schwaben, Staufer) und Gräfin Margarete von Blois) wurde geboren in cir 1193; gestorben am 7 Mai 1231; wurde beigesetzt in Kloster Langheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 171. |  Gertrud von Andechs Gertrud von Andechs Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gertrud hatte mit Andreas II. fünf Kinder. Familie/Ehepartner: König Andreas II. von Ungarn (Árpáden). Andreas (Sohn von König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Agnès von Châtillon) wurde geboren in cir 1177; gestorben in 1235 in Ofen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 172. |  Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes hatte mit Phillip August drei Kinder. Agnes-Maria heiratete König Philipp II. August von Frankreich (Kapetinger) in 1196. Philipp (Sohn von König Ludwig VII. von Frankreich (Kapetinger), der Jüngere und Königin von Frankreich Adela (Alix) von Champagne (Blois)) wurde geboren am 21 Aug 1165 in Gonesse; gestorben am 14 Jul 1223 in Mantes-la-Jolie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 173. |  Hedwig von Andechs Hedwig von Andechs Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Sie wird in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt. Im römischen Generalkalender ist ihr Gedenktag am 16. Oktober, im evangelischen Namenkalender am 15. Oktober. Hedwig heiratete Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige in 1186. Heinrich (Sohn von Herzog Boleslaw I. von Schlesien (von Polen) (Piasten), der Lange und Adelheid von Sulzbach) wurde geboren in cir 1165 in Glogau; gestorben am 19 Mrz 1238 in Crossen an der Oder; wurde beigesetzt in vor dem Hauptaltar der Klosterkirche von Trebnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 174. |  Burggraf Berthold II. von Würzburg (von Henneberg) Burggraf Berthold II. von Würzburg (von Henneberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Kunigunde von Abensberg. [Familienblatt] [Familientafel]
Berthold heiratete Mechthild von Esvelt am 24 Apr 1190. Mechthild gestorben am 22/28 Sep 1246. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 175. |  Graf Poppo VII. von Henneberg Graf Poppo VII. von Henneberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Henneberg_(Adelsgeschlecht) Poppo heiratete Elisabeth von Wildberg in 1217. Elisabeth wurde geboren in 1187 in Burg Wildberg, Sulzfeld; gestorben am 15 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
Poppo heiratete Jutta von Thüringen (Ludowinger) am 3 Jan 1223 in Leipzig, DE. Jutta (Tochter von Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) und Sophia von Sommerschenburg) wurde geboren in 1184; gestorben am 6 Aug 1235 in Schleusingen, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 176. |  Otto I. von Henneberg-Botenlauben Otto I. von Henneberg-Botenlauben Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Besitz: Otto heiratete Beatrix von Courtenay in vor 1 Okt 1208. Beatrix (Tochter von Baron Joscelin III. von Courtenay (von Edessa) und Agnes von Milly) wurde geboren in 1176?; gestorben in nach 7 Feb 1245; wurde beigesetzt in Kloster Frauenroth. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 177. |  Heinrich II. von Henneberg Heinrich II. von Henneberg |
| 178. |  Adelheid von Henneberg Adelheid von Henneberg Adelheid heiratete Herzog Heinrich III. von Limburg in vor 1189. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich II. von Limburg und Mathilde von Saffenberg) wurde geboren in cir 1140; gestorben am 21 Jul 1221 in Klosterrath. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 179. |  Elisabeth von Henneberg Elisabeth von Henneberg |
| 180. |  Kunigunde von Henneberg Kunigunde von Henneberg |
| 181. |  Margarethe von Henneberg Margarethe von Henneberg |
| 182. |  Gräfin Gertrud von Eberstein ? Gräfin Gertrud von Eberstein ? Notizen: Es ist nicht verbürgt, dass Gertrud eine von Eberstein ist. Familie/Ehepartner: Graf Ulrich III. von Neuenburg. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Neuenburg und Baronin Berta (Berthe) von Grenchen (de Granges)) wurde geboren in cir 1175; gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 183. |  Bischof Konrad von Eberstein Bischof Konrad von Eberstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Eberstein |
| 184. |  Graf Eberhard IV. von Eberstein Graf Eberhard IV. von Eberstein Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_IV._von_Eberstein Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Sayn. Adelheid (Tochter von Graf Heinrich II. von Sayn und Agnes von Saffenberg) gestorben in 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 185. |  Otto I. von Eberstein Otto I. von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Kunigunde von Urach. Kunigunde (Tochter von Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) und Adelheid von Neuffen) gestorben in vor 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Beatrix von Crutheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 186. |  Agnes von Eberstein Agnes von Eberstein Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken). Friedrich (Sohn von Graf Simon II. von Saarbrücken und Liutgard (Lucarde) von Leiningen) gestorben in 1237. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Diether V von Katzenelnbogen. Diether (Sohn von Graf Diether IV. von Katzenelnbogen und Hildegunde) gestorben am 13 Jan 1276. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 187. |  Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard I. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_I. Meinhard heiratete Adelheid von Tirol in vor 9 Sep 1237. Adelheid (Tochter von Graf Albert III. von Tirol und Uta von Frontenhausen-Lechsgemünd) gestorben in Okt/Nov 1278. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 188. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Polen) Heinrich heiratete Herzogin Anna von Böhmen in 1217. Anna (Tochter von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Konstanze von Ungarn) wurde geboren in 1201/1204; gestorben am 26 Aug 1265. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 189. | 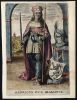 Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Brabant) Heinrich heiratete Mathilda von Elsass (von Flandern) in 1179. Mathilda (Tochter von Graf Matthäus von Elsass (von Flandern) und Gräfin Maria von Boulogne (von Blois)) wurde geboren in 1170; gestorben am 16 Okt 1210. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Prinzessin Maria von Frankreich in 1213. Maria wurde geboren in 1198; gestorben in 1224. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 190. |  Graf Lothar von Ahr (Are) und Hochstaden (Hostaden) Graf Lothar von Ahr (Are) und Hochstaden (Hostaden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Are Familie/Ehepartner: Mechtild (Mathilde) von Vianden. Mechtild (Tochter von Graf Friedrich III. von Vianden und Mechtild (Mathilde) von (der Neuerburg?)) gestorben in 1253. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 191. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_primogenitus_(Kleve) Dietrich heiratete Elisabeth von Brabant in 1233. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 192. | Notizen: Geburt: Margarete heiratete Graf Otto II von Geldern, der Lahme in Datum unbekannt. Otto (Sohn von Graf Gerhard IV von Geldern und Margareta von Brabant) wurde geboren in cir 1215; gestorben am 10 Jan 1271; wurde beigesetzt in Kloster Graefenthal, Goch-Asperden, Holland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 193. |  Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Mathilde von Bayern (Wittelsbacher). Mathilde (Tochter von Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf und Agnes von Loon und Rieneck) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Kastel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 194. |  Graf Heinrich I. von Ortenburg Graf Heinrich I. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Bogislawa (Božislava) von Böhmen (Přemysliden). Bogislawa (Tochter von König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) und Adelheid von Meissen) gestorben in cir 1223. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgräfin Richgard von Hohenburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 195. |  Graf Diepold von Kersch (von Berg) Graf Diepold von Kersch (von Berg) Notizen: Geburt: Diepold heiratete Wilipirg von Aichelberg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 196. |  Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Württemberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 197. |  Graf Eberhard I. von Berg-Altena Graf Eberhard I. von Berg-Altena Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Eberhard I. von Berg-Altena (* um 1130; † 23. Januar 1180) war Graf von Altena von 1161 bis 1180. Familie/Ehepartner: Adelheid von Cuyk-Arnsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 198. |  Graf Engelbert I. von Berg Graf Engelbert I. von Berg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I._(Berg) Engelbert heiratete Margaretha von Geldern in Spätestens 1175. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 199. |  Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_IV._(Andechs) Berthold heiratete Agnes von Rochlitz in 1180. Agnes (Tochter von Dedo III. von Wettin (von Lausitz), der Feiste und Mathilde (Mechthilde) von Heinsberg) wurde geboren in 1152; gestorben am 25 Mrz 1195 in Dießen am Ammersee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 200. | Notizen: Name: Sophia heiratete Graf Poppo VI. von Henneberg in vor 1182. Poppo (Sohn von Burggraf Bertold I. von Henneberg und Bertha von Putelendorf (von Goseck)) wurde geboren in vor 1160; gestorben in Jun/Sep 1190 in Margat (Marqab). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 201. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Eberhard III. von Eberstein. Eberhard (Sohn von Berthold IV. von Eberstein und Uta von Lauffen) wurde geboren in Grafschaft Eberstein; gestorben in zw 1218 und 1219. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 202. | Notizen: Mathilde hatte mit Engelbert III. vermutlich zwei Kinder. Familie/Ehepartner: Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner). Engelbert (Sohn von Engelbert II. von Görz (Meinhardiner) und Adelheid von Dachau-Valley) wurde geboren in ca 1164/1172; gestorben am 5 Sep 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 203. |  Graf Ulrich von Berg Graf Ulrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berg_(Ehingen) Familie/Ehepartner: Adelheid (Udelhild) von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 204. |  Bischof Heinrich von Berg Bischof Heinrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Berg |
| 205. |  Bischof Diepold von Berg Bischof Diepold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_von_Berg |
| 206. |  Bischof Manegold von Berg Bischof Manegold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manegold_von_Berg |
| 207. |  Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Berg |
| 208. |  Gräfin Agnes I. von Nevers Gräfin Agnes I. von Nevers Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes I. hatte mit Peter II. eine Tochter. Agnes heiratete Kaiser Peter II. von Courtenay (Kapetinger) in 1184. Peter (Sohn von Peter I. von Frankreich (Courtenay, Kapetinger) und Herrin Elisabeth von Courtenay) wurde geboren in cir 1155; gestorben in 1217/19. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 209. |  Anna (Agnes, Cordula) von Ortenburg Anna (Agnes, Cordula) von Ortenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ortenburg_(Adelsgeschlecht) Familie/Ehepartner: Friedrich von Truhendingen. Friedrich (Sohn von Friedrich von Truhendingen) gestorben in 1246/51. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 210. |  Graf Rapoto IV. von Ortenburg Graf Rapoto IV. von Ortenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rapoto_IV._(Ortenburg) Familie/Ehepartner: Kunigunde von Bruckberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 211. |  Graf Heinrich II. von Champagne (Blois) Graf Heinrich II. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Champagne) (Sep 2023) Heinrich heiratete Königin Isabella I. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) am 6 Mai 1192. Isabella (Tochter von Amalrich I. von Anjou-Château-Landon (Jerusalem) und Königin Maria von Jerusalem (Komnenen)) wurde geboren in 1170; gestorben in 1205/1208. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 212. |  Graf Theobald III. von Champagne (Blois) Graf Theobald III. von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_III._(Champagne) (Okt 2017) Theobald heiratete Gräfin Blanka von Navarra in 1195 in Chartres. Blanka (Tochter von König Sancho VI. von Navarra, der Weise und Sancha von Kastilien) gestorben in 1229. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 213. |  Kaiserin Marie von Champagne (Blois) Kaiserin Marie von Champagne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_von_Champagne_(Kaiserin) Marie heiratete Kaiser Balduin I. von Konstantinopel (von Hennegau) am 6 Jan 1186. Balduin (Sohn von Balduin V. von Hennegau und Gräfin Margarete I. von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in Jul 1171 in Valenciennes, Frankreich; gestorben in nach 20.7.1205 in Tarnowo, Bulgarien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 214. |  Alix (Adelheid) von Burgund Alix (Adelheid) von Burgund Familie/Ehepartner: Archambault (VIII.) von Bourbon. Archambault (Sohn von Herr Archambault VII. von Bourbon und Agnes von Savoyen) wurde geboren am 29 Jun 1140; gestorben am 26 Jul 1169. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 215. |  Herzog Hugo III. von Burgund Herzog Hugo III. von Burgund Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_III._(Burgund) Hugo heiratete Alix von Lothringen in 1165. Alix (Tochter von Herzog Matthäus I. von Lothringen und Bertha von Schwaben) wurde geboren in 1165; gestorben in 1200. [Familienblatt] [Familientafel]
Hugo heiratete Gräfin Béatrice (Beatrix) von Albon in 1184. Béatrice (Tochter von Graf Guigues V. von Albon und Beatrice von Montferrat) wurde geboren in 1161; gestorben am 16 Dez 1228 in Château féodal de Vizille. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 216. |  Gräfin Margarete von Blois Gräfin Margarete von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Margarete hatte mit Otto I. zwei Kinder. Margarete heiratete Hugues III. d’Oisy in cir 1183. Hugues gestorben in Aug 1189. [Familienblatt] [Familientafel] Margarete heiratete Pfalzgraf Otto I. von Burgund (Schwaben, Staufer) in cir 1190. Otto (Sohn von Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) von Schwaben (von Staufen) und Kaiserin Beatrix von Burgund) wurde geboren in Jun/Jul 1170; gestorben am 13 Jan 1200 in Besançon, FR. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarete heiratete Walter II. von Avesnes in ca 1202/1203. Walter (Sohn von Herr Jakob von Avesnes und Adela von Guise) wurde geboren in cir 1170; gestorben in 1245/1246. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 217. |  Graf Ludwig von Blois Graf Ludwig von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Ludwig heiratete Gräfin Katharina von Clermont-en-Beauvaisis in 1184. Katharina (Tochter von Graf Rudolf I. (Raoul) von Clermont-en-Beauvaisis, der Rote und Alice (Adele) Le Puiset (von Breteul)) wurde geboren in vor 1178; gestorben am 19/20 Sep 1212/1213. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 218. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Geburt: Mathilde heiratete Hervé III. von Donzy (Semur) in Datum unbekannt. Hervé (Sohn von Herr Geoffroy III. von Donzy (Semur)) gestorben in 1187. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 219. |  Graf Gottfried (Geoffrey) III. von Le Perche Graf Gottfried (Geoffrey) III. von Le Perche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_III._(Perche) Gottfried heiratete Mathilde (Mahaut) Richenza von Sachsen in Datum unbekannt. Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe und Mathilde von England (Plantagenêt)) gestorben in vor 1210. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 220. |  Graf Theobald I. von Bar-Scarponnois Graf Theobald I. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_I._(Bar) (Dez 2018) Theobald heiratete Lauretta von Loon und Rieneck in 1176. Lauretta (Tochter von Graf Ludwig I. von Loon und Rieneck und Agnes von Metz) gestorben in 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
Theobald heiratete Ermesinde von Brienne in 1189. Ermesinde (Tochter von Graf Guido von Brienne und Elisabeth de Chacenay) gestorben in 1211. [Familienblatt] [Familientafel]
Theobald heiratete Gräfin Ermesinde II. von Luxemburg in 1197. Ermesinde (Tochter von Graf Heinrich IV. von Luxemburg (von Namur), der Blinde und Agnes von Geldern) wurde geboren in Jul 1186; gestorben am 12 Feb 1247; wurde beigesetzt in Abtei Clairefontaine bei Arlon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 221. |  Graf Heinrich I. von Bar (von Mousson) (Scarponnois) Graf Heinrich I. von Bar (von Mousson) (Scarponnois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Bar) (Dez 2018) |
| 222. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_II._(Frankreich) (Feb 2022) Philipp heiratete Königin Isabella von Hennegau am 28 Apr 1180 in Abtei Sainte Trinité zu Bapaume. Isabella (Tochter von Balduin V. von Hennegau und Gräfin Margarete I. von Elsass (von Flandern)) wurde geboren in ? 23 Apr 1170 in Lille; gestorben am 15 Mrz 1190 in Paris, France; wurde beigesetzt in Notre Dame de Paris. [Familienblatt] [Familientafel]
Philipp heiratete Prinzessin Ingeborg von Dänemark am 15 Aug 1193 in Kathedrale, Amiens, Frankreich. Ingeborg (Tochter von König Waldemar I. von Dänemark, der Grosse und Königin Sophia von Dänemark (von Minsk)) wurde geboren in cir 1175; gestorben am 29 Jul 1236 in Corbeil; wurde beigesetzt in Saint-Jean-sur-l’Isle bei Corbeil. [Familienblatt] [Familientafel] Philipp heiratete Agnes-Maria von Andechs (von Meranien) in 1196. Agnes-Maria (Tochter von Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) und Agnes von Rochlitz) wurde geboren in cir 1172; gestorben in 18 oder 19 Jul 1201 in Poissy, FR; wurde beigesetzt in Benediktinerkloster St. Corentin-lès-Mantes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 223. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alix_von_Frankreich,_Gräfin_von_Vexin Alix heiratete Graf Wilhelm IV. von Ponthieu (Talvas) (von Montgommery) am 20 Aug 1195. Wilhelm (Sohn von Graf Johann I. von Ponthieu und Beatrix von Saint-Pol (Haus Candavène)) wurde geboren in 1179; gestorben am 4 Okt 1221. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 224. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Frankreich_(1171–1240) (Okt 2017) Agnes heiratete Kaiser Alexios II. Komnenos (Byzanz, Komnenen) am 2 Mrz 1180. Alexios (Sohn von Kaiser Manuel I. Komnenos (Byzanz, Trapezunt) und Maria (Xene) von Antiochia (Poitiers)) wurde geboren am 10 Sep 1169; gestorben in Okt 1183. [Familienblatt] [Familientafel] Agnes heiratete Andronikos I. Komnenos (Byzanz, Komnenen) in 1183. Andronikos (Sohn von Isaak Komnenos (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in cir 1122; gestorben am 12 Sep 1185 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Theodoros Branas. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 225. |  Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Graf Engelbert III. von Görz (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_III._(Görz) Familie/Ehepartner: Mathilde (Mechthild) von Andechs (von Istrien). Mathilde (Tochter von Markgraf Bertold II. (III.) von Andechs (von Diessen) und Hedwig von Dachau-Wittelsbach (Wittelsbacher)) gestorben in 1245. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 226. |  Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Graf Meinhard II. von Kärnten (Meinhardiner) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Meinhard_II. (Okt 2017) Meinhard heiratete Elisabeth von Bayern (Wittelsbacher) in 1258 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren in cir 1227 in Burg Trausnitz in Landshut; gestorben am 9 Okt 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 227. |  Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher) Notizen: Name: Richardis heiratete Graf Otto I. von Geldern in cir 1185. Otto (Sohn von Heinrich I. von Geldern und Agnes von Arnstein) wurde geboren in cir 1150; gestorben in nach 30.4.1207; wurde beigesetzt in Kloster Kamp, Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 228. |  Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Sophia von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Name: Sophia heiratete Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) in 1196. Hermann (Sohn von Landgraf Ludwig II. von Thüringen, der Eiserne und Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen)) wurde geboren in cir 1155; gestorben am 25 Apr 1217 in Gotha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 229. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Ludwig I. (* 23. Dezember 1173 in Kelheim; † 15. September 1231 ebenda) war Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein. Er gehörte dem Geschlecht der Wittelsbacher an. Den Beinamen der Kelheimer erhielt er, da er in Kelheim einem Attentat zum Opfer fiel. Ludwig heiratete Herzogin Ludmilla von Böhmen in 1204. Ludmilla (Tochter von Bedřich (Friedrich) von Böhmen (Přemysliden) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren in cir 1170; gestorben am 4 Aug 1240 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 230. |  Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Mathilde von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bayerisches_Wappen Familie/Ehepartner: Rapoto II. von Ortenburg und Kreiburg. Rapoto (Sohn von Graf Rapoto I. von Ortenburg und Elisabeth von Sulzbach) gestorben in 1231; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 231. |  Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige Herzog Heinrich I. von Polen (von Schlesien) (Piasten), der Bärtige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Polen) Heinrich heiratete Hedwig von Andechs in 1186. Hedwig (Tochter von Graf Berthold III. (IV.) von Andechs (von Diessen) und Agnes von Rochlitz) wurde geboren in 1174 in Andechs; gestorben am 15 Okt 1243 in Trebnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 232. |  Friedrich IV. von Schwaben Friedrich IV. von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_IV._(Schwaben) Friedrich heiratete Königin Gertrud von Bayern (von Sachsen) in 1166. Gertrud (Tochter von Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe und Clementina von Zähringen) wurde geboren in cir 1154; gestorben am 1 Jul 1197; wurde beigesetzt in Marienkirche Vä, Schonen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 233. |  Maria Komnena (Byzanz, Komnenen, Montferrat) Maria Komnena (Byzanz, Komnenen, Montferrat) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Komnene_(Montferrat) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Rainer von Montferrat (Aleramiden). Rainer (Sohn von Markgraf Wilhelm V. von Montferrat (Aleramiden) und Judith von Österreich (Babenberger)) wurde geboren in cir 1162; gestorben in 1183. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden). Béla (Sohn von König Géza II von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Euphrosina Mstislawna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in cir 1148; gestorben am 24 Apr 1196. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 234. |  Gottfried III. von Löwen Gottfried III. von Löwen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_III._(Löwen) Familie/Ehepartner: Margarete von Limburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 235. |  Luitgard von Dagsburg und Moha Luitgard von Dagsburg und Moha Familie/Ehepartner: Graf Dietrich (Theodericus) von Ahr und Hochstaden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 236. |  Graf Berengar II. von Sulzbach Graf Berengar II. von Sulzbach Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 237. | Nicht klar ? Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich III. (V) von Kleve und Margarethe von Holland) wurde geboren in cir 1185; gestorben in 13 Mai oder 26 Jun 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 238. |  Sophie von Sulzbach Sophie von Sulzbach Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Gerhard I. von Grögling. Gerhard gestorben in 1170. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 239. |  Elisabeth von Sulzbach Elisabeth von Sulzbach Notizen: Begraben: Familie/Ehepartner: Graf Rapoto I. von Ortenburg. Rapoto (Sohn von Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) und Uta von Passau) gestorben in 1186; wurde beigesetzt in Baumburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 240. |  Bertha von Sulzbach Bertha von Sulzbach Familie/Ehepartner: Heinrich II. von Altendorf. Heinrich gestorben in 1194. [Familienblatt] [Familientafel] |