
| 1. | N. (Normannin) Familie/Ehepartner: Fürst Siemomysł (Ziemomysl) von Polen (Piasten). Siemomysł (Sohn von Fürst Leszek (Lestek) von Polen (Piasten)) gestorben in 964. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. |  Fürst Miezislaus I. (Mieszko) von Polen (Piasten) Fürst Miezislaus I. (Mieszko) von Polen (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I_of_Poland Familie/Ehepartner: Oda von Haldersleben. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Herzogin Dubrawka von Böhmen. Dubrawka (Tochter von Herzog Boleslaw I. von Böhmen (Přemysliden) und Biagota) gestorben in 977. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Prinzessin Adelheid von Polen Notizen: Angeblich war sie auch mit Michael von Ungarn, dem Bruder ihres Gemahls, verheiratet? Adelheid heiratete Grossfürst Géza (Geisa) von Ungarn (Árpáden) in 973. Géza (Sohn von Grossfürst Taksony von Ungarn (Árpáden) und Petschgenische Prinzessin von Kumanien) wurde geboren in cir 940; gestorben am 1 Feb 997. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bolesław_I._(Polen) Familie/Ehepartner: von Meissen. wurde geboren in vor 985. [Familienblatt] [Familientafel] Boleslaus heiratete Judith von Ungarn (Árpáden) in 985/986, und geschieden in 987 in Die Ehe wurde aufgelöst. [Familienblatt] [Familientafel] Boleslaus heiratete Prinzessin Eminilde von Westslawien in 987. Eminilde (Tochter von Fürst Dobromir von Westslawien) wurde geboren in cir 973; gestorben in cir 1017. [Familienblatt] [Familientafel]
Boleslaus heiratete Oda von Meissen am 3 Feb 1018. Oda (Tochter von Markgraf Ekkehard I. von Meissen und Suanhilde (Schwanhild) von Sachsen (Billunger)) wurde geboren in vor 1002. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Prinzessin Świętosława (Gunnhild) von Polen, die Hochmütige Notizen: Die genaue Identität von Gunnhild kann wohl zur Zeit nicht genau geklärt werden. (s.Bericht im Web-Link) Familie/Ehepartner: König Erik VIII. (Erik Segersäll) von Schweden, der Siegreiche . Erik (Sohn von König Björn von Schweden, der Alte ) gestorben in cir 995. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: König Sven I. von Dänemark, Gabelbart . Sven (Sohn von Harald I. von Dänemark, Blauzahn und Tove von Mecklenburg) wurde geboren in cir 965; gestorben am 3 Feb 1014 in Gainsborough, England; wurde beigesetzt in Dom Roskilde. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. |  Grossfürst Stephan I. (Waik) von Ungarn (Árpáden), der Heilige Grossfürst Stephan I. (Waik) von Ungarn (Árpáden), der Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_I_of_Hungary Familie/Ehepartner: Königin Gisela von Bayern. Gisela (Tochter von Heinrich II. von Bayern (Liudolfinger), der Zänker und Gisela von Burgund) wurde geboren in zw 984 und 985 in Schloss Abbach bei Regensburg?; gestorben am 7 Mai 1060 in Passau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Prinzessin Helena? (Marie) von Ungarn (Árpáden) Prinzessin Helena? (Marie) von Ungarn (Árpáden) Helena? heiratete Ottone Orseolo in 1009. Ottone (Sohn von Peter II. (Pietro) Orseolo, der Grosse und Maria Candiano) gestorben in 1032 in Konstantinopel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |  Judith von Ungarn (Árpáden) Judith von Ungarn (Árpáden) Judith heiratete König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) in 985/986, und geschieden in 987 in Die Ehe wurde aufgelöst. Boleslaus (Sohn von Fürst Miezislaus I. (Mieszko) von Polen (Piasten) und Herzogin Dubrawka von Böhmen) wurde geboren in zw 966 und 967; gestorben am 17 Jun 1025. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. |  Reglindis von Polen Reglindis von Polen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Reglindis Reglindis heiratete Hermann I. von Meissen in 1002. Hermann (Sohn von Markgraf Ekkehard I. von Meissen und Suanhilde (Schwanhild) von Sachsen (Billunger)) wurde geboren in cir 980; gestorben am 1 Nov 1038. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. |  König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II._Lambert Miezislaus heiratete Pfalzgräfin Richenza von Lothringen in 1013. Richenza (Tochter von Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und Prinzessin Mathilde von Deutschland) wurde geboren in cir 1000; gestorben am 23 Mrz 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Prinzessin Mathilde von Polen Mathilde heiratete Herzog Otto III. von Schweinfurt (von Schwaben), der Weisse in 1035 (Verlobt / Engaged / Fiancés). Otto (Sohn von Markgraf Heinrich von Schweinfurt und Gräfin Gerberga in der Wetterau) wurde geboren in cir 995; gestorben am 28 Sep 1057. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. |  Olof Skötkonung von Schweden Olof Skötkonung von Schweden Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Olof_Skötkonung Familie/Ehepartner: Edla (Slawin). Edla wurde geboren in ? 980. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Estrid (Obodritin). Estrid wurde geboren in cir 979; gestorben in cir 1035. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | 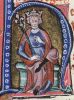 Knut von Dänemark, der Grosse Knut von Dänemark, der Grosse Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Knut_der_Große Familie/Ehepartner: Emma (Imma, Elgiva) von der Normandie. Emma (Tochter von Herzog Richard I. von der Normandie (Rolloniden), der Furchtlose und Cunnora de Crépon (von Dänemark)) wurde geboren in cir 987; gestorben am 6 Mrz 1052. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. |  Estrid Svendsdatter von Dänemark Estrid Svendsdatter von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Verbindung nicht verbürgt! Estrid heiratete Jarl Ulf von Dänemark in cir 1015. Ulf (Sohn von Thorgils Sprakalägg von Dänemark) gestorben am 25 Dez 1026 in Dreifaltigkeitskirche, Roskilde. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzog Richard II. von der Normandie (Rolloniden), der Gute . Richard (Sohn von Herzog Richard I. von der Normandie (Rolloniden), der Furchtlose und Cunnora de Crépon (von Dänemark)) gestorben am 23 Aug 1026 in Fécamp. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Notizen: In der römisch-katholischen Kirche wird er als Heiliger verehrt. |
| 16. | Frowiza Orseolo Notizen: 1041 urkundlich bezeugt. Frowiza heiratete Markgraf Adalbert von Österreich (Babenberger), der Siegreiche in 1041. Adalbert (Sohn von Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte und Richenza (Richarda, Richwarda, Rikchard) von Sualafeldgau (Ernste)) wurde geboren in cir 985; gestorben am 26 Mai 1055. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  König Peter Orseolo (von Ungarn) König Peter Orseolo (von Ungarn) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Einer Legende nach war Peter Orseolo mit Judith von Schweinfurt, Herzogin von Böhmen, verheiratet, was aber historisch nicht stimmen kann, da er 1046/7 starb und Judith von Schweinfurt erst nach dem Tod ihres Mannes 1055 durch ihren Sohn aus Böhmen vertrieben wurde und in Ungarn Zuflucht suchte. |
| 18. |  Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) Notizen: Genannt Odnowiciel (= der Erzerneuerer) Kasimir heiratete Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew in 1043. Dobronega gestorben in 1087. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen Notizen: 1052 urkundlich bezeugt. Richenza heiratete König Béla I. von Ungarn (Árpáden) in zw 1039 und 1042. Béla (Sohn von Fürst Vazul (Wasul) von Ungarn (Árpáden) und Anastasia N.) wurde geboren in zw 1015 und 1020; gestorben in 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Prinzessin Gertrud von Polen Gertrud heiratete Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) in 1043. Isjaslaw (Sohn von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden) wurde geboren in 1024; gestorben am 3 Okt 1078; wurde beigesetzt in Kiew. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Astrid von Schweden Familie/Ehepartner: König Olav II. Haraldsson von Norwegen. Olav wurde geboren in 995; gestorben am 29 Jul 1030 in Stiklestad. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Anund Jakob von Schweden |
| 23. | Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden Notizen: Ingegerd und Jaroslaw hatten acht Kinder, fünf Söhne und drei Töchter. Ingegerd heiratete Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise in 1019. Jaroslaw (Sohn von Grossfürst Wladimir I. von Kiew (Rurikiden), der Grosse und Prinzessin Rogneda von Polotzk, die Kummervolle ) wurde geboren in 978; gestorben am 20 Feb 1054 in Wyschegorod; wurde beigesetzt in Kiew. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. |  König Sven Estridsson von Dänemark König Sven Estridsson von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Sven Estridsson, dän. Svend Estridsen (Metronym), nor. Sven Ulfsson (Patronym), auch Sweyn II. Familie/Ehepartner: Gunhild Svendsdatter. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Aussereheliche Beziehungen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Gytha Sprakalaeg Thorkelsdóttir Notizen: Gytha hatte mit Godwin neun Kinder. Familie/Ehepartner: Godwin Wulfnothson von Wessex. Godwin wurde geboren in cir 1001 in Sussex, England; gestorben am 15 Apr 1053 in Winchester, Hampshire. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Leopold von Österreich (Babenberger) Leopold von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:
|
| 27. |  Markgraf Ernst von Österreich (Babenberger), der Tapfere Markgraf Ernst von Österreich (Babenberger), der Tapfere Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_(Österreich) Ernst heiratete Markgräfin Adelheid von Meissen (Wettinerin) in 1060. Adelheid (Tochter von Graf Dedo I. von Wettin (von Lausitz) und Oda von Lausitz) gestorben am 26 Jan 1071. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Władysław_I._Herman Władysław heiratete Prinzessin Judith von Böhmen in cir 1080. Judith (Tochter von König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) und Prinzessin Adelheid von Ungarn (Árpáden)) wurde geboren in cir 1057; gestorben am 25 Dez 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
Władysław heiratete Judith (Salier) in 1088. Judith (Tochter von Kaiser Heinrich III. (Salier) und Gräfin Agnes von Poitou) wurde geboren in 1054 in Goslar; gestorben in an einem 14 Mär zw 1092 und 1096. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | 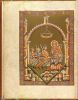 Königin Swatawa von Polen Königin Swatawa von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Swatawa war die erste böhmische Königin. Swatawa heiratete König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) in 1062. Vratislaw (Sohn von Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Herzogin Judith von Schweinfurt) wurde geboren in 1035; gestorben am 14 Jan 1092. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  König Géza I. (Geisa) von Ungarn (Árpáden) König Géza I. (Geisa) von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Géza_I. Familie/Ehepartner: Sophie von Looz. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Synadena Synadenos (von Byzanz). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_von_Ungarn Sophia heiratete Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) in zw 1062 und 1063. Ulrich (Sohn von Poppo I. von Weimar (von Istrien) und Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul) gestorben am 5 Mrz 1070. [Familienblatt] [Familientafel]
Sophia heiratete Magnus von Sachsen (Billunger) in 1070/1071. Magnus (Sohn von Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) und Wulfhild von Norwegen) wurde geboren in cir 1045; gestorben am 23 Aug 1106 in Ertheneburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. |  Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Im Jahre 1192 wurde Ladislaus von Papst Coelestin III. heiliggesprochen, Patrozinium ist am 27. Juni. Familie/Ehepartner: Gisela N.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Rheinfelden (von Schwaben). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. |  Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden) Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Swjatopolk_II._(Kiew) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | 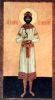 Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jaropolk_Isjaslawitsch Familie/Ehepartner: Kunigunde von Weimar-Orlamünde. Kunigunde (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben in nach 20.3.1117. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Wulfhild von Norwegen Familie/Ehepartner: Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger). Ordulf (Sohn von Herzog Bernhard II. von Sachsen (Billunger) und Markgräfin Eilika von Schweinfurt) gestorben am 28 Mrz 1072. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Magnus I. von Norwegen, der Gute |
| 37. |  Prinzessin Anastasia von Kiew (Rurikiden) Prinzessin Anastasia von Kiew (Rurikiden) Notizen: 1074 urkundlich bezeugt. Anastasia heiratete König Andreas I. von Ungarn (Árpáden) in cir 1046. Andreas (Sohn von Fürst Vazul (Wasul) von Ungarn (Árpáden) und Anastasia N.) wurde geboren in 1015; gestorben in 1060 in Winsselberg; wurde beigesetzt in Familiengruft der Abteikirche Tihany am Plattensee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. |  Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isjaslaw_I. Isjaslaw heiratete Prinzessin Gertrud von Polen in 1043. Gertrud (Tochter von König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) und Pfalzgräfin Richenza von Lothringen) gestorben am 4 Jan 1107. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Wsewolod I. Jaroslawitsch von Kiew (Rurikiden) Wsewolod I. Jaroslawitsch von Kiew (Rurikiden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wsewolod_I. Familie/Ehepartner: Anastasia (Irina) von Byzanz. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Anna von Polowzen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. |  Anna von Kiew (Rurikiden) Anna von Kiew (Rurikiden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Kiew Anna heiratete Heinrich I. von Frankreich (Kapetinger) am 19 Mai 1051. Heinrich (Sohn von König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme und Königin Konstanze von der Provence (von Arles)) wurde geboren in 1008; gestorben am 4 Aug 1060 in Vitry-aux-Loges bei Orléans. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Rudolf III. (IV.) von Valois (von Vexin). Rudolf (Sohn von Rudolf II. von Valois und Adèle de Breteuil) gestorben am 23 Feb 1074 in Péronne. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. |  König Knut IV. von Dänemark, der Heilige König Knut IV. von Dänemark, der Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Knut_IV._(Dänemark) Knut heiratete Königin Adela von Flandern in 1080 in Odense. Adela (Tochter von Graf Robert I. von Flandern, der Friese und Gertrude Billung (von Sachsen)) wurde geboren in cir 1064; gestorben in 1115 in Apulien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. |  König Niels Svennson von Dänemark König Niels Svennson von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Niels_(Dänemark) (Apr 2018) Familie/Ehepartner: Königin Ulvhild Håkonsdatter. Ulvhild wurde geboren am 1095 / 1100; gestorben in 1148; wurde beigesetzt in Zisterzienserkloster, Alvastra. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | Notizen: Erik I. Ejegod Familie/Ehepartner: Bodil Thrugotsdatter. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_II._(England) Familie/Ehepartner: Edyth Swannesha. Edyth wurde geboren in cir 1025; gestorben in nach 1066. [Familienblatt] [Familientafel]
Harald heiratete Ealdgyth von Mercia in 1065. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 45. | Graf Tostig Godwinson von Northumbria Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Toste_Godwinson Tostig heiratete Judith (Jutka) von Flandern in 1051. Judith (Tochter von Graf Balduin IV. von Flandern und Herzogin Eleonore ? von der Normandie) wurde geboren in cir 1030; gestorben am 5 Mrz 1094. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 46. |  Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne Markgraf Leopold II. von Österreich (Babenberger), der Schöne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_II._(Österreich) Familie/Ehepartner: Ida (Itha) von Österreich. Ida gestorben in nach 1101 in Heraklea. [Familienblatt] [Familientafel]
|