| 20. |  Oda von Meissen Oda von Meissen  (9.Ekkehard5, 5.Dubrawka4, 3.Boleslaw3, 2.Vratislaw2, 1.Bořivoj1) wurde geboren in vor 1002. (9.Ekkehard5, 5.Dubrawka4, 3.Boleslaw3, 2.Vratislaw2, 1.Bořivoj1) wurde geboren in vor 1002. Notizen:
Oda war die vierte Gattin von Boleslaw I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Oda_(Meißen)
Oda von Meißen, auch Ode, althochdeutsch für Uta oder Ute, († am 31. Oktober oder 13. November nach 1018) war eine Gräfin aus dem sächsischen Adelsgeschlecht der Ekkehardiner. Am 3. Februar 1018 heiratete sie mit dem Piastenherzog Bolesław I. den späteren König von Polen.
Die Ekkehardiner gehörten unter dem römisch-deutschen Kaiser Otto III. zu den einflussreichsten Fürsten des Reiches. Nach dem Tod des Kaisers versuchten sie, ihre Stellung als Markgrafen von Meißen gegenüber dessen Nachfolger Heinrich II. zu wahren. Dazu suchten sie eine enge Anlehnung an das benachbarte Reich Bolesławs, ihres mächtigsten Freundes und Verbündeten. Nach Ausbruch des Konfliktes zwischen Heinrich und Bolesław ab 1002 beteiligten sie sich nur hinhaltend an den Feldzügen gegen Bolesław. Als der Frieden von Bautzen 1018 die Auseinandersetzungen beendete, diente Odas Hochzeit mit Bolesław zur Festigung des Abkommens.
Bis in das 19. Jahrhundert galt Oda polnischen Historikern als erste Königin Polens.
Leben
Herkunft und Familie
Odas Geburtsjahr und der Geburtsort sind unbekannt.[1] Als jüngstes Kind aus der Ehe des Markgrafen Ekkehard I. von Meißen und der Schwanhild, einer Tochter Hermann Billungs, entstammte Oda einer der vornehmsten und einflussreichsten Familien Sachsens. Nicht zuletzt aufgrund dieses Ansehens kandidierte ihr Vater Ekkehard I. bei der Königswahl von 1002 gegen den späteren König Heinrich II. Ihr ältester Bruder Hermann folgte dem Vater 1009 als Markgraf von Meißen nach und wurde selbst 1038 von Odas Bruder Ekkehard II. abgelöst. Die anderen beiden Brüder bekleideten hohe kirchliche Ämter – Gunther ab 1024 als Erzbischof von Salzburg und Eilward ab 1016 als Bischof von Meißen. Oda hatte zwei Schwestern, Liutgard und Mathilde.[2]
Die Familie unterhielt enge Beziehungen zum polnischen Fürstengeschlecht der Piasten. Odas Onkel Gunzelin war mit Bolesławs I. verschwägert. Nachdem Odas Bruder Hermann 1002 mit Reglindis eine Tochter Bolesławs geheiratet hatte, ehelichte Oda 1018 Bolesław und wurde damit zur „Schwiegermutter des Bruders“.[3]
Aus Odas Ehe mit Bolesław I. ging wahrscheinlich eine Tochter namens Mathilde hervor.[4]
Heirat mit Boleslaw
Am 3. Februar 1018 oder wenige Tage später heiratete Oda den polnischen Herzog Bolesław I.[5] Seit dem Tod seiner dritten Frau Emnildis 1017 hatte Bolesław I. um die deutlich jüngere Oda geworben,[6] deren ältester Bruder Hermann als Familienobeberhaupt einer Vermählung zustimmte.[7] In Begleitung von Hermann und Bolesławs Sohn Otto reiste Oda zur Burg Cziczani, Residenz der Piasten in der Niederlausitz.[8] Dort wurde sie bei ihrem nächtlichen Eintreffen von Bolesław I. und einer großen Menschenmenge mit einem Lichtermeer empfangen. Die Eheschließung dürfte einem einfachen weltlichen Ritus gefolgt sein, allenfalls mit einem untergeordneten kirchlichen Beitrag, zumal die Kirche zu diesem Zeitpunkt erst anfing, sich für das Institut der Ehe zu interessieren.[9]
Persönliches Schicksal
Thietmar von Merseburg liefert in seiner zwischen 1012 und 1018 verfassten Chronik den einzigen zeitgenössischen Bericht der Feierlichkeiten.[10] Nach der gängigen Interpretation übt er darin Kritik am Zustandekommen der Verbindung und zeichnet ein düsteres Bild von Odas Zukunft. Sie werde fortan einer edlen Dame unwürdig leben müssen.[11] Denn die Ehe sei gegen die Regeln der Kirche und ohne deren Zustimmung während der Fastenzeit geschlossen worden. Die nachfolgenden Ausführungen Thietmars scheinen seine Vorhersage zu bestätigen. Im Zusammenhang mit dem Sieg über den Kiewer Fürsten Jaroslaw I. bezeichnet er Bolesław als „alten Hurenbock“ (antiquus fornicator), der die gefangene Schwester Jaroslaws, Predizlawa, ohne Rücksiicht auf seine Ehefrau und gegen jedes Recht zu seiner Nebenfrau gemacht habe.[12] Ob daraus tatsächlich Rückschlüsse auf die Ehe mit Oda gezogen werden können, ist zweifelhaft. Nach Auffassung des polnischen Historikers Andrzej Pleszczyński dararf Bolesławs Verhalten nicht an heutigen Moralvorstellungen gemessen werden.[13] Er habe damit archaische Erwartungen an einen siegreichen Herrscher erfüllt, die in seinem Reich zu diesem Zeitpunkt noch wesentlich tiefer verwurzelt gewesen seien als christliche Werte.
Nach älteren Interpretationen von Thietmars Bericht richtet sich dessen Kritik auch gegen Oda. Danach soll Thietmars Wendung sine matronali consuetudine mit „ohne Jungfräulichkeit“ zu übersetzen sein.[14] Oda habe bis zur Eheschließung einen freizügigen Lebenswandel geführt und nicht wie es einem so angesehenen Ehebund würdig gewesen wäre.[15] Robert Holtzmann kommentiert die von ihm ebenso verstandene Anmerkung Thietmars als „bittere Ironie“.[16]
Politische Dimension
Neben der Bedeutung für Odas persönliches Schicksal hatte die Eheschließung mit Bolesław I. eine politische Dimension. Sie war Bestandteil des Friedens von Bautzen, mit dem Bolesław I. und der deutsch-römische Kaiser Heinrich II. ihre fast zwei Jahrzehnte andauernden Streitigkeiten um Rang, Ehre und Ansehen, aber auch um territoriale Ansprüche über die Mark Lausitz, das Milzener Land und die angrenzende Mark Meißen beendeten.[17] An den Feldzügen Heinrichs gegen Bolesław hatte sich Odas Familie als Angehörige einer „polenfreundliche Bündnisgruppe“[18] neben den mächtigen Billungern nur hinhaltend beteiligt. Die Eheschließung erneuerte die traditionelle Freundschaft zwischen Piasten und Ekkehardinern, nachdem die mit Odas Bruder Hermann verheiratete Tochter Bolesławs I., Reglindis, bereits 1016 verstorben war. Zudem stellte Bolesławs prestigeträchtige Eheschließung mit der hochrangigen Oda seine Ehre wieder her und war damit Ausdruck seines Sieges.[19] Denn der Frieden von Bautzen bestätigte Bolesławs Herrschaft über die Lausitz und das Milzener Land, auf das er aufgrund seiner dritten Ehe mit Emnildis, einer Tochter des Lausitzer Fürsten Dobromir,[20] ebenso Anspruch erhob wie die Ekkehardiner. Und schließlich sind keine Angriffe Bolesławs I. auf die benachbarte Mark Meißen mehr überliefert, in der Odas Bruder Hermann das Amt des Markgrafen ausübte.
Weiterer Lebensweg[
Über das weitere Leben Odas ist nichts bekannt.[21] Überlegungen, sie sei in den Wirren nach Bolesławs I. Tod am 17. Juni 1025 gemeinsam mit ihrer Tochter Mathilde an den Stammsitz der Ekkehardiner nach Naumburg zurückgekehrt,[22] lassen sich duurch zeitgenössische Schriftquellen nicht belegen. Auch ihr Todesjahr wird nicht überliefert.[23] Im Nekrolog der Kirche St. Michael in Lüneburg sind unter dem 31. Oktober und dem 13. November Einträge für eine Ode com, also einer Gräfin Oda (Ode comitessa), verzeichnet. Gerd Althoff ist zu dem Ergebnis gelangt, dass einer von beiden dem Gedenken Odas gilt, weil auch Bolesław I. und viele Mitglieder der ekkehardinischen Familie Aufnahme in das Nekrolog gefunden haben.[24]
Rezeption
Im deutschen Sprachraum hat Oda keine größere Aufmerksamkeit erfahren. Geschichtswissenschaftliche Darstellungen erwähnen sie allenfalls als Randfigur im Zusammenhang mit dem Frieden von Bautzen, als Ehefrau Bolesławs I.[25] oder Angehörige des Adelsgeschlechtes der Ekkehardiner.[26] Eine Ausnahme davon bildet eine Überlegung des Historikers Ferdinand Wachter aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach der die Stifterfigur der Uta von Naumburg nicht Ekkehards II. Frau Uta von Ballenstedt, sondern seine Schwester Oda von Meißen darstellen könnte.[27] Insbesondere die Krone der nur mit dem Namen „Uta“ beschrifteten Sandsteinfigur hatte zuletzt auch den Kunsthistoriker Michael Imhof an einer Identifikation der Stifterfigur als Uta von Ballenstedt zweifeln lassen, wobei er in ihr allerdings Odas Schwägerin Reglindis vermutet.[28]
Polnischen Historikern galt Oda bis in das 19. Jahrhundert als erste Königin Polens. Grund für diese Annahme war eine Notiz des polnischen Historiographen Jan Długosz in seiner im 15. Jahrhundert entstandenen Chronik Annales seu Chronicae incliti Regni Poloniae (Annalen oder Chroniken des ruhmreichen Königreichs Polen).[29] Darin berichtet er im Einklang mit zeitgenössischen sächsischen Annalen,[30] Bolesław I. habe sich im Jahr 1025 nach dem Tod seines Widersachers Heinrich II. zum König krönen lassen. Darüber hinaus deutet Długosz aber an, gemeinsam mit Bolesław I. sei eine namentlich nicht genannte Königin gekrönt worden, in der nachfolgende Generationen Oda vermuteten. Inzwischen gilt die Gleichsetzung der namenlosen Königin mit Oda jedoch als ebenso haltlos wie die zugrunde liegende Notiz des Jan Długosz.[31] Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Werken des Jan Długosz hat ergeben, dass er die von ihm verwendeten Quellen häufig um Ereignisse ergänzte, die seiner Ansicht nach stattgefunden haben müssen.[32]
Quellen
• Robert Holtzmann (Hrsg.): Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon. = Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 6: Scriptores rerum Germanicarum. Nova Seris Bd. 9). Weidmann, Berlin 1935, (Digitalisat).
Literatur
• Kurt Engelbert: Die deutschen Frauen der Piasten Mieszko I. bis Heinrich I. In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte. Bd. 12, 1954, ISSN 0066-6491, S. 1–51.
• Norbert Kersken: Heiratsbeziehungen der Piasten zum römisch-deutschen Reich. in: Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken (Hrsg.): Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühn 13. Jahrhundert. Harassowitz, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3447104210, S. 79–105.
• Herbert Ludat: An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa. Böhlau, Köln u. a. 1971, ISBN 3-412-07271-0.
• Gabriele Rupp: Die Ekkehardiner, Markgrafen von Meissen und ihre Beziehung zum Reich und zu den Piasten (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften. Bd. 691). Lang, Frankfurt am Main u. a. 1996, ISBN 3-31-49868-3 (Zugleich: München, Ludwig-Maximilians-Universität, Dissertation, 1995).
Anmerkungen
1 Kazimierz Jasiński: Rodowód pierwszych Piastów. = Genealogy of the First Piasts (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia. Bd. 19). Volumen, Poznań 2004, ISBN 83-7063-409-5, S. 89.
2 Odas Eltern und Geschwister mit Quellenangaben bei Ruth Bork: Die Billunger. Mit Beiträgen zur Geschichte des deutsch-wendischen Grenzraumes im 10. und 11. Jahrhundert. Greifswald 1951, S. 114–117, (Greifswald, Universität, phil. Dissertatio, 1951, maschinschriftlich).
3 Herbert Ludat: An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa. Böhlau, Köln u. a. 1971, ISBN 3-412-07271-0, S. 19.
4 Die Hildesheimer Annalen geben zum Jahr 1035 nur den Namen des Vaters, die Abstammung von Oda wird aber allgemein vermutet, so etwa von Gabriele Rupp: Die Ekkehardiner, Markgrafen von Meissen und ihre Beziehung zum Reich und zu den Piasten. Lng, Frankfurt am Main u. a. 1996, ISBN 3-631-49868-3, S. 201.
5 Kazimierz Jasiński: Rodowód pierwszych Piastów. = Genealogy of the First Piasts (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia. Bd. 19). Volumen, Poznań 2004, ISBN 83-7063-409-5, S. 89.
6 Thietmar VIII, 32 bezeichnet Bolesław I. im Sommer 1018 als antiquus.
7 Herbert Ludat: An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa. Böhlau, Köln u. a. 1971, ISBN 3-412-07271-0, S. 19 Anmerkung 224.
8 Die Burg Presenchen bei Zinnitz, dazu Joachim Henning: Neue Burgen im Osten: Handlungsorte und Ereignisgeschichte der Polenzüge Heinrichs II. im archäologischen und dendrochronologischen Befund. In: Achim Hubel, Bernd Schneidmüller (Hrsg.): Afbruch ins zweite Jahrtausend. Innovation und Kontinuität in der Mitte des Mittelalters (= Mittelalter-Forschungen. Bd. 16). Thorbecke, Ostfildern 2004, ISBN 3-7995-4267-1, S. 151–181, hier S. 166.
9 Andrzej Pleszczyński: The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A.D. (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Bd. 15). Brill, Leiden u. a. 2011, ISBN 978-90-04-18554-8, S. 23 f.
10 Thietmar VIII, 1.
11 So die Interpretation von Thietmars …,quae vivebat hactenus sine matronali consuetudine admodum digna tanto fordere. durch Werner Trillmich in: Thietmar von Merseburg: Chronik (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalter. Bd. 9). Neu übertragen und erläutert von Werner Trillmich. Mit einem Nachtrag und einer Bibliographie von Steffen Patzold. 9., bibliographisch aktualisierte Auflage. WBG – Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-534-24669-4, S. 441.
12 Thietmar VIII, 32.
13 Andrzej Pleszczyński: The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A.D. (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Bd. 15). Brill, Leiden u. a. 2011, ISBN 978-90-04-18554-8, S. 10 f.
14 Siegfried Hirsch: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Band 3. Herausgegeben und vollendet von Harry Bresslau. Duncker und Humblot, Leipzig 1875, S. 88 Anmerkung 1.
15 Kurt Engelbert: Die deutschen Frauen der Piasten Mieszko I. bis Heinrich I. In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte. Bd. 12, 1954, S. 1–51, hier S. 6; Johannes Strebitzki (Hrsg.): Die Chronik des Thietmar von Merseburg. Uebersetzt von. Laurent (= Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. 2. Gesamtausgabe, Bd. 39, ZDB-ID 1402490-1). 2. Auflage. Dyksche Buchhandlung, Leipzig 1892, S. 333.
16 Robert Holtzmann (Hrsg.): Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon. = Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 6: Scriptores rerum Germanicarum. Nova Seres Bd. 9). Weidmann, Berlin 1935, S. 494.
17 Knut Görich: Die deutsch-polnischen Beziehungen im 10. Jahrhundert aus der Sicht sächsischer Quellen. In: Frühmittelalterliche Studien. Bd. 43, 2009, S. 315–325, hier S. 320 f.
18 Zitat nach Stefan Weinfurter: Heinrich II. (1002–1024). Herrscher am Ende der Zeiten. 3., verbesserte Auflage. Pustet, Regensburg 2002, ISBN 3-7917-1654-9, S. 210.
19 Eduard Mühle: Die Piasten. Polen im Mittelalter (= Beck'sche Reihe. C. H. Beck Wissen. Bd. 2709). Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61137-7, S. 27.
20 Thietmar IV, 58.
21 Kazimierz Jasiński: Rodowód pierwszych Piastów. = Genealogy of the First Piasts (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia. Bd. 19). Volumen, Poznań 2004, ISBN 83-7063-409-5, S. 89.
22 Ferdinand Wachter: Eckhart II. In: Johann S. Ersch, Johann G. Gruber (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge. Section 1: A – G. Theil 30: Eberhard – Ecklonia. Brockhaus, Leipzig 1838, S. 488–49, hier S. 496 f.
23 Kazimierz Jasiński: Rodowód pierwszych Piastów. = Genealogy of the First Piasts (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia. Bd. 19). Volumen, Poznań 2004, ISBN 83-7063-409-5, S. 89.
24 Gerd Althoff: Adels- und Königsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung. Studien zum Totengedenken der Billunger und Ottonen (= Münstersche Mittelalter-Schriften. Bd. 47). Fink, München 1984, ISBN 3-7705-2267-2, S. 420, 423.
25 Norbert Kersken: Heiratsbeziehungen der Piasten zum römisch-deutschen Reich. in: Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken (Hrsg.): Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühn 13. Jahrhundert. Harassowitz, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3447104210, S. 79–105, hier S. 97.
26 Gabriele Rupp: Die Ekkehardiner, Markgrafen von Meissen und ihre Beziehung zum Reich und zu den Piasten. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1996, ISBN 3-631-49868-3, S. 201.
27 Ferdinand Wachter: Eckhart II. In: Johann S. Ersch, Johann G. Gruber (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge. Section 1: A – G. Theil 30: Eberhard – Ecklonia. Brockhaus, Leipzig 1838, S. 488–49, hier S. 496 f.
28 Michael Imhof, Holger Kunde: Uta von Naumburg. Imhof, Petersberg 2011, ISBN 978-3-86568-655-8, S. 58.
29 Zbigniew Satała: Poczet polskich królowych, księżnych i metres. [Galerie der polnischen Königinnen, Prinzessinnen und Mätressen]. Glob, Szczecin 1990, ISBN 83-7007-257-7, S. 24.
30 Beispielsweise den Annales Quedlinburgensis a.A. 1025.
31 Zbigniew Satała: Poczet polskich królowych, księżnych i metres. [Galerie der polnischen Königinnen, Prinzessinnen und Mätressen]. Glob, Szczecin 1990, ISBN 83-7007-257-7, S. 24.
32 Ryszard Grzesik: Mittelalterliche Chronistik in Ostmitteleuropa. In: Gerhard Wolf, Norbert H. Ott (Hrsg.): Handbuch Chroniken des Mittelalters. De Gruyter, Berlin u. a. 2016, ISBN 978-3-11-034171-3, S. 773–804, hier S. 794.
Oda heiratete König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) am 3 Feb 1018. Boleslaus (Sohn von Fürst Miezislaus I. (Mieszko) von Polen (Piasten) und Herzogin Dubrawka von Böhmen) wurde geboren in zw 966 und 967; gestorben am 17 Jun 1025. [Familienblatt] [Familientafel]
|

 Herzog Vratislaw I. von Böhmen (Přemysliden)
Herzog Vratislaw I. von Böhmen (Přemysliden)  Herzog Boleslaw I. von Böhmen (Přemysliden)
Herzog Boleslaw I. von Böhmen (Přemysliden)  Wenzel von Böhmen
Wenzel von Böhmen  Herzogin Dubrawka von Böhmen
Herzogin Dubrawka von Böhmen  König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten)
König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten)  Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden)
Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden)  Reglindis von Polen
Reglindis von Polen  König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten)
König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten)  Olof Skötkonung von Schweden
Olof Skötkonung von Schweden 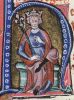 Knut von Dänemark, der Grosse
Knut von Dänemark, der Grosse  Estrid Svendsdatter von Dänemark
Estrid Svendsdatter von Dänemark  Hermann I. von Meissen
Hermann I. von Meissen  Markgraf Ekkehard II. von Meissen
Markgraf Ekkehard II. von Meissen  Oda von Meissen
Oda von Meissen  Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden)
Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden)