
| 1. |  Graf Siegbert I. im Saargau gestorben in vor 1118. Graf Siegbert I. im Saargau gestorben in vor 1118. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Saargau Familie/Ehepartner: Gräfin von Eppenstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. |  Graf Friedrich von Saarbrücken Graf Friedrich von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_(Saarbrücken) Familie/Ehepartner: Herzogin Gisela von Oberlothringen?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Siegbert II. vom Elsass (im Saargau) |
| 4. |  Gräfin Agnes von Saarbrücken Gräfin Agnes von Saarbrücken Agnes heiratete Herzog Friedrich II. von Schwaben (Staufer) in cir 1135. Friedrich (Sohn von Herzog Friedrich I. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) und Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen)) wurde geboren in 1090; gestorben in zw 04 und 06 Apr 1147; wurde beigesetzt in St. Walpurgis (Elsass). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Graf Simon I. von Saarbrücken Graf Simon I. von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_I._(Saarbrücken) Familie/Ehepartner: Mechtild von Sponheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. |  Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen) Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen) Notizen: Judith hatte mit Ludwig II. drei Kinder. Familie/Ehepartner: Landgraf Ludwig II. von Thüringen, der Eiserne . Ludwig (Sohn von Landgraf Ludwig I. von Thüringen (von Schauenburg) und Hedwig von Gudensberg) wurde geboren in 1128; gestorben am 14 Okt 1172 in Neuenburg am Rhein, Baden, DE; wurde beigesetzt in Kloster Reinhardsbrunn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Pfalzgraf Konrad von Schwaben (von Staufen) Pfalzgraf Konrad von Schwaben (von Staufen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_der_Staufer Familie/Ehepartner: von Sponheim. gestorben am 1159 / 1160. [Familienblatt] [Familientafel] Konrad heiratete Irmingard von Henneberg in cir 1160. Irmingard (Tochter von Burggraf Bertold I. von Henneberg und Bertha von Putelendorf (von Goseck)) gestorben in 1197. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Luitgard von Schwaben (von Staufen) |
| 9. |  Graf Simon II. von Saarbrücken Graf Simon II. von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Liutgard (Lucarde) von Leiningen. Liutgard (Tochter von Emich III. von Leiningen) gestorben in nach 1239. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |  Graf Heinrich I. von Zweibrücken (von Saarbrücken) Graf Heinrich I. von Zweibrücken (von Saarbrücken) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Zweibr%C3%BCcken) Familie/Ehepartner: Hedwig von Lothringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Sophia von Saarbrücken Sophia von Saarbrücken Notizen: Sophia und Heinrich III. hatten acht Kinder, sechs Söhne und zwei Töchter. Sophia heiratete Herzog Heinrich III. von Limburg in cir 1165. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich II. von Limburg und Mathilde von Saffenberg) wurde geboren in cir 1140; gestorben am 21 Jul 1221 in Klosterrath. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. |  Landgraf Ludwig III. von Thüringen (Ludowinger) Landgraf Ludwig III. von Thüringen (Ludowinger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_III._(Thüringen) Ludwig heiratete Margarethe von Kleve in Datum unbekannt, und geschieden in 1186. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Königin Sophia von Dänemark (von Minsk) in Datum unbekannt. Sophia (Tochter von Volodar Gļebovič und Prinzessin Rikissa von Polen) wurde geboren in cir 1140; gestorben am 5 Mai 1198; wurde beigesetzt in Marienkirche (heute St. Bendt), Ringsted. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. |  Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) Pfalzgraf Hermann I. von Thüringen (Ludowinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._(Thüringen) (Apr 2018) Hermann heiratete Sophia von Sommerschenburg in 1182. Sophia (Tochter von Friedrich II. von Sommerschenburg) gestorben am 1189 / 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
Hermann heiratete Sophia von Bayern (Wittelsbacher) in 1196. Sophia (Tochter von Herzog Otto I. von Bayern (von Scheyren) (Wittelsbacher), der Rotkopf und Agnes von Loon und Rieneck) wurde geboren in 1170; gestorben in 1238. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Jutta von Thüringen Jutta von Thüringen Jutta heiratete Graf Hermann II. von Ravensberg in Datum unbekannt. Hermann gestorben am 22 Apr 1221. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Pfalzgräfin Agnes von Staufen Pfalzgräfin Agnes von Staufen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Staufen_(Pfalzgräfin) Agnes heiratete Heinrich V. von Braunschweig (von Sachsen) (Welfen), der Ältere in Jan oder Feb 1194. Heinrich (Sohn von Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe und Mathilde von England (Plantagenêt)) wurde geboren in ca 1173 / 1174; gestorben am 28 Apr 1227 in Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Graf Simon III. von Saarbrücken Graf Simon III. von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Grafen_von_Saarbr%C3%BCcken Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken) Graf Friedrich II. von Leiningen (von Saarbrücken) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Leiningen) Familie/Ehepartner: Agnes von Eberstein. Agnes (Tochter von Eberhard III. von Eberstein und Gräfin Kunigunde von Andechs) wurde geboren in Grafschaft Eberstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | 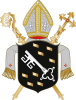 Bischof Heinrich II. von Saarbrücken Bischof Heinrich II. von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Saarbr%C3%BCcken |
| 19. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Heinrich II. (Zweibrücken) Familie/Ehepartner: Agnes von Eberstein. Agnes (Tochter von Graf Eberhard IV. von Eberstein und Adelheid von Sayn) wurde geboren in Grafschaft Eberstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. |  Herzog Walram IV. von Limburg Herzog Walram IV. von Limburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_IV._(Limburg) Familie/Ehepartner: Kunigunde von Monschau. [Familienblatt] [Familientafel]
Walram heiratete Gräfin Ermesinde II. von Luxemburg in Mai 1214. Ermesinde (Tochter von Graf Heinrich IV. von Luxemburg (von Namur), der Blinde und Agnes von Geldern) wurde geboren in Jul 1186; gestorben am 12 Feb 1247; wurde beigesetzt in Abtei Clairefontaine bei Arlon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Jutta von Thüringen Jutta von Thüringen Notizen: Name: Jutta heiratete Graf Dietrich von Landsberg (von Wettin) in Datum unbekannt. Dietrich (Sohn von Dedo III. von Wettin (von Lausitz), der Feiste und Mathilde (Mechthilde) von Heinsberg) wurde geboren in vor 13 Sep 1159; gestorben am 13 Jun 1207. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Jutta von Thüringen (Ludowinger) Jutta von Thüringen (Ludowinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_von_Thüringen Jutta heiratete Markgraf Dietrich von Meissen (Wettiner) in vor 1197. Dietrich (Sohn von Markgraf Otto von Meissen (Wettiner) und Markgräfin Hedwig von Brandenburg (von Ballenstedt)) wurde geboren in 1162; gestorben am 18 Feb 1221; wurde beigesetzt in Kloster Altzella, Nossen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Jutta heiratete Graf Poppo VII. von Henneberg am 3 Jan 1223 in Leipzig, DE. Poppo (Sohn von Graf Poppo VI. von Henneberg und Sophia (Sophie) von Andechs) wurde geboren in vor 1202; gestorben am 21 Aug 1245; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Thüringen) Ludwig heiratete Elisabeth von Thüringen (von Ungarn) in 1221. Elisabeth (Tochter von König Andreas II. von Ungarn (Árpáden) und Gertrud von Andechs) wurde geboren am 7 Jul 1207 in Pressburg; gestorben am 17 Nov 1231 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. |  Agnes von Thüringen (Ludowinger) Agnes von Thüringen (Ludowinger) Notizen: Name: Agnes heiratete Herzog Heinrich von Österreich (Babenberger) am 29 Nov 1225 in Nürnberg, Bayern, DE. Heinrich (Sohn von Herzog Leopold VI. von Österreich (Babenberger, der Glorreiche und Theodora Angela von Byzanz) wurde geboren in 1208; gestorben am 29 Nov 1227/1228. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Herzog Albrecht I. von Sachsen (Askanier) in 1238. Albrecht (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in cir 1175; gestorben am 7 Okt 1260; wurde beigesetzt in Kloster Lehnin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. |  Irmgard von Thüringen (Ludowinger) Irmgard von Thüringen (Ludowinger) Irmgard heiratete Fürst Heinrich I. von Anhalt (Askanier) in 1211. Heinrich (Sohn von Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) und Judith von Polen) wurde geboren in 1170; gestorben in 1252. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Otto II. von Ravensberg Otto II. von Ravensberg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._(Ravensberg) Otto heiratete Sophie von Oldenburg in Datum unbekannt. Sophie wurde geboren in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. |  Graf Ludwig von Ravensberg Graf Ludwig von Ravensberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_(Ravensberg) Ludwig heiratete Gertrud von der Lippe in vor 17 Apr 1236. Gertrud gestorben in 1240. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Adelheid von Dassel in vor 6 Mai 1244. Adelheid (Tochter von Graf Adolf I. von Dassel und Gräfin Adelheid von Wassel) gestorben am 14 Sep 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  Agnes von Braunschweig Agnes von Braunschweig Notizen: Agnes hatte mit Otto II. fünf Kinder. Familie/Ehepartner: Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher). Otto (Sohn von Herzog Ludwig I. von Bayern (Wittelsbacher), der Kelheimer und Herzogin Ludmilla von Böhmen) wurde geboren am 7 Apr 1206 in Kehlheim; gestorben am 29 Nov 1253 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. |  Pfalzgräfin Irmengard bei Rhein (von Braunschweig) Pfalzgräfin Irmengard bei Rhein (von Braunschweig) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmengard_bei_Rhein Irmengard heiratete Markgraf Hermann V von Baden in cir 1217. Hermann (Sohn von Markgraf Hermann IV von Baden und Markgräfin Bertha von Tübingen) gestorben am 16 Jan 1243; wurde beigesetzt in Augustiner-Chorherrenstift Backnang, dann 1248 Kloster Lichtenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Lauretta von Saarbrücken Lauretta von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Lauretta heiratete Herr Gottfried II. von Apremont in cir 1235. Gottfried (Sohn von Gobert VI. von Apremont, der Glückliche und Herrin Juliane von Chaumont-Porcien) wurde geboren in cir 1210; gestorben in Jan 1250 in vor al-Mansura in Ägypten. [Familienblatt] [Familientafel] Lauretta heiratete Dietrich Luv I. von Kleve in 1252. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve und Hedwig von Meissen (Weissenfels)) wurde geboren in cir 1228; gestorben in 1277. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 31. |  Gräfin Mathilde von Saarbrücken Gräfin Mathilde von Saarbrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Simon II von Commercy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. |  Simon von Leiningen Simon von Leiningen Notizen: Name: Simon heiratete Gertrud von Dagsburg (Etichonen) in 1220. Gertrud (Tochter von Albert II. (Albrecht) von Dagsburg (Etichonen) und Gertrud von Baden) gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. |  Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(Leiningen) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Kyburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. |  Graf Emich IV. von Leiningen Graf Emich IV. von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Emich_IV. Emich heiratete Elisabeth in cir 1235. Elisabeth gestorben in 1264. [Familienblatt] [Familientafel]
Emich heiratete Margarete von Heimbach (Hengebach) in 1265. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. |  Bischof Heinrich von Leiningen Bischof Heinrich von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Leiningen |
| 36. |  Bischof Berthold von Leiningen Bischof Berthold von Leiningen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Leiningen |
| 37. |  Kunigunde von Leiningen Kunigunde von Leiningen Familie/Ehepartner: Werner IV. von Bolanden (Falkenstein, Münzenberg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. |  Simon I. von Zweibrücken Simon I. von Zweibrücken Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Calw. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Elisabeth von Zweibrücken Elisabeth von Zweibrücken Familie/Ehepartner: Graf Gerlach V. von Veldenz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. |  Sophie von Limburg Sophie von Limburg Sophie heiratete Friedrich von Isenberg (von Altena) in cir 1214. Friedrich (Sohn von Arnold von Altena und Mechthild von Holland) wurde geboren in vor 1193; gestorben am 14 Nov 1226 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. |  Herzog Heinrich IV. von Limburg Herzog Heinrich IV. von Limburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(Limburg) Familie/Ehepartner: Irmgard von Berg. Irmgard (Tochter von Adolf III. von Berg und Bertha von Sayn (?)) wurde geboren in spätestens 1204; gestorben in 11 bis 13 Aug 1248 oder 1249. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. |  Walram II. von Monschau (Haus Limburg) Walram II. von Monschau (Haus Limburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_II._(Monschau) Familie/Ehepartner: Elisabeth von Bar. Elisabeth (Tochter von Graf Theobald I. von Bar-Scarponnois und Gräfin Ermesinde II. von Luxemburg) gestorben in 1262. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(Luxemburg) Heinrich heiratete Herrin Margareta von Bar in 1240. Margareta (Tochter von Graf Heinrich II. von Bar-Scarponnois und Philippa von Dreux) wurde geboren in 1220; gestorben in 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. |  Katherina von Limburg Katherina von Limburg Notizen: Katherina und Matthäus II. hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Katherina heiratete Herzog Matthäus II. von Lothringen in 1225. Matthäus (Sohn von Herzog Friedrich II. von Lothringen (von Bitsch) und Gräfin Agnes von Bar) wurde geboren in cir 1193; gestorben am 9 Feb 1251. [Familienblatt] [Familientafel]
|