
| 1. |  Königin Bertrada von Laon, die Jüngere wurde geboren in cir 725 in Samoussy, Frankreich; gestorben in 12 / 13 Jul 783 in Choisy-au-Bac; wurde beigesetzt in Cauciaco, dann Ecclesia Sancti Dionysii Martiris (Kirche des heiligen Märtyrers Dionysius), Abtei von Saint Denis. Königin Bertrada von Laon, die Jüngere wurde geboren in cir 725 in Samoussy, Frankreich; gestorben in 12 / 13 Jul 783 in Choisy-au-Bac; wurde beigesetzt in Cauciaco, dann Ecclesia Sancti Dionysii Martiris (Kirche des heiligen Märtyrers Dionysius), Abtei von Saint Denis. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: Bertrada of Laon, also Bertha Broadfoot Bertrada heiratete Pippin III. (Karolinger) in cir 740. Pippin (Sohn von Karl Martell und Rotrud (Chrotrudis) (Widonen?)) wurde geboren in cir 715; gestorben am 24 Sep 768 in St. Denis. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | 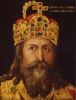 Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: Charlemagne or Charles the Great, numbered Charles I Karl heiratete Himiltrud N. in vor 767. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Desiderata ? (Langobardin) in vor 768. Desiderata wurde geboren in vor 754; gestorben in nach 771. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Kaiserin Hildegard (Alemannin) (Geroldonen) in 771. Hildegard (Tochter von Gerold I. von Anglachgau (Geroldonen) und Imma (Hemma) (Alemannin)) wurde geboren in cir 758; gestorben am 30 Apr 783 in Diedenhofen an der Mosel. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Fastrade von Franken in Okt 783. Fastrade wurde geboren in cir 765; gestorben am 10 Aug 794; wurde beigesetzt in Stift St. Alban vor Mainz. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Luitgard aus Alemannien in vor 796. Luitgard gestorben am 4 Jun 800 in Kloster Saint-Martin in Tours,. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. |  König Karlmann I. (Karolinger) König Karlmann I. (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Carloman_I |
| 4. | G. (Karolinger) |
| 5. | Pippin (Karolinger) |
| 6. | Berthe (Karolinger) Notizen: Berthe ist nur in der französischen Version Wikipedia aufgeführt. |
| 7. | Rothaid (Karolinger) |
| 8. | Adelheid (Karolinger) |
| 9. |  Pippin (Karolinger), der Bucklige Pippin (Karolinger), der Bucklige Notizen: 792, Pippin, der sich offenbar innerhalb der Rangfolge im Reich zurückgesetzt sah, erhob sich 792 erfolglos gegen Karl. Er wurde anschliessend in der Abtei Prüm inhaftiert. |
| 10. | Karl (Karolinger), der Jüngere |
| 11. | Adelheid (Karolinger) |
| 12. | Rotrud (Karolinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rotrud Familie/Ehepartner: Graf Rorgon I. (Rorico Rorich) von Maine (von Rennes). Rorgon wurde geboren in cir 770; gestorben am 16 Jun 839. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Pippin_(Italien) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: Louis the Pious, also called the Fair, and the Debonaire Familie/Ehepartner: N. (Konkubine des Ludwig I.) N.. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Kaiserin Irmingard von Haspengau in 794. Irmingard (Tochter von Inrgam von Haspengau) wurde geboren in cir 780; gestorben am 3 Okt 818 in Angers, FR; wurde beigesetzt in Angers, FR. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Kaiserin Judith von Altdorf (Welfen) in Feb 819. Judith (Tochter von Graf Welf I. von Schwaben und Bayern (Welfen) und Eilgive (Heilwig) von Sachsen) wurde geboren in cir 795; gestorben am 19 Apr 843; wurde beigesetzt in St. Martin, Tours. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lothar (Karolinger) Notizen: Name: |
| 16. | Berta (Karolinger) |
| 17. | Gisela (Karolinger) |
| 18. | Hildegard (Karolinger) |
| 19. | Theodrata (Karolinger) |
| 20. | Hiltrud (Karolinger) Familie/Ehepartner: Graf Eberhard I. von Calw. Eberhard wurde geboren in 775; gestorben in 811. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Ludwig von Maine Notizen: Ludwig war der einzige Sohn des Rorgon, des späteren Grafen von Maine aus dem Haus der Rorgoniden und der Rotrud, der Tochter Karls des Grossen. |
| 22. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_(Italien) Bernhard heiratete Kunigunde N. in cir 815. Kunigunde gestorben in nach 15 Jun 835. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Alpheidis (Alpais) N. Notizen: Name: Alpheidis heiratete Beggo I. von Paris in cir 806. Beggo (Sohn von Gerhard I. von Paris und Rotrud N.) wurde geboren in zwischen 755 und 760; gestorben am 28 Okt 816. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Graf Arnulf (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Unehelicher Sohn von Kaiser Ludwig I. |
| 25. | 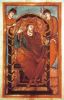 Kaiser Lothar I. von Lothringen Kaiser Lothar I. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_I._(Frankenreich) Lothar heiratete Kaiserin Irmgard von Tours (von Erstein), die Heilige am 15 Okt 821 in Diedenhofen an der Mosel. Irmgard (Tochter von Hugo von Tours und Aba (Ava) N.) wurde geboren in cir 805; gestorben am 20 Mrz 851. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | König Pippin I. von Aquitanien Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepin_I_of_Aquitaine Familie/Ehepartner: Ringart (Hringart) von Madrie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. |  König Ludwig II. (Karolinger), der Deutsche König Ludwig II. (Karolinger), der Deutsche Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: Louis the German also known as Louis II Ludwig heiratete Hemma (Welfen) in 827. Hemma (Tochter von Graf Welf I. von Schwaben und Bayern (Welfen) und Eilgive (Heilwig) von Sachsen) wurde geboren in 808; gestorben am 31 Jan 876. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger) Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger) Notizen: lebte als Witwe in Flandern; 874 urkundlich bezeugt. Gisela heiratete Markgraf Eberhard von Italien (von Friaul) (Unruochinger) in zw 836 und 840 in Abtei Cysoing. Eberhard (Sohn von Graf Unruoch (Hunroch Henrok) von Friaul (Ternois) (Unruochinger) und Angiltrud N.) wurde geboren in cir 812; gestorben in zw 864 und 866 in Königreich Italien; wurde beigesetzt in Abtei Cysoing. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. |  Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_the_Bald Karl heiratete Königin Irmtrud von Orleans am 14 Dez 824 in Abtei Saint-Pierre de Hasnon, Valenciennes. Irmtrud (Tochter von Odo von Orléans und Ingeltrud von Fézensac) gestorben am 6 Okt 869 in Abtei Saint-Pierre de Hasnon, Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Kaiserin Richildis von Vienne am 22 Jan 870. Richildis (Tochter von Graf Buvinus (Bovin, Bivin) von Metz und Richeut ? von Arles (von Vienne) (Bosoniden)) wurde geboren in cir 845; gestorben am 2 Mai 910. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Prinzessin von Aquitanien Notizen: Verbindung nicht sicher. Sie könnte auch Ratger von Limoges geheiratet haben. Familie/Ehepartner: Graf Gerhard I. von Auvergne (Ramnulfiden). Gerhard gestorben in cir 25 Jun 841 in Fontenoy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Graf Astulf von Calw Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | Pippin (Vermandois) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Pippin_(Vermandois) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Susanna von Paris Notizen: Im Bericht ihres Sohnes Adalhard und ihrer Enkelin, Adelheid von Friaul, soll Susanne die Tochter des Beggo I. von Paris mit seiner Gemahlin Alpheidis sein. Im Bericht von Beggo I. ist sie jedoch die Tochter einer unbekannten 1. Ehefrau Beggos I.? Susanna heiratete Graf Wulfhard I. von Flavigny in 825/830. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  König Ludwig II. von Italien König Ludwig II. von Italien Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_II._(Italien) Ludwig heiratete Engelberga (Angilberga) von Parma ? in nach 5 Okt 851. Engelberga gestorben in zw 890 und 891. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. |  Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien Notizen: Name: Irmgard heiratete Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau am vor Mrz. 846. Giselbert gestorben in zw 14 Jun 877 und 06 Sep 885. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. |  König Lothar II. von Lothringen König Lothar II. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_II._(Lothringen) Familie/Ehepartner: Walrada (Maas-Mosel). [Familienblatt] [Familientafel]
Lothar heiratete Theutberga von Arles (von Vienne) (Bosoniden) in Nov 855. Theutberga (Tochter von Graf Boso von Arles (von Italien) (Bosoniden), der Alte ) gestorben in nach 869 in Metz, Abtei Sainte-Glossinde. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: N. (Mutter von Bertha) N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | König Pippin II. von Aquitanien Notizen: 838, Nachfolger seines Vaters als König in Aquitanien |
| 38. | Erzbischof Karl von Mainz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Aquitanien |
| 39. |  Äbtissin Hildegard (Karolinger) Äbtissin Hildegard (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_(Tochter_Ludwigs_des_Deutschen) |
| 40. |  Karlmann (Karolinger) Karlmann (Karolinger) Notizen: English: Carloman of Bavaria Familie/Ehepartner: Liutswind (Liutwind Liutswinda) (Liutpoldinger?). Liutswind gestorben in vor 891. [Familienblatt] [Familientafel]
Karlmann heiratete (Ernste) in vor 861. (Tochter von Ernst I. im Nordgau (Ernste)) gestorben in nach 8 Aug 879. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. |  Äbtissin Bertha (Karolinger) Äbtissin Bertha (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_(Fraumünster) |
| 42. | Ingeltrud von Italien (von Friaul) (Unruochinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ingeltrud Familie/Ehepartner: princeps militiae Heinrich I. (Babenberger/Popponen). Heinrich (Sohn von (Christian?) (Babenberger/Popponen) ) und Heilwig) gestorben am 28 Aug 886 in vor Paris; wurde beigesetzt in St. Médard, Soissons, FR. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Gräfin Judith von Friaul (Unruochinger) Notizen: Es ist schwierig die genaue Situation von Judith herauszufinden. Es führen mich zwei Linien zu ihr mit jeweils zwei verschiedenen Partner, Adalbert II. im Thurgau sowie Anulf I. von Bayern. Dazu habe ich Angaben gefunden wonach sie auch mit einem weiteren Mann, Konrad II. von Burgund mind. ein Kind hatte. Ich finde aber keine Nachweise, dass sie drei Ehemänner hatte. (ms) Judith heiratete Graf Adalbert II. im Thurgau (Hunfriedinger) in cir 864. Adalbert (Sohn von Graf Adalbert I. beider Rätien (Hunfriedinger)) gestorben in zw 903 und 905. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Markgraf Konrad II von Burgund. Konrad gestorben in 881. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzog Arnulf I. von Bayern (Luitpoldinger), der Böse . Arnulf (Sohn von Markgraf Luitpold von Karantanien und Oberpannonien und Kunigunde von Schwaben) gestorben am 14 Jul 937 in Regensburg, DE; wurde beigesetzt in Kloster St. Emmeram, Regensburg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. |  Kaiser Berengar I. von Italien (Unruochinger) Kaiser Berengar I. von Italien (Unruochinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_I. Berengar heiratete Gräfin Bertila von Camerino und Spoleto in cir 880. Bertila (Tochter von Graf Suppo von Camerino und Spoleto) gestorben in 915. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | Prinzessin Judith von Franken Judith heiratete König Ethelwulf (Æthelwulf) von England in 856. Ethelwulf (Sohn von König Egbert III. von Wessex (England) und Redburga) gestorben am 31 Jan 858; wurde beigesetzt in Winchester. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Ethelbald (Æthelbald) von England in 858. Ethelbald (Sohn von König Ethelwulf (Æthelwulf) von England und Osburga (der Yutes)) wurde geboren in cir 834; gestorben in 860. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Graf Balduin I. von Flandern, der Gute in Dez 863 in Auxerre. Balduin gestorben in 879. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. |  König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Der Beiname Stammler des Karolingers Ludwig III hat natürlich nichts mit unserem Familiennamen zu tun. Er bekam diesen weil er Stotterer war. Trotzdem war er scheinbar einer unserer Vorfahren. Familie/Ehepartner: von Rennes (von Bretagne). [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Königin Ansgard von Burgund in Mrz 862, und geschieden in nach 866. Ansgard (Tochter von Graf Harduin von Burgund) gestorben in an einem 02 Nov nach 879. [Familienblatt] [Familientafel]
Ludwig heiratete Gräfin Adelheid von Paris (von Friaul) in 875. Adelheid (Tochter von Pfalzgraf Adalhard von Flavigny (von Paris)) wurde geboren in 850; gestorben am 18 Nov 901 in Laon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | König Karl von Frankreich (Karolinger) |
| 48. | Abt Karlmann von Frankreich (Karolinger) |
| 49. | Abt Lothar von Frankreich (Karolinger) |
| 50. | Äbtissin Ermentrud von Frankreich (Karolinger) |
| 51. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |
| 52. | Gisela von Frankreich (Karolinger) |
| 53. | Äbtissin Rotrud von Frankreich (Karolinger) |
| 54. | Notizen: Gestorben: Rothild heiratete Graf Rotger (Roger) von Maine (Zweites Haus) in Datum unbekannt. Rotger gestorben in vor 31 Okt 900. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Karl von Frankreich (Karolinger) |
| 56. | Herzog Ranulf I. (Rainulf) von Poitou (von Auvergne) (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ramnulf_I._(Poitou) Ranulf heiratete Gräfin Ermengarde? von Maine in cir 845. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. | Graf Eberhard II. von Calw Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | Bernhard (Vermandois) |
| 59. | Pippin (Vermandois) |
| 60. |  Graf Heribert I. von Vermandois (Karolinger) Graf Heribert I. von Vermandois (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_I._(Vermandois) Familie/Ehepartner: Adela von Meaux. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | Pfalzgraf Adalhard von Flavigny (von Paris) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Adalard_of_Paris Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. |  Graf Vulgrin I. von Périgord (von Angoulême) Graf Vulgrin I. von Périgord (von Angoulême) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgrin_I._(Angoulême) Familie/Ehepartner: Regelindis von Septimanien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. | Ermengarde von Italien Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_von_Italien Ermengarde heiratete König Boso von Vienne in zw Mär und Jun 876. Boso (Sohn von Graf Buvinus (Bovin, Bivin) von Metz und Richeut ? von Arles (von Vienne) (Bosoniden)) wurde geboren in zw 825 und 828; gestorben am 11 Jan 887. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. |  Erenfried I. vom Keldachgau Erenfried I. vom Keldachgau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Adelgunde von Burgund. Adelgunde (Tochter von Markgraf Konrad II von Burgund und Gräfin Judith von Friaul (Unruochinger)) wurde geboren in 860 ?; gestorben in 902 ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. |  Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Reginhar, auch Reginar I. genannt, (* um 850; † zwischen dem 25. August 915 und dem 19. Januar 916 in Meerssen) war ein führender fränkischer Großer im nördlichen Lotharingien (Niederlothringen) im 9. und 10. Jahrhundert. Er ist der Begründer der Sippe der Reginare, zu denen auch das bis 1918 regierende Haus Hessen gehört. Familie/Ehepartner: Prinzessin Ermentrud (Irmintrud) von Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Alberada N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. | Hugo von Elsass (von Lothringen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_(Elsass) |
| 67. | Gisela von Nevilles (von Lothringen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gisela_von_Nivelles Familie/Ehepartner: Graf Gottfried in Friesland. Gottfried gestorben in 885 in Herwen, heute Provinz Gelderland, Niederlande). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. | Prinzessin Bertha von Lotharingien Bertha heiratete Graf Diebold (Theotbald) von Arles (Bosoniden) in cir 879. Diebold (Sohn von Herzog Hugbert in Transjuranien (von Arles) (Bosoniden)) wurde geboren in zw 850 und 860; gestorben in 898. [Familienblatt] [Familientafel]
Bertha heiratete Adalbert von Toscana in cir 895. Adalbert gestorben in 915. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 69. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnolf_von_Kärnten Arnolf heiratete (Geliebte des Arnulf von Kärnten) in cir 888. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Ellinrat N.. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Oda (Konradiner?). Oda wurde geboren in cir 873/874 in Velden; gestorben in nach 30 Nov 903. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. | Adalbert (Babenberger/Popponen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_von_Babenberg |
| 71. | Graf Adalhard (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: |
| 72. | Graf Heinrich (Babenberger/Popponen) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. | Hedwig (Hathui, Haduwig) (Babenberger/Popponen) Hedwig heiratete Herzog Otto I. von Sachsen (Liudolfinger) in cir 869. Otto (Sohn von Herzog Liudolf von Sachsen (Liudofinger) und Gräfin Oda Billung) wurde geboren in cir 836; gestorben am 30 Nov 912; wurde beigesetzt in Stift Gandersheim, Bad Gandersheim, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 74. | Markgraf Burkhard I. (Burchard) von Schwaben (in Rätien) (Hunfriedinger / Burchardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20785.php Familie/Ehepartner: Liutgard? von Sachsen?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 75. |  Adalbert von Thurgau (im Zürichgau) Adalbert von Thurgau (im Zürichgau) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Zürichgau Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. | Adelgunde von Burgund Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Erenfried I. vom Keldachgau. Erenfried (Sohn von Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau und Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien) wurde geboren in 855; gestorben in 931. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. | Eberhard von Bayern (Luitpoldinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_(Bayern) Familie/Ehepartner: Liutgard von Lothringen-Verdun ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. |  Arnulf II. von Bayern (Luitpoldinger) Arnulf II. von Bayern (Luitpoldinger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_II._(Bayern) Arnulf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 79. | Graf Heinrich von Radenz und Rangau (Luitpoldinger) Notizen: Interessanter Bericht über die Comitate und Gaue in Franken. Familie/Ehepartner: Herzogin Baba in Sachsen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 80. |  Judith von Bayern Judith von Bayern Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Bayern_(925–985) Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger). Heinrich (Sohn von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 919 und 922; gestorben am 1 Nov 955 in Pöhlde. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. |  Prinzessin Gisela von Italien (von Friaul) (Unruochinger) Prinzessin Gisela von Italien (von Friaul) (Unruochinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friaul Gisela heiratete Markgraf Adalbert von Ivrea, der Reiche in vor 900. Adalbert (Sohn von Markgraf Ansgar von Ivrea) gestorben in zw 923 und 925. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. |  Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_II._(Flandern) Balduin heiratete Prinzessin Elftrude (Ælfthryd) von England in cir 884. Elftrude (Tochter von König Alfred von England, der Grosse und Alswith (Ealhswith) Mucill) gestorben am 7 Jun 929; wurde beigesetzt in Gent (St. Peter). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 83. |  König Ludwig III. von Frankreich (Karolinger) König Ludwig III. von Frankreich (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_III_of_France |
| 84. |  König Karlmann II von Frankreich (Karolinger) König Karlmann II von Frankreich (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Carloman_II |
| 85. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |
| 86. | Prinzessin Ermentrud (Irmintrud) von Frankreich Notizen: Die Verbindung mit Reginar I. gilt nicht als gesichert??? Familie/Ehepartner: Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen. Reginar (Sohn von Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau und Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien) wurde geboren in cir 850; gestorben in zw 25 Aug 915 und 19 Jan 916 in Meerssen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. | Gisla (Gisela) von Frankreich (Karolinger) Familie/Ehepartner: R. von Troyes. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 88. |  König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Über die ehelichen Kinder hinaus hatte Karl uneheliche Kinder, darunter: Karl heiratete Frederuna (Immedinger ?) in vor 19 Apr 907. Frederuna wurde geboren in cir 887; gestorben am 10 Feb 917 in Lothringen. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Prinzessin Edgiva (Eadgifu) von England in zw 917 und 919. Edgiva (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) gestorben in nach 951. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. |  Graf Hugo I. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo I. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Hugo heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. | Graf Ranulf II. von Poitou (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ramnulf_II._(Poitou) Familie/Ehepartner: Ada (Ermengard ?) N.. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Geliebte Ranulf’s. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. | Conrad I. von Calw Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|