
| 1. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Augsburg Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Gräfin Heylwig von Dillingen Notizen: Heylwig stammt aus der Familie des Heiligen Ulrich, also den von Dillingen. Ulrich muss aber nicht ihr Vater sein. Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Hermann I. von Lothringen. Hermann (Sohn von Graf Erenfried II. im Keldachgau und Bonngau und Richwara N.) gestorben in 996. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |  Pfalzgraf Ezzo von Lothringen Pfalzgraf Ezzo von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ezzo_(Lothringen) Ezzo heiratete Prinzessin Mathilde von Deutschland in 992. Mathilde (Tochter von Kaiser Otto II. von Deutschland (Liudolfinger / Ottonen) und Kaiserin Theophanu Skleros) gestorben am 4 Nov 1025; wurde beigesetzt in Kloster Brauweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  Graf Adolf I. von Lothringen (von Nörvenich) Graf Adolf I. von Lothringen (von Nörvenich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Adolf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Kärnten (Salier) ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Das Kloster Nivelles wurde im Jahre 640 von Itta, der Ehefrau Pippins des Älteren, im Gebiet der heutigen Stadt Nivelles, Belgien gegründet. Um dieses Kloster ist eine Siedlung entstanden. Nach dem Tode Gertruds, der ersten Äbtissin und Tochter der Gründerin des Klosters, im Jahre 659 wurde sie zum Wallfahrtsort. |
| 7. | 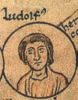 Herr Liudolf (Ludolf) von Brauweiler (von Lothringen) (Ezzonen) Herr Liudolf (Ludolf) von Brauweiler (von Lothringen) (Ezzonen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Ezzonen) Familie/Ehepartner: Mathilde von Zutphen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |  Erzbischof Hermann II. von Lothringen Erzbischof Hermann II. von Lothringen |
| 9. |  Pfalzgraf Otto von Lothringen Pfalzgraf Otto von Lothringen |
| 10. |  Pfalzgräfin Richenza von Lothringen Pfalzgräfin Richenza von Lothringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richeza_(Polen) Richenza heiratete König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) in 1013. Miezislaus (Sohn von König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) und Prinzessin Eminilde von Westslawien) wurde geboren in 990; gestorben am 25 Mrz 1034. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Theophanu von Lothringen Theophanu von Lothringen Notizen: Ehrung: |
| 12. |  Adolf II. im Keldachgau (von Nörvenich) Adolf II. im Keldachgau (von Nörvenich) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Gildegau (früher Keldachgau) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende Pfalzgraf Heinrich I. von Lothringen, der Rasende Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Lothringen Familie/Ehepartner: Mathilde von Niederlothringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige . Berchtold (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)) wurde geboren in cir 1000; gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Adelheid von Brauweiler Adelheid von Brauweiler Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Gottschalk von Zutphen (von Twente). Gottschalk (Sohn von Hermann von Nifterlake) gestorben in cir 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) Notizen: Genannt Odnowiciel (= der Erzerneuerer) Kasimir heiratete Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew in 1043. Dobronega gestorben in 1087. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Prinzessin Richenza (Ryksa) von Polen Notizen: 1052 urkundlich bezeugt. Richenza heiratete König Béla I. von Ungarn (Árpáden) in zw 1039 und 1042. Béla (Sohn von Fürst Vazul (Wasul) von Ungarn (Árpáden) und Anastasia N.) wurde geboren in zw 1015 und 1020; gestorben in 1063. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Prinzessin Gertrud von Polen Gertrud heiratete Grossfürst Isjaslaw I. von Kiew (Rurikiden) in 1043. Isjaslaw (Sohn von Grossfürst Jaroslaw I. von Kiew (Rurikiden), der Weise und Prinzessin Ingegerd (Anna) von Schweden) wurde geboren in 1024; gestorben am 3 Okt 1078; wurde beigesetzt in Kiew. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. |  Hermann IV. von Saffenberg Hermann IV. von Saffenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_IV._von_Saffenberg Familie/Ehepartner: Gepa von Werl. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. |  Pfalzgraf Hermann II. von Lothringen Pfalzgraf Hermann II. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Lothringen) Hermann heiratete Adelheid von Weimar-Orlamünde in cir 1080. Adelheid (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben am 28 Mrz 1100; wurde beigesetzt in Springiersbach. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stammvater der Linie der Markgrafen von Baden. Familie/Ehepartner: Judith. Judith gestorben in 1091 in Salerno, Kampanien, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_II,_Duke_of_Swabia Berthold heiratete Herzogin Agnes von Rheinfelden in 1079. Agnes (Tochter von Herzog Rudolf von Rheinfelden (von Schwaben) und Herzogin Adelheid von Turin (von Maurienne)) wurde geboren in cir 1065 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 19 Dez 1111; wurde beigesetzt in Kloster St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liutgard_von_Zähringen_(Tochter_Berthold_I.) Familie/Ehepartner: Diepold II. von Vohburg (von Giengen). Diepold (Sohn von Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen)) gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Ernst I. von Grögling. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. |  Richinza von Zähringen Richinza von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Rudolf ? von Frickingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Ludwig I. von Sigmaringen, der Ältere . Ludwig gestorben in vor 1092. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Zutphen Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Judith von Arnstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Władysław_I._Herman Władysław heiratete Prinzessin Judith von Böhmen in cir 1080. Judith (Tochter von König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) und Prinzessin Adelheid von Ungarn (Árpáden)) wurde geboren in cir 1057; gestorben am 25 Dez 1085. [Familienblatt] [Familientafel]
Władysław heiratete Judith (Salier) in 1088. Judith (Tochter von Kaiser Heinrich III. (Salier) und Gräfin Agnes von Poitou) wurde geboren in 1054 in Goslar; gestorben in an einem 14 Mär zw 1092 und 1096. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | 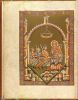 Königin Swatawa von Polen Königin Swatawa von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Swatawa war die erste böhmische Königin. Swatawa heiratete König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) in 1062. Vratislaw (Sohn von Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Herzogin Judith von Schweinfurt) wurde geboren in 1035; gestorben am 14 Jan 1092. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  König Géza I. (Geisa) von Ungarn (Árpáden) König Géza I. (Geisa) von Ungarn (Árpáden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Géza_I. Familie/Ehepartner: Sophie von Looz. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Synadena Synadenos (von Byzanz). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. |  Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) Prinzessin Sophia von Ungarn (Árpáden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_von_Ungarn Sophia heiratete Markgraf Ulrich (Udalrich) von Istrien und Krain (von Weimar) in zw 1062 und 1063. Ulrich (Sohn von Poppo I. von Weimar (von Istrien) und Hadamut (Hadamuot, Azzika) von Istrien-Friaul) gestorben am 5 Mrz 1070. [Familienblatt] [Familientafel]
Sophia heiratete Magnus von Sachsen (Billunger) in 1070/1071. Magnus (Sohn von Ordulf (Otto) von Sachsen (Billunger) und Wulfhild von Norwegen) wurde geboren in cir 1045; gestorben am 23 Aug 1106 in Ertheneburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige Ladislaus I. von Ungarn (Árpáden), der Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Im Jahre 1192 wurde Ladislaus von Papst Coelestin III. heiliggesprochen, Patrozinium ist am 27. Juni. Familie/Ehepartner: Gisela N.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Adelheid von Rheinfelden (von Schwaben). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden) Grossfürst Swjatopolk II. (Michael) von Kiew (Rurikiden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Swjatopolk_II._(Kiew) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | 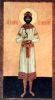 Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow Jaropolk Isjaslawitsch von Wolhynien und Turow Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jaropolk_Isjaslawitsch Familie/Ehepartner: Kunigunde von Weimar-Orlamünde. Kunigunde (Tochter von Otto I. von Weimar-Orlamünde und Adela von Brabant (Löwen)) wurde geboren in cir 1055; gestorben in nach 20.3.1117. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. |  Graf Adalbert von Saffenberg Graf Adalbert von Saffenberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Adalbert von Saffenberg Familie/Ehepartner: Mathilde (Mechthildis). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Markgraf Hermann II. von Baden (* um 1060; † 7. Oktober 1130) begründete erstmals den Titel Markgraf von Baden durch die Titulierung nach dem neuen Herrschaftszentrum auf Burg Hohenbaden (Altes Schloss) in der heutigen Stadt Baden-Baden. Hermann heiratete Judith von Backnang (Hessonen) in cir 1111. Judith (Tochter von Hesso II. von Backnang (Hessonen), der Jüngere und Judith) wurde geboren in cir 1080; gestorben in cir 1123 in Backnang, Baden-Württemberg, DE ; wurde beigesetzt in Grablege im Augustiner-Chorherrenstift in Backnang. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Luitgard von Breisgau |
| 36. |  Graf Rudolf II. von Zähringen Graf Rudolf II. von Zähringen |
| 37. |  Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Zähringen) Familie/Ehepartner: Sofie von Bayern (Welfen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. |  Herzog Konrad I. von Zähringen Herzog Konrad I. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_I,_Duke_of_Z%C3%A4hringen Konrad heiratete Clementia von Namur in cir 1130. Clementia (Tochter von Gottfried von Namur und Ermensinde von Luxemburg) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 28 Dez 1158; wurde beigesetzt in St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Agnes von Zähringen Agnes von Zähringen |
| 40. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen |
| 41. |  Petrissa von Zähringen Petrissa von Zähringen Petrissa heiratete Graf Friedrich I. von Bar-Mümpelgard (von Pfirt) in 1111. Friedrich (Sohn von Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois und Gräfin Ermentrud von Burgund) gestorben in Aug 1160. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Familie/Ehepartner: Gottfried II. von Calw. Gottfried (Sohn von Graf Adalbert II. von Calw und Wiltrud von Niederlothringen) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 6 Feb 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. |  Judith von Zähringen Judith von Zähringen Familie/Ehepartner: Graf Ulrich II. von Gammertingen (Gammertinger). Ulrich (Sohn von Graf Ulrich I. von Gammertingen (Gammertinger) und Adelheid von Kyburg (von Dillingen)) gestorben am 18 Sep 1150 in Kloster Zwiefalten, Zwiefalten, Reutlingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Judith heiratete Egino von Zollern-Urach in Datum unbekannt. Egino (Sohn von Graf Friedrich I. von Zollern und Udilhild von Urach) wurde geboren in cir 1098; gestorben in nach 1134. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. |  Diepold III. von Vohburg Diepold III. von Vohburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Diepold III. von Vohburg Diepold heiratete Adelajda (Adelheid) von Polen in vor 1118. Adelajda (Tochter von Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) und Judith (Salier)) wurde geboren in 1090/91; gestorben in 1127. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Kunigunde von Beichlingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Sophia von Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 45. |  Konrad von Württemberg (von Giengen) Konrad von Württemberg (von Giengen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Giengen_an_der_Brenz Familie/Ehepartner: Hedwig von Spitzenberg-Sigmatingen ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Werntrud. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 46. |  Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?). Heinrich (Sohn von Graf Poppo von Berg (Schelklingen?)) gestorben am 11 Dez 1127?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | Ludwig II. von Sigmaringen (von Spitzenberg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|