
| 1. |  Marie von Schottland gestorben in 1116. Marie von Schottland gestorben in 1116. Familie/Ehepartner: Graf Eustach III. von Boulogne. Eustach (Sohn von Graf Eustach II. von Boulogne und Ida von Lothringen (Boulogne)) gestorben in 1125. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. |  Königin Mathilda von Boulogne (von England) Königin Mathilda von Boulogne (von England) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilda_von_Boulogne (Jun 2022) Mathilda heiratete König Stephan von England (Haus Blois) in 1125. Stephan (Sohn von Stephan II. (Heinrich) von Blois und Adela von England (von der Normandie)) wurde geboren in 1092 in Blois; gestorben am 25 Okt 1154 in Dover, England; wurde beigesetzt in Faversham Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |  Graf Eustach IV. von Boulogne (Blois) Graf Eustach IV. von Boulogne (Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eustach_IV._(Boulogne) (Jun 2017) Eustach heiratete Prinzessin Konstanze (Constance) von Frankreich (Kapetinger) in Feb 1140. Konstanze (Tochter von König Ludwig VI. von Frankreich (Kapetinger), der Dicke und Königin Adelheid von Maurienne (Savoyen)) wurde geboren in cir 1126; gestorben am 16 Aug 1176. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. |  Gräfin Maria von Boulogne (von Blois) Gräfin Maria von Boulogne (von Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Boulogne) Familie/Ehepartner: Graf Matthäus von Elsass (von Flandern). Matthäus (Sohn von Graf Dietrich von Elsass (von Flandern) und Sibylle von Anjou-Château-Landon) wurde geboren in cir 1137; gestorben am 25 Jul 1173 in Normandie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Graf Wilhelm von England (von Blois) Graf Wilhelm von England (von Blois) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_(Boulogne) Wilhelm heiratete Isabel (Elisabeth) de Warenne in 1148. Isabel (Tochter von Graf William de Warenne und Adela (Ela) von Ponthieu (von Montgommery)) wurde geboren in 1136; gestorben am 12 Jul 1203; wurde beigesetzt in Lewes Priory bei Lewes. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | Gräfin Ida von Elsass Anderer Ereignisse und Attribute:
Ida heiratete Gerhard III. von Geldern in 1181. Gerhard (Sohn von Heinrich I. von Geldern und Agnes von Arnstein) gestorben in 1181. [Familienblatt] [Familientafel] Ida heiratete Herzog Berthold (Berchtold) IV. von Zähringen in 1183. Berthold (Sohn von Herzog Konrad I. von Zähringen und Clementia von Namur) wurde geboren in cir 1125; gestorben am 8 Dez 1186. [Familienblatt] [Familientafel] Ida heiratete Graf Rainald I. von Dammartin (Haus Mello) in 1191. Rainald (Sohn von Graf Aubry II. (Alberich) von Dammartin (Haus Mello) und Mathilde (Mathildis, Mahaut, Mabile) von Clermont) wurde geboren in cir 1165; gestorben in 1227. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Mathilda von Elsass (von Flandern) Mathilda von Elsass (von Flandern) Mathilda heiratete Herzog Heinrich I. von Brabant (Löwen) in 1179. Heinrich (Sohn von Gottfried III. von Löwen und Margarete von Limburg) wurde geboren in cir 1165; gestorben am 5 Sep 1235 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |  Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) Gräfin Mathilde von Dammartin (Haus Mello) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_von_Dammartin Mathilde heiratete Prinz Philipp Hurepel von Frankreich (Kapetinger) in cir 1218. Philipp (Sohn von König Philipp II. August von Frankreich (Kapetinger) und Agnes-Maria von Andechs (von Meranien)) wurde geboren in cir 1200; gestorben in Jan 1234. [Familienblatt] [Familientafel] Mathilde heiratete König Alfons III. von Portugal in cir 1235. Alfons (Sohn von König Alfons II. von Portugal, der Dicke und Prinzessin Urraca von Kastilien (von Portugal)) wurde geboren am 5 Mai 1210 in Coimbra; gestorben am 16 Feb 1279 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. |  Margareta von Brabant Margareta von Brabant Margareta heiratete Graf Gerhard IV von Geldern in 1206 in Löwen, Brabant. Gerhard (Sohn von Graf Otto I. von Geldern und Richardis von Scheyern-Wittelsbach (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1185; gestorben am 22 Okt 1229; wurde beigesetzt in Münsterkirche, Roermond, Holland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |  Mathilde von Brabant Mathilde von Brabant Mathilde heiratete Graf Florens (Floris) IV. von Holland (von Zeeland) (Gerulfinger) in 1224. Florens (Sohn von Graf Wilhelm I. von Holland (Gerulfinger) und Adelheid von Geldern) wurde geboren am 24 Jun 1210; gestorben am 13 Jul 1234. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) Herzog Heinrich II. von Brabant (von Löwen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Brabant) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Marie von Schwaben (Staufer). Marie (Tochter von König Philipp von Schwaben (Staufer) und Irene (Maria) von Byzanz) wurde geboren in 1201; gestorben in 1235. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Herzogin Sophie von Brabant (von Thüringen). Sophie (Tochter von Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der Heilige und Elisabeth von Thüringen (von Ungarn)) wurde geboren am 30 Mrz 1224 in Wartburg oder der Creuzburg in Thüringen; gestorben am 29 Mai 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. |  Elisabeth von Brabant Elisabeth von Brabant Elisabeth heiratete Dietrich primogenitus von Kleve in 1233. Dietrich (Sohn von Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve und Nicht klar ?) wurde geboren in cir 1214/15. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  Graf Otto II von Geldern, der Lahme Graf Otto II von Geldern, der Lahme Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Otto II. von Geldern (* um 1215; † 10. Januar 1271; genannt der Lahme) war Graf von Geldern vom 22. Oktober 1229 bis zu seinem Tod. Otto heiratete Margarete von Kleve in Datum unbekannt. Margarete (Tochter von Graf Dietrich IV. (VI.) von Kleve und Nicht klar ?) gestorben am 10 Sep 1251. [Familienblatt] [Familientafel]
Otto heiratete Philippa von Dammartin (von Ponthieu) in Datum unbekannt. Philippa gestorben in 1277/81. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. |  Richarda von Geldern Richarda von Geldern Richarda heiratete Graf Wilhelm IV von Jülich in spätestens 1251/1252. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm III. von Jülich) wurde geboren in 1210; gestorben am 16 Mrz 1278 in Aachen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) Graf Wilhelm II. von Holland (Gerulfinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Holland Familie/Ehepartner: Elisabeth von Lüneburg (von Braunschweig). Elisabeth (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1230; gestorben am 27 Mai 1266. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Adelheid von Holland Adelheid von Holland Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Holland Adelheid heiratete Johann von Hennegau (von Avesnes) in 1246. Johann (Sohn von Burkhard von Avesnes und Gräfin Margarethe I. von Hennegau (II. von Flandern), die Schwarze ) wurde geboren am 1 Mai 1218 in Houffalize, Wallonien; gestorben am 24 Dez 1257. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  Margarete von Holland (von Henneberg) Margarete von Holland (von Henneberg) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Henneberg Margarete heiratete Graf Hermann I. von Henneberg-Coburg in Pfingsten 1249. Hermann (Sohn von Graf Poppo VII. von Henneberg und Jutta von Thüringen (Ludowinger)) wurde geboren in 1224; gestorben am 18 Dez 1290. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Mathilde und Robert I. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Mathilde heiratete Robert I. von Artois (von Frankreich) am 14 Jun 1237 in Compiègne, Frankreich. Robert (Sohn von König Ludwig VIII. von Frankreich, der Löwe und Königin Blanka von Kastilien) wurde geboren am 17 Sep 1216; gestorben am 8 Feb 1250 in Al-Mansura. [Familienblatt] [Familientafel]
Mathilde heiratete Graf Guido II. (Guy) von Châtillon (Blois) am cir Mai 1254 in Neapel, Italien. Guido (Sohn von Graf Hugo I. (V.) von Châtillon-Saint Pol und Gräfin Maria von Avesnes) gestorben am 12 Feb 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. |  Herzogin Maria von Brabant Herzogin Maria von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Maria hatte mit Ludwig II. keine Kinder. Maria heiratete Herzog Ludwig II. von Bayern (Wittelsbacher), der Strenge am 2 Aug 1254. Ludwig (Sohn von Herzog Otto II. von Bayern (Wittelsbacher) und Agnes von Braunschweig) wurde geboren am 13 Apr 1229 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 2 Feb 1294 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | 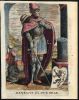 Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige Herzog Heinrich III. von Brabant (von Löwen), der Gütige Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(Brabant) Heinrich heiratete Adelheid von Burgund in 1251. Adelheid (Tochter von Herzog Hugo IV. von Burgund und Yolande von Dreux) wurde geboren in 1233; gestorben in 1273. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Heinrich I. von Hessen (von Brabant) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Heinrich I. von Hessen (* 24. Juni 1244; † 21. Dezember 1308 in Marburg) war erster Landgraf von Hessen und Begründer des hessischen Fürstenhauses. Heinrich heiratete Adelheid von Lüneburg (von Braunschweig) am 10 Sep 1263. Adelheid (Tochter von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) gestorben am 12 Jun 1274 in Marburg an der Lahn, Hessen. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Mechtild von Kleve in cir 1275. Mechtild (Tochter von Graf Dietrich V. (VII.) von Kleve und Aleidis (Alheidis) von Heinsberg (Haus Sponheim)) gestorben am 21 Dez 1309. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. |  Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth von Brabant (von Löwen) Elisabeth heiratete Herzog Albrecht I. von Braunschweig-Lüneburg (Welfen), der Große am 13 Jul 1254. Albrecht (Sohn von Herzog Otto I. von Lüneburg (von Braunschweig) (Welfen), das Kind und Herzogin Mechthild von Brandenburg) wurde geboren in 1236; gestorben am 15 Aug 1279. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Familie/Ehepartner: Graf Gerhard von Durbuy. Gerhard wurde geboren in 1223; gestorben in cir 1303. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. |