
| 1. |  Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) wurde geboren in 1276; gestorben in 1318. Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (Welfen) wurde geboren in 1276; gestorben in 1318. Notizen: Mechthild und Heinrich III. hatten neun Kinder, fünf Söhne und vier Töchter. Mechthild heiratete Herzog Heinrich III. von Glogau in 1290. Heinrich (Sohn von Herzog Konrad II. von Glogau (von Schlesien) (Piasten) und Salome von Polen) wurde geboren in zw 1251 und 1260; gestorben am 9 Dez 1309. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. |  Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) Herzog Heinrich IV. von Glogau (von Sagan) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(Glogau) Heinrich heiratete Mathilde von Brandenburg in 1310. Mathilde (Tochter von Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange und Anna von Habsburg) gestorben in 1323. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |  Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) Herzog Konrad I. von Oels (von Glogau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Oels) (Okt 2017) Konrad heiratete Elisabeth von Breslau (von Schlesien) (Piasten) in 1322. Elisabeth (Tochter von Herzog Heinrich VI. von Breslau (von Schlesien) (Piasten) und Anna von Habsburg) gestorben in 1328. [Familienblatt] [Familientafel] Konrad heiratete Euphemia von Beuthen (von Cosel) (Piasten) in vor 1333. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  Herzogin Agnes von Glogau Herzogin Agnes von Glogau Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Agnes und Otto III. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Agnes heiratete König Otto III. (Béla V.) von Bayern (Wittelsbacher) am 18 Mai 1309. Otto (Sohn von Herzog Heinrich XIII. von Bayern (Wittelsbacher) und Elisabeth von Ungarn) wurde geboren am 11 Feb 1261; gestorben am 9 Sep 1312 in Landshut, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche Seligenthal. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |  Katharina von Glogau Katharina von Glogau Katharina heiratete Markgraf Johann V. von Brandenburg in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Markgraf Hermann (III.) von Brandenburg, der Lange und Anna von Habsburg) wurde geboren in Aug 1302; gestorben in Apr 1317 in Spandau. [Familienblatt] [Familientafel] Katharina heiratete Graf Johann III. von Holstein-Kiel (Schauenburg) in Datum unbekannt. Johann (Sohn von Graf Gerhard II. von Holstein (von Plön), der Blinde und Agnes (Agnete) von Brandenburg) wurde geboren in cir 1297; gestorben am 27 Sep 1359. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. |  Herzog Heinrich V. von Sagan (von Glogau), der Eiserne Herzog Heinrich V. von Sagan (von Glogau), der Eiserne Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(Glogau-Sagan) (Feb 2022) Heinrich heiratete Anna von Płock in 1337. Anna (Tochter von Herzog Wacław von Płock und Elisabeth von Litauen) gestorben in 1363. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |  Agnes von Glogau-Sagan Agnes von Glogau-Sagan Agnes heiratete Herzog Ludwig I. von Liegnitz-Brieg in zw 1341 und 1345. Ludwig (Sohn von Herzog Bolesław III. von Schlesien (Piasten) und Margarethe von Böhmen) wurde geboren in zw 1313 und 1321; gestorben in 1398. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |  Hedwig von Oels (von Glogau) Hedwig von Oels (von Glogau) Hedwig heiratete Herzog Nikolaus II. von Troppau in 1342/1345. Nikolaus (Sohn von Herzog Nikolaus I. von Troppau und Adelheid von Habsburg) wurde geboren in cir 1288; gestorben am 8 Dez 1365. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. |  Agnes von Bayern Agnes von Bayern Familie/Ehepartner: Heinrich IV. von Ortenburg. Heinrich (Sohn von Graf Heinrich III. von Ortenburg und Sophie von Henneberg-Aschach) gestorben am 8 Apr 1395. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. |  Agnes von Holstein Agnes von Holstein Agnes heiratete Herzog Erich II. von Sachsen-Lauenburg (Askanier) in 1342/1349. Erich (Sohn von Herzog Erich I. von Sachsen-Lauenburg (Askanier) und Elisabeth von Pommern (Greifen)) wurde geboren in 1318/1320; gestorben in 1368. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Mechthild von Holstein-Kiel (Schauenburg) Mechthild von Holstein-Kiel (Schauenburg) Mechthild heiratete Herr Nikolaus III. von Werle-Güstrow in nach 1341. Nikolaus (Sohn von Herr Johann II. von Werle-Güstrow und Mathilde (Mechthild) von Braunschweig) wurde geboren in nach 1311; gestorben in vor 1333 od 1337; wurde beigesetzt in Doberaner Münster. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. |  Elisabeth von Holstein-Kiel (Schauenburg) Elisabeth von Holstein-Kiel (Schauenburg) Elisabeth heiratete Herr Bernhard II. von Werle-Güstrow in 1341. Bernhard (Sohn von Herr Johann II. von Werle-Güstrow und Mathilde (Mechthild) von Braunschweig) wurde geboren in cir 1320; gestorben in zw 16 Jan und 13 Apr 1382. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |  Miroslawa von Holstein-Plön Miroslawa von Holstein-Plön Miroslawa heiratete Herzog Otto I. von Braunschweig-Göttingen am 19 Nov 1357. Otto (Sohn von Ernst I. von Braunschweig-Göttingen und prinzessin Elisabeth von Hessen) wurde geboren in cir 1330; gestorben am 13 Dez 1394 in Hardegsen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. |  Herzog Heinrich VIII. von Sagan (von Glogau) Herzog Heinrich VIII. von Sagan (von Glogau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VIII._(Glogau) Heinrich heiratete Katharina von Oppeln in zw 1382 und 1388. Katharina (Tochter von Wladislaus II. von Oppeln und Elisabeth von Bessarabien) gestorben in 1420. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Prinzessin Hedwig von Sagan (von Glogau) Prinzessin Hedwig von Sagan (von Glogau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Hedwig heiratete König Kasimir III. von Polen (Piasten) in 1368. Kasimir (Sohn von König Władysław I. von Polen (Piasten), Ellenlang und Herzogin Hedwig von Kalisch) wurde geboren am 30 Apr 1310 in Kowal; gestorben am 5 Nov 1370 in Krakau, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]
Hedwig heiratete Herzog Ruprecht I. von Liegnitz (Piasten) am 10 Feb 1372. Ruprecht (Sohn von Herzog Wenzel I. von Liegnitz und Anna von Teschen) wurde geboren am 27 Mrz 1347; gestorben in 1409; wurde beigesetzt in Liegnitz . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Margarete von Liegnitz-Brieg Margarete von Liegnitz-Brieg Notizen: Name: Margarete heiratete Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) am 19 Jul 1353 in Passau. Albrecht (Sohn von Kaiser Ludwig IV. von Bayern (Wittelsbacher), der Bayer und Margarethe von Hennegau (von Holland)) wurde geboren am 25 Jul 1336 in München, Bayern, DE; gestorben am 16 Dez 1404 in Den Haag, Holland; wurde beigesetzt in Hofkapelle in Den Haag. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. |  Hedwig von Liegnitz-Brieg Hedwig von Liegnitz-Brieg Notizen: Name: Hedwig heiratete Herzog Johann II. von Teschen-Auschwitz in vor 1367. Johann wurde geboren in vor 1350; gestorben in 1376. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |  Herzog Erich IV. von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Herzog Erich IV. von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_IV._(Sachsen-Lauenburg) (Aug 2023) Erich heiratete Sophie von Braunschweig-Lüneburg am 8 Apr 1373. Sophie (Tochter von Fürst Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel und Katharina von Anhalt (von Bernburg)) wurde geboren in 1358; gestorben in 1416. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. |  Mechthild von Werle-Waren Mechthild von Werle-Waren Mechthild heiratete Herzog Heinrich III. von Mecklenburg am 26 Feb 1377. Heinrich (Sohn von Herzog Albrecht II. von Mecklenburg und Herzogin Eufemia (Euphemia) Eriksdotter) wurde geboren in cir 1337; gestorben am 24 Apr 1383 in Schwerin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. |  Herzog Johann I. von Sagan (von Glogau) Herzog Johann I. von Sagan (von Glogau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Sagan) Johann heiratete Scholastika von Sachsen-Wittenberg (Askanier) in zw 1405 und 1409. Scholastika (Tochter von Herzog Rudolf III. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Anna von Meissen) gestorben in 1462/63. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Anna von Polen (Piasten) Anna von Polen (Piasten) Familie/Ehepartner: Wilhelm von Cilli. Wilhelm wurde geboren in 1361; gestorben in 1392. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Barbara von Liegnitz (Piasten) Barbara von Liegnitz (Piasten) Barbara heiratete Herzog Rudolf III. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) am 6 Mrz 1396. Rudolf (Sohn von Herzog Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Cäcilia (Siliola) von Carrara) wurde geboren in 1373 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE; gestorben am 11 Jun 1419 in Böhmen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. |  Margarete von Bayern (Wittelsbacher) Margarete von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: Margarete und Johann Ohnefurcht hatten acht Kinder, sieben Töchter und einen Sohn. Sieben der acht Kinder aus dieser Ehe erreichten das heiratsfähige Alter. Margarete heiratete Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht am 12 Apr 1385 in Cambrai. Johann (Sohn von Herzog Philipp II. von Burgund (Valois), der Kühne und Gräfin Margarete III. von Flandern) wurde geboren am 28 Mai 1371 in Dijon, Frankreich; gestorben am 10 Sep 1419 in Montereau-Fault-Yonne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. |  Johanna Sophie von Bayern (Wittelsbacher) Johanna Sophie von Bayern (Wittelsbacher) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Sophie_von_Bayern Johanna heiratete Reichsfürst Albrecht IV. von Österreich (Habsburg) am 24 Apr 1390 in Wien. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht III. von Österreich (von Habsburg), mit dem Zopf und Beatrix von Nürnberg (Hohenzollern)) wurde geboren am 19/20 Sep 1377 in Wien; gestorben in 25 Aug oder 14 Sep 1404 in bei Znaim oder auf dem Weg nach Wien; wurde beigesetzt in Fürstengruft des Stephansdoms in Wien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. |  Anna von Teschen-Ausschwitz Anna von Teschen-Ausschwitz Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Puta der Ältere von Častolowitz. Puta gestorben in 1397. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. |  Katharina von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Katharina von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Sachsen-Lauenburg (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Herr Johann VII. von Werle-Güstrow. Johann (Sohn von Lorenz von Werle-Güstrow und Mechthild von Werle-Goldberg) wurde geboren in cir 1375; gestorben in zw 14 Aug und 17 Dez 1414. [Familienblatt] [Familientafel] Katharina heiratete Herzog Johann IV. von Mecklenburg in 1416. Johann (Sohn von Herzog Magnus I. von Mecklenburg und Prinzessin Elisabeth von Pommern-Wolgast) wurde geboren in cir 1378; gestorben am 16 Okt 1422 in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. |  Herzog Johann II. von Sagan Herzog Johann II. von Sagan Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Sagan) Familie/Ehepartner: Katharina von Troppau. Katharina (Tochter von Herzog Wilhelm von Troppau und Salome von Častolowitz) wurde geboren in 1443; gestorben in 1505. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |  Anna von Cilli Anna von Cilli Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Anna und Władysław II. hatten eine Tochter. |
| 29. |  Barbara von Sachsen (von Wittenberg) Barbara von Sachsen (von Wittenberg) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_von_Sachsen-Wittenberg (Aug 2023) Barbara heiratete Markgraf Johann von Brandenburg in 1416. Johann (Sohn von Kurfürst Friedrich I. (VI.) von Brandenburg (von Nürnberg) (Hohenzollern) und Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), die Schöne Else ) wurde geboren in 1406; gestorben am 16 Nov 1464 in Baiersdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Maria von Burgund Maria von Burgund Notizen: Maria und Adolf II. hatten zehn Kinder, sieben Töchter und drei Söhne. Maria heiratete Herzog Adolf II. von Kleve-Mark in 1406. Adolf (Sohn von Graf Adolf III von der Mark (von Kleve) und Margarethe von Berg) wurde geboren am 2 Aug 1373; gestorben am 23 Sep 1448; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster, Graveinsel, Wesel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Liste der Herrscher von Burgund: Philipp heiratete Prinzessin Michelle von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) in Jun 1409 in Paris, France. Michelle (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 11 Jan 1395 in Paris, France; gestorben am 8 Jul 1422 in Gent; wurde beigesetzt in St.-Bavo-Kathedrale in Gent. [Familienblatt] [Familientafel] Philipp heiratete Bonne (Bona) von Artois am 30 Nov 1424. Bonne (Tochter von Graf Philipp von Artois und Herzogin Marie von Berry (Valois, Auvergne)) wurde geboren in cir 1396; gestorben am 17 Sep 1425 in Dijon, Frankreich; wurde beigesetzt in Chartreuse de Champmol bei Dijon. [Familienblatt] [Familientafel] Philipp heiratete Isabel von Portugal (Avis) am 25 Jul 1429 in Ferntrauung. Isabel (Tochter von Johann I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Philippa von Lancaster) wurde geboren am 21 Feb 1397 in Évora; gestorben am 17 Dez 1471 in Dijon, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | 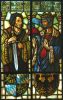 Margarete von Österreich Margarete von Österreich Margarete heiratete Herzog Heinrich XVI. von Bayern (von Landshut) (Wittelsbacher) am 25 Nov 1412 in Landshut, Bayern, DE. Heinrich (Sohn von Herzog Friedrich von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), der Weise und Maddalena Visconti) wurde geboren in 1386 in Burg, Burghausen, DE; gestorben am 30 Jul 1450 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. |  König Albrecht II. von Österreich (Habsburg) König Albrecht II. von Österreich (Habsburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._(HRR) (Okt 2017) Albrecht heiratete Elisabeth von Luxemburg am 28 Sep 1421 in Prag, Tschechien . Elisabeth (Tochter von König Sigismund von Luxemburg (von Ungarn) und Barbara von Cilli) wurde geboren am 28 Feb 1409 in Prag, Tschechien ; gestorben am 19 Dez 1442 in Győr; wurde beigesetzt in Basilika St. Stephan, Stuhlweißenburg (Székesfehérvár). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. |  Puta der Jüngere von Častolowitz Puta der Jüngere von Častolowitz Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Puta_der_Jüngere_von_Častolowitz Puta heiratete Anna von Kolditz in 1396. Anna (Tochter von Albrecht von Kolditz) gestorben in 1467. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. |  Herzog Heinrich IV. von Mecklenburg Herzog Heinrich IV. von Mecklenburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(Mecklenburg) Heinrich heiratete Dorothea von Brandenburg in Mai 1432. Dorothea (Sohn von Kurfürst Friedrich I. (VI.) von Brandenburg (von Nürnberg) (Hohenzollern) und Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), die Schöne Else ) wurde geboren in 1420; gestorben in 1491. [Familienblatt] [Familientafel]
|