| 16. | 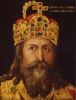 Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne  (14.Bertrada5, 11.Heribert4, 6.Bertrada3, 3.Theuderich2, 1.Bathilde1) wurde geboren am 2 Apr 747; gestorben am 28 Jan 814 in Aachen, Deutschland; wurde beigesetzt in Pfalzkapelle, Aachen. (14.Bertrada5, 11.Heribert4, 6.Bertrada3, 3.Theuderich2, 1.Bathilde1) wurde geboren am 2 Apr 747; gestorben am 28 Jan 814 in Aachen, Deutschland; wurde beigesetzt in Pfalzkapelle, Aachen. Anderer Ereignisse und Attribute:
- Englischer Name: Charlemagne or Charles the Great
- Französischer Name: Charlemagne ou Charles I. dit le Grand
- Titel (genauer): König des Fränkischen Reichs (von 768 bis 814, bis 771 gemeinsam mit seinem Bruder Karlmann), Römischer Kaiser (ab 800)
- Titel (genauer): King of the Franks (from 768), King of the Lombards (from 774), Holy Roman Emperor (from 800).
- Titel (genauer): Roi des Francs (à partir de 768), Roi des Lombards (à partir 774), Empereur romain (à partir 800).
Notizen:
English: Charlemagne or Charles the Great, numbered Charles I
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
Français: Charlemagne ou Charles Ier dit le Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
Latin: Carolus Magnus
Karl der Große (lateinisch Carolus Magnus oder Karolus Magnus, französisch und englisch Charlemagne; * wahrscheinlich 2. April 747 oder 748;[1] † 28. Januar 814 in Aachen) war von 768 bis 814 König des Fränkischen Reichs (bis 771 gemeinsam mit seinem Bruder Karlmann). Er erlangte am 25. Dezember 800 als erster westeuropäischer Herrscher seit der Antike die Kaiserwürde, die mit ihm erneuert wurde. Der Enkel des Hausmeiers Karl Martell war der bedeutendste Herrscher aus dem Geschlecht der Karolinger. Das Frankenreich gelangte unter ihm zu seiner größten Ausdehnung und Machtentfaltung.
Karl gelang es, seine Macht im Frankenreich zu sichern und es in einer Reihe von Feldzügen nach außen erheblich zu erweitern. Besonders verlustreich und erbittert geführt waren die mit Unterbrechungen von 772 bis 804 andauernden Sachsenkriege. DDeren Ziel war die Eroberung und erzwungene Christianisierung Sachsens. Karl griff auch in Italien ein und eroberte 774 das Langobardenreich. Ein gegen die Mauren in Nordspanien gerichteter Feldzug im Jahr 778 scheiterte dagegen. Im Osten seines Reiches beendete er 788 die Selbstständigkeit des Stammesherzogtums Bayern und eroberte in den 790er Jahren das Restreich der Awaren. Die Grenzen im Osten gegen die Dänen und Slawenstämme sowie im Südwesten gegen die Mauren wurden durch die Einrichtung von Marken gesichert. Das Frankenreich stieg zur neuen Großmacht neben Byzanz und dem Abbasidenkalifat auf. Es umfasste den Kernteil der frühmittelalterlichen lateinischen Christenheit und war das bis dahin bedeutendste staatliche Gebilde im Westen seit dem Fall Westroms.
Karl sorgte für eine effektive Verwaltung und bemühte sich um eine umfassende Bildungsreform, die eine kulturelle Neubelebung des Frankenreichs zur Folge hatte. Politischer Höhepunkt seines Lebens war die Kaiserkrönung durch Papst Leo III. zu WeWeihnachten des Jahres 800. Sie schuf die Grundlage für das westliche mittelalterliche Kaisertum. Sowohl in der Reihe der römisch-deutschen Kaiser als auch der französischen Könige wird er als Karl I. gezählt. Seine Hauptresidenz Aachen blieb bis ins 16. Jahrhundert Krönungsort der römisch-deutschen Könige.
1165 wurde er von Gegenpapst Paschalis III. heiliggesprochen; der Gedenktag in der katholischen und evangelischen Kirche ist der 28. Januar. Karl gilt als einer der bedeutendsten mittelalterlichen Herrscher und als einer der wichtigsten Herrscher im europäischen Geschichtsbewusstsein; bereits zu Lebzeiten wurde er Pater Europae („Vater Europas“) genannt. In Belletristik und Kunst wurde sein Leben wiederholt thematisiert, wobei das jeweils zeitgenössische Geschichtsbild den Ausgangspunkt bildete.
Kindheit und Jugend
Karl stammte aus der heute als Karolinger bezeichneten Familie, die zwar erst seit 751 die fränkische Königswürde innehatte, aber bereits in den Jahrzehnten zuvor die bestimmende Macht am Königshof war. Ihr Aufstieg begann im 7. Jahrhundert und resultierte aus der zunehmenden Schwäche des Königtums der Merowinger, wobei die wahre Macht zunehmend in die Hände der Hausmeier überging.[2] Diese waren ursprünglich nur Verwalter des Königshofes gewesen, gewannen aber im Laufe der Zeit immeer mehr Einfluss. Eine wichtige Rolle spielten bereits im 7. Jahrhundert die Arnulfinger und Pippiniden, die Vorfahren der späteren Karolinger. Ihre Machtbasis lag im östlichen Reichsteil Austrasien.[3] Seit der Zeit Pippins des Mittleren und von dessen Sohn Karl Martell bestimmten sie endgültig die fränkische Reichspolitik.[4] Auf Karl Martell geht auch die spätere Bezeichnung der Familie als „Karolinger“ zurück.[5]
Karl der Große war der älteste Sohn Pippins des Jüngeren, des fränkischen Hausmeiers und (seit 751) Königs, und dessen Frau Bertrada. Als Tag seiner Geburt steht der 2. April fest, der in einem aus dem 9. Jahrhundert stammenden Kalender des Klosters Lorsch festgehalten wurde. Das Geburtsjahr hingegen ist in der Forschung lange umstritten gewesen. Inzwischen wird aufgrund einer genaueren Quellenauswertung für das Jahr 747[6] bzw. 748 plädiert.[7] Der Geburtsort ist hingegen völlig unbekannt, alle Bestimmungsversuche sind spekulativ.[8]
751 kam Karls Bruder Karlmann zur Welt, 757 folgte seine Schwester Gisela († 810), die 788 Äbtissin von Chelles wurde. Auffallend sind die Namen, die Pippin seinen Söhnen gab. Wenngleich sie auf die Namen von Pippins Vater (Karl) und Bruder (Kararlmann) zurückzuführen sind, standen sie ansonsten isoliert in der Namensgebung der Arnulfinger-Pippiniden. Sie waren auch nicht an der merowingischen Namensgebung orientiert wie die Namen späterer karolingischer Könige (Chlotar wurde zu Lothar, Chlodwig zu Ludwig). Vermutlich wollte Pippin so das neue Selbstbewusstsein seines Hauses illustrieren.[9]
Die von Karls Vertrautem Einhard verfasste Biographie – heute oft als Vita Karoli Magni bezeichnet – stellt neben den sogenannten Annales regni Francorum (Reichsannalen) die Hauptquelle für Karls Leben dar, doch übergeht sie die Kindheit, über die fast nichts bekannt ist.[10] Die moderne Forschung kann ebenfalls nur wenige konkrete Aussagen über die faktisch „unbekannte Kindheit“ Karls machen.[11]
Zu Beginn des Jahres 754 überquerte Papst Stephan II. die Alpen und begab sich ins Frankenreich. Grund für diese Reise waren die zunehmenden Übergriffe des Langobardenkönigs Aistulf, der 751 das Exarchat von Ravenna erobert hatte. Formal unterstand dieser Raum der Herrschaftsgewalt des byzantinischen Kaisers, doch Konstantin V., der militärisch erfolgreich an der byzantinischen Ostgrenze gegen die Araber kämpfte und dort gebunden war, verzichtete zu dieser Zeit auf ein Eingreifen im Westen. Daraufhin wandte sich Stephan an den mächtigsten westlichen Herrscher und versuchte Pippin zu einem Eingreifen zu überreden.[12]
Die Anwesenheit des Papstes nördlich der Alpen erregte Aufsehen, denn es war das erste Mal, dass sich ein Bischof von Rom ins Frankenreich begab. Beim Treffen in der Pfalz von Ponthion trat der Papst als Hilfesuchender auf. Pippin ging mit ihm ein Freundschaftsbündnis (amicitia) ein und sagte ihm Unterstützung gegen die Langobarden zu. Von dem Bündnis profitierte auch Pippin, der erst seit 751 die fränkische Königswürde bekleidete, nachdem er den machtlosen letzten Merowingerkönig Childerich III. entthront hatte. Das Bündnis mit dem Papst half Pippin bei der Legitimierung seines Königtums, gleichzeitig wurden die Frankenkönige zu den neuen Schutzherren des Papstes in Rom, was für die weitere Entwicklung weitreichende Folgen hatte. Bei einem weiteren Treffen mit dem Papst zu Ostern 754 in Quierzy konnte Pippin das fränkische Eingreifen in Italien verkünden und garantierte dem Papst mehrere (auch ehemalige byzantinische) Territorien in Mittelitalien, die sogenannte Pippinische Schenkung, welche die Grundlage für den späteren Kirchenstaat bildete. Eine konkrete päpstliche Gegenleistung folgte bereits kurz darauf, denn noch im Jahr 754 wurden Pippin sowie seine beiden Söhne von Stephan II. in Saint-Denis zu Königen der Franken gesalbt, womit das neue karolingische Königtum zusätzlich einen sakralen Charakter erhielt.[13] Alle drei erhielten zudem vom Papst den hohen römischen Ehrentitel Patricius.[14] Kurz darauf intervenierte Pippin erfolgreich in Italien zugunsten des Papstes, was allerdings auf den Widerstand der Byzantiner traf, da sie dies als Eingreifen in ihren Herrschaftsraum betrachteten.[15]
In den Quellen finden sich noch weitere vereinzelte Hinweise auf Karls Jugend. Neben Erwähnungen in Fürbitten für die Familie im Namen Pippins wird Karl in den Urkunden seines Vaters zweimal namentlich genannt, wobei es um seine amtliche Handlungsfähigkeit geht. 763 scheint Pippin seinen Söhnen zudem mehrere Grafschaften übertragen zu haben.[16]
Des Weiteren sind zumindest einige allgemeine Rückschlüsse auf Karls Jugend und Erziehung möglich. Es ist davon auszugehen, dass bei seiner Erziehung nicht nur auf die übliche fränkische Kriegerausbildung, die für einen König als Heerführer essentiell war, sondern auch auf eine gewisse Bildung Wert gelegt wurde. Ob ihm damals das volle Programm der septem artes liberales, der sieben freien Künste, vermittelt wurde, um dessen Wiederherstellung er sich später im Rahmen seiner Bildungsreform bemühte, ist unklar und wird in der Forschung unterschiedlich eingeschätzt.[17] Karl sprach von Hause aus Fränkisch, er erhielt jedoch sicher Lateinunterricht. Bereits in der Merowingerzeit war eine gewisse Bildung für hochstehende Adelige keineswegs ungewöhnlich gewesen.[18] Obwohl das Bildungsniveau im 8. Jahrhundert gesunken war, war Latein am Hof, in der Verwaltung und im Gottesdienst allgegenwärtig. Anders als manch einer der späteren ostfränkischen bzw. römisch-deutschen Könige hat Karl das Lateinische offenbar auch verstanden. Einhard zufolge sprach er es wie seine Muttersprache,[19] was eine Übertreibung sein mag. Er dürfte zudem über Lesekenntnisse des Lateinischen verfügt haben.[20] Karl war jedenfalls ein für damalige Verhältnisse recht gebildeter Herrscher und sein Leben lang an Bildung interessiert.[21]
Herrschaftsantritt
König Pippin verbrachte die letzten Jahre seiner Regierungszeit damit, die Randgebiete des Frankenreichs zu sichern. Er führte Feldzüge in das ehemals westgotische Septimanien und eroberte 759 Narbonne, den letzten arabischen Vorposten nördlich der Pyrenäen.[22] Pippins Neffe Tassilo III. bewahrte sich in Baiern eine gewisse Eigenständigkeit. Aquitanien hingegen wurde 768 nach mehreren Feldzügen in das Frankenreich eingegliedert.
Auf dem Rückweg aus Aquitanien erkrankte Pippin im Juni 768 ernsthaft, woraufhin er sein Erbe zu regeln begann.[23] Am 24. September 768 verstarb er in Saint-Denis.[24] Kurz vor seinem Tod hatte er verfügt, dass das Reich unter seinen Söhnen Karl und Karlmann aufgeteilt werden sollte. Einhard zufolge orientierte sich die Teilung an der vorherigen Teilung von 741 zwischen Karl Martells Söhnen,[25] doch deckte sie sich keineswegs mit dieser. Karl erhielt Austrasien, den Großteil Neustriens und den Westen Aquitaniens, Karlmann das restliche Aquitanien, Burgund, die Provence, Septimanien, das Elsass und Alamannien. Baiern war von der Erbteilung ausgeschlossen und blieb faktisch selbstständig.[26] Damit umschloss Karls Reich das seines Bruders halbkreisartig im Westen und Norden. Am 9. Oktober 768, dem Gedenktag des Dionysius von Paris, wurde jeder der Brüder in seinem Reichsteil zum König gesalbt, Karl in Noyon und Karlmann in der alten merowingischen Residenz Soissons.[27]
Karl und Karlmann übten keineswegs eine gemeinsame Herrschaft über das Frankenreich aus, sondern regierten in ihren jeweiligen Reichen unabhängig voneinander, was sich an ihren Urkunden ablesen lässt.[28] Ihr Verhältnis scheint von Beginn an anggespannt gewesen zu sein. Es gibt zwar Hinweise auf eine punktuell beschränkte Kooperation, so hinsichtlich einer römischen Synode im März 769,[29] doch war dies die Ausnahme. Beide handelten machtbewusst und traten in eine Konkurrenz zueinander. Beide wurden wohl im gleichen Jahr (770) Väter und benannten ihren Sohn jeweils nach ihrem Vater Pippin. Offensichtlich wurde der Bruch, als Karlmann seinem Bruder 769 die Unterstützung gegen das aufständische Aquitanien verweigerte, wo sich Huno(a)ld gegen die karolingische Herrschaft erhoben hatte. Karl warf den Aufstand schließlich allein nieder, wobei Hunold in Gefangenschaft geriet,[30] und zog anschließend auch den Teil Aquitaniens ein, der formal Karlmann unterstand.[31]
In der Folgezeit nahmen die Spannungen zu. Bertrada versuchte zwar zwischen den verfeindeten Brüdern zu vermitteln,[32] doch verlor sie bald ihren Einfluss auf Karl. Dieser hatte zunächst in eine von seiner Mutter arrangierte Ehe mit einer namentlich unbekannten Langobardenprinzessin eingewilligt, wofür er sich von seiner ersten Frau Himiltrud trennte. Bertrada scheint ein umfassendes Bündnissystem angestrebt zu haben: Neben dem durch die Eheschließung bekräftigten Bündnis mit dem ehrgeizigen Langobardenkönig Desiderius umfasste ihr Plan auch Tassilo, der bereits mit einer anderen Tochter des Desiderius verheiratet war. Die Bedenken Papst Stephans III., der von der plötzlichen fränkisch-langobardischen Annäherung zutiefst beunruhigt war, versuchte sie zu entkräften.[33] Möglicherweise war auch Karlmann in das von Bertrada und wohl auch einigen fränkischen Großen forcierte neue Bündnissystem eingebunden; seine Ehefrau Gerberga ist vielleicht eine Verwandte des Desiderius gewesen.[34]
Karl änderte jedoch im Frühjahr 771 seine politischen Pläne und brach mit der Konzeption seiner Mutter. Seine langobardische Gemahlin sandte er zu Desiderius zurück, was für diesen ein Affront war. Stattdessen nahm Karl nun eine Alamannin namens Hildegard zur Frau. Dies musste Karlmann beunruhigen, denn Alamannien gehörte zu seinem Herrschaftsbereich, wo Karl nun offenbar Einfluss gewinnen wollte. Indem Karl alle Pläne seiner Mutter verwarf, handelte er erstmals erkennbar eigenständig.[35]
Eine offene Konfrontation zwischen Karl und Karlmann, die immer wahrscheinlicher geworden war, wurde durch den überraschenden Tod Karlmanns am 4. Dezember 771 verhindert. Karl übernahm unverzüglich die Macht im Reich des Verstorbenen, dessen Grooße ihm noch im Dezember 771 in Corbeny huldigten. Die Vermutung, Karl sei am Tod seines Bruders beteiligt gewesen, da er erheblich davon profitierte, wird nicht durch die Quellen gedeckt.[36] Die Behauptung, Karlmanns Andenken sei einer damnatio memoriae („Vernichtung des Andenkens“) zum Opfer gefallen,[37] trifft nicht zu; dass Karlmann nicht in Saint-Denis, sondern in Reims begraben wurde, geht sehr wahrscheinlich auf seinen eigenen Wunsch zurück.[38] Sicher ist, dass Karl nun uneingeschränkt im Frankenreich herrschte. Karlmanns Witwe Gerberga floh mit ihren Kindern zu Desiderius nach Italien.
Die Kaiserkrönung
Seit 795 war Leo III. Papst in Rom. Das Papsttum war in dieser Zeit unter den Einfluss des in diverse Fraktionen aufgesplitterten römischen Stadtadels geraten, der bei der Papstwahl ausschlaggebend war. Leo wurde unter anderem ein unwürdiger Lebenswandel vorgeworfen, vor allem aber verfügte er beim stadtrömischen Adel über keinerlei politischen Rückhalt, seine Lage wurde immer prekärer. Ende April 799 spitzte sich die Konfrontation zwischen dem Papst und dem Adel so zu, dass auf Leo ein Attentatsversuch unternommen wurde, hinter dem Vertraute des vorherigen Papstes Hadrian I. standen. Leo überlebte und flüchtete zu Karl nach Paderborn. Diese Vorgänge schildert das Paderborner Epos.[114]
Karl leistete Leo militärische Unterstützung und ließ ihn Ende 799 nach Rom zurückführen. Im Spätsommer des Jahres 800 begab sich Karl selbst nach Italien, Ende November erschien er in Rom. Dort kam es am 1. Weihnachtstag, dem 25. Dezember 800, in Alt St. Peter zur Kaiserkrönung Karls des Großen durch den Papst. Damit wurde eine äußerst wirkungsmächtige Entwicklung für das gesamte weitere Mittelalter in Gang gesetzt: die Übertragung der römischen Herrschaft auf die Franken (translatio imperii). Das römische Kaisertum im Westen, wo 476 der letzte Kaiser in Italien abgesetzt worden war, wurde durch die Krönung Karls erneuert. In diesem Zusammenhang spielten heilsgeschichtliche Aspekte eine wichtige Rolle; das römische Imperium galt als das letzte Weltreich der Geschichte (Vier-Reiche-Lehre). Nun existierte ein neues „römisches Kaisertum“, das an den Herrschaftsanspruch der antiken römischen Kaiser anknüpfte und in der Folgezeit erst von den Karolingern, dann seit den Liudolfingern (Ottonen) von den römisch-deutschen Königen beansprucht wurde. Ohne die Tragweite abschätzen zu können, legte Karl somit auch den Grundstein für das römisch-deutsche Kaisertum.[115] Dies sind die sicheren Fakten, doch sind wesentliche Details der Kaiserkrönung unklar.
Über den Vorgang der Kaiserkrönung liegen insgesamt vier Berichte vor: in den Lorscher Annalen, im Liber pontificalis, den Reichsannalen und bei Einhard.[116] Im Kern wird dort die Schutzfunktion Karls gegenüber der Kirche und dem Papst gelobt. Das Volk sei begeistert gewesen und die Kaiserkrönung eher als spontane Handlung erfolgt. Einhard behauptet sogar, dass Karl die Kirche nicht betreten hätte, wenn er von Leos Vorhaben gewusst hätte.[117]
Diese Schilderungen werden in der modernen Forschung jedoch als unzutreffend betrachtet.[118] Es gilt als ausgeschlossen, dass die Vorbereitungen unbemerkt ablaufen konnten, dass Karl am Weihnachtstag der Kirche hätte fernbleiben können und dass eine von ihm nicht gewollte Krönung durchführbar war. Vielmehr war es Karl selbst, der seit einiger Zeit gezielt auf die Kaiserkrönung und die Erneuerung des römischen Kaisertums im Westen hingearbeitet hatte.[119] Der Papst wirkte zwar als Koronator, befand sich aber in einer äußerst schwachen Position und war ganz von Karls Unterstützung abhängig. Als Kaiser übernahm Karl denn auch die Rolle des Richters über Leos römische Gegner.
Die Schaffung des westlichen Kaisertums wurde von mehreren Faktoren begünstigt. Im Osten existierte weiterhin das Reich der Byzantiner, die sich „Rhomäer“ (Römer) nannten und auf eine ununterbrochene staatliche Kontinuität zum spätantiken Römerreich zurückblicken konnten. Im Jahr 800 herrschte dort jedoch mit Kaiserin Irene eine Frau (was man im Westen abwertend betrachtete), die mit zahlreichen innenpolitischen Problemen zu kämpfen hatte. Aus karolingischer Perspektive wurde das sogenannte „Kaisertum der Griechen“ – eine für die Byzantiner provozierende Bezeichnung – berücksichtigt, aber abwertend beurteilt; es wurde sogar eine angebliche Übertragung des Kaisertums von Byzanz auf Karl konstruiert. In Byzanz hingegen betrachtete man Karl schlicht als Usurpator und hielt den exklusiven Anspruch auf das „römische“ Kaisertum aufrecht. Erst 812 kam es zu einer Verständigung hinsichtlich des Zweikaiserproblems.[120] Die Kaiserkrönung des Jahres 800 war auch heilsgeschichtlich bedeutsam, da Endzeiterwartungen verbreitet waren, die mit dem römischen Reichsgedanken verbunden waren.[121] In einer Zeit, in der das Religiöse ganz entscheidend das Denken bestimmte, erhielt die Kaiserkrönung so eine eschatologische Komponente.
..mehr unter dem obenstehenden Link
Tod und Nachfolge
Der sogenannte Quadrigastoff (Musée national du Moyen Âge, Paris), ein byzantinisches, wohl gegen Ende des 8. Jahrhunderts hergestelltes Samitgewebe, gehörte vermutlich zu den bei Karls Begräbnis verwendeten Leichentüchern.[231]
Am 28. Januar 814 starb Karl der Große in Aachen. Einhard berichtet, dass sich der ansonsten gute Gesundheitszustand des Kaisers in seinen letzten Jahren verschlechtert habe.[232] Ende Januar 814 litt Karl plötzlich unter einem hohen Fieber, hinzu kamen Schmerzen in der Seite;[233] möglicherweise handelte es sich dabei um eine Rippenfellentzündung.[234] Karl fastete und glaubte, so die Krankheit auskurieren zu können, doch verstarb er kurz darauf und wurde in der Aachener Pfalzkapelle beigesetzt. Ob er schon damals in dem sogenannten Proserpina-Sarkophag beigesetzt wurde, ist umstritten.[235] Der genaue Ort der ursprünglichen Grablege in oder an der Pfalzkapelle ist unbekannt.[236] Dem Bericht Einhards zufolge stellte man über dem Grab einen vergoldeten Arkadenbogen mit einem Bildnis Karls und einer Inschrift auf.[237]
Proserpina-Sarkophag, ehemals Grablege Karl des Großen, Aachener Domschatzkammer
Seit 810 hatte Karl unter Fieberanfällen gelitten,[238] im folgenden Jahr hatte er sein persönliches Testament gemacht.[239] Angesichts seines sich verschlechternden Gesundheitszustands war er in seinen letzten Jahren um das Wohl des Reiches besorgt.[240] Er hatte bereits frühzeitig Vorkehrungen für den Fall seines Todes getroffen. 806 hatte er in einem politischen Testament einen Reichsteilungsplan verfasst, die sogenannte Divisio Regnorum. Nachdem aber seine beiden älteren Söhne verstorben waren, hatte Karl im September 813 auf einem Hoftag seinen Sohn Ludwig, seit 781 Unterkönig in Aquitanien, zum Mitkaiser erhoben und dabei (wohl nach dem byzantinischen Vorbild)[241] auf eine Beteiligung des Papstes verzichtet. Vater und Sohn standen sich nicht besonders nahe, doch Ludwig war der letzte verbliebene Sohn aus Karls Ehe mit Hildegard und somit der nächste legitime Anwärter.[242] All dies lässt erkennen, dass Karl sehr darum bemüht war, einen möglichst reibungslosen Übergang zu sichern.[243] Allerdings sollte die Reichseinheit in der Regierungszeit Ludwigs aufgrund innerer Konflikte doch zerbrechen. Dies führte zur Entstehung des West- und des Ostfrankenreichs, den „Keimzellen“ der späteren Länder Frankreich und Deutschland.
Ehen und Nachkommen
Ausschnitt aus der Kemptener Klosterchronik von 1499: Hildegard ist gemeinsam mit Karl dem Großen rechts als Begüterin und Gründerin des Kemptener Klosters abgebildet.
Karl war sicher viermal verheiratet, eventuell handelte es sich auch um fünf Ehen.[244] Hochzeiten des Hochadels waren in erster Linie politische Verbindungen. Über die Herkunft von Karls erster Ehefrau Himiltrud ist allerdings nichts bekannt. Sie schenkte Karl einen Sohn, der den Leitnamen Pippin erhielt. Pippin, der sich offenbar innerhalb der Rangfolge im Reich zurückgesetzt sah, erhob sich 792 erfolglos gegen Karl. Er wurde anschließend in der Abtei Prüm inhaftiert und starb 811. Karls zweite Ehefrau war die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius; ihr richtiger Name ist unbekannt, in der Forschung wird oft Desiderata angegeben. Diese Heirat erfolgte im Rahmen der Pläne von Karls Mutter Bertrada, doch Karl verstieß seine langobardische Ehefrau 771.
Stattdessen heiratete er kurz danach die sehr junge Hildegard, die aus dem alemannischen Hochadel stammte. Sie gebar ihm insgesamt neun Kinder, vier Jungen (Karls späteren Nachfolger Ludwig sowie Karl, den als Kleinkind verstorbenen Lothar und einen weiteren Sohn namens Pippin) und fünf Mädchen (Rotrud, Bertha, Gisela und die zwei als Kleinkinder verstorbenen Adalhaid und Hildegard). Karls Ehe mit Hildegard und die Königin selbst werden in den Quellen besonders positiv hervorgehoben. Karl war Hildegard besonders zugetan; sie begleitete ihren Mann auf mehreren Reisen und wird in einer Urkunde völlig untypisch sogar als dulcissima coniux („allersüßeste Gattin“) bezeichnet.[245] Sie starb 783.
Darstellung Karls des Großen in der Chronik des Ekkehard von Aura um 1112/14, Cambridge, Corpus Christi College, Ms. 373, fol. 24r
Nach nur kurzer Trauerzeit heiratete Karl im Herbst 783 Fastrada. Aus dieser Ehe stammten Theodrada und die jung verstorbene Hiltrud. Entgegen den eher negativen Aussagen Einhards[246] wird Fastrada in der Forschung durchaus positiv betrachtet; Karl selbst war ihr offenbar auch eng verbunden.[247] Fastrada erkrankte 794 und verstarb im selben Jahr. Kurz darauf ging Karl womöglich eine fünfte und letzte Ehe mit Luitgard ein, die 800 starb. Es geht allerdings aus den Quellenzeugnissen nicht eindeutig hervor, dass es sich um eine reguläre Ehe handelte.[248] An ihrer Machtstellung am Hof Karls besteht jedoch kein Zweifel.[249]
Neben seinen kirchlich legitimen Verbindungen hatte Karl zahlreiche Nebenfrauen. Namentlich bekannt sind etwa Madelgard, Gerswind, Regina und Adelind.[250] Dies war mit kirchlichen Normen nicht vereinbar und passte nicht zu den Erwartungen an einen christlichen Kaiser, doch war ein solches Verhalten nicht ohne Beispiel. Das Konkubinat spielte bereits in merowingischer Zeit eine nicht unwichtige Rolle. Das zeitgenössische weltliche Recht und teils sogar das Kirchenrecht um 800 bot zudem Freiräume hinsichtlich des Ehelebens.[251] Dennoch stand Karls Verhalten grundsätzlich im Gegensatz zu kirchlichen Erwartungen.[252] Mit den Nebenfrauen zeugte Karl mehrere weitere Kinder (so unter anderem Drogo von Metz und Hugo), die aber keine legitimen Erben waren.
Seinen Töchtern brachte Karl besondere Zuneigung entgegen.[253] In einem 791 verfassten Brief bezeichnete er sie als dulcissimae filiae, seine „allersüßesten Töchter“.[254] Während die Söhne vor allem militärisch-politisch ausgebildet wurden und sich schon in jungen Jahren fern vom Hof aufhielten (in den Quellen gibt es auch Hinweise auf teils homoerotische Beziehungen von Karls gleichnamigem Sohn, Karl dem Jüngeren),[255] erhielten seine Töchter eine recht umfassende Bildung. Karl achtete darauf, dass sich niemand durch Einheirat in die Familie einen politischen Vorteil verschaffen konnte, weshalb er seine Töchter hauptsächlich am Hof behielt.[256] Er ließ ihnen aber in ihrer Lebensführung erheblichen Freiraum; in den Quellen werden teils die Liebschaften der Töchter kritisiert. Bertha beispielsweise unterhielt eine Affäre mit Angilbert und bekam zwei Söhne, darunter den späteren Geschichtsschreiber Nithard. Nach Karls Tod setzte sein stärker an kirchlichen Normen orientierter Nachfolger Ludwig dieser Nachsicht ein Ende.
Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Große
Wie oft war Karl der Große verheiratet – und mit wem?
Karl der Große war fünf Mal verheiratet. Die Damen hießen Himiltrud, Desiderata, Hildegard, Fastrada und Liutgard. Die Ehe mit Himiltrud war eine so genannte Friedelehe, die anderen vier Ehen entsprachen den seiner Zeit in Adelskreisen üblichen Muntehen.
Neben diesen fünf Ehen, hatte Karl eine stattliche Anzahl weiterer Verhältnisse mit Geliebten und/oder Mätressen. Auch aus diesen Verbindungen gingen Kinder hervor.
Autor: Manfred Zorn
Zitat aus: http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/karolinger/karl-der-grosse-familie/1194-wie-oft-war-karl-der-grosse-verheiratet-und-mit-wem.html
Wie viele Kinder hatte Karl der Große?
In der Summe werden Karl achtzehn Kinder nachgesagt. Ein neunzehntes Kind namens Roland, stammte aus der inzestuösen Beziehung zu seiner Schwester Adalhaid – worüber am Hof von den wenigen, die davon Kenntnis hatten, allerdings absolutes Schweigen verlangt wurde.
Zitat aus: http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/karolinger/karl-der-grosse-familie/1193-wie-viele-kinder-hatte-karl-der-grosse.html
Wer waren die Kinder Karls des Großen aus der Ehe mit Fastrada?
Aus der Verbindung Karls des Großen mit Fastrada, stammen die Töchter Theodrada (etwa *785 bis °853) und Hiltrud (etwa *787 bis °814).
Während über Hiltrud nichts weiter bekannt zu sein scheint, ist in den Annalen festgehalten, dass Theodrada ab 814 Äbtissin des Klosters Argenteuil im Nordwesten Frankreichs war.
Autor: Manfred Zorn
Zitat aus: http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/karolinger/karl-der-grosse-familie/1184-wer-waren-die-kinder-karls-des-grossen-aus-der-ehe-mit-fastrada.html
Gestorben:
„Ende Januar 814 litt Karl plötzlich unter einem hohen Fieber, hinzu kamen Schmerzen in der Seite; möglicherweise handelte es sich dabei um eine Rippenfellentzündung. Karl fastete und glaubte, so die Krankheit auskurieren zu können, doch verstarb er kurz darauf und wurde in der Pfalzkapelle beigesetzt.“
Karl heiratete Himiltrud N. in vor 767. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Desiderata ? (Langobardin) in vor 768. Desiderata wurde geboren in vor 754; gestorben in nach 771. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Kaiserin Hildegard (Alemannin) (Geroldonen) in 771. Hildegard (Tochter von Gerold I. von Anglachgau (Geroldonen) und Imma (Hemma) (Alemannin)) wurde geboren in cir 758; gestorben am 30 Apr 783 in Diedenhofen an der Mosel. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Fastrade von Franken in Okt 783. Fastrade wurde geboren in cir 765; gestorben am 10 Aug 794; wurde beigesetzt in Stift St. Alban vor Mainz. [Familienblatt] [Familientafel]
Karl heiratete Luitgard aus Alemannien in vor 796. Luitgard gestorben am 4 Jun 800 in Kloster Saint-Martin in Tours,. [Familienblatt] [Familientafel]
|

 Bathilde von Askanien wurde geboren in cir 630 in England; gestorben am 30 Jan 680 in Kloster Chelles; wurde beigesetzt in Église Sainte-Croix.
Bathilde von Askanien wurde geboren in cir 630 in England; gestorben am 30 Jan 680 in Kloster Chelles; wurde beigesetzt in Église Sainte-Croix.  König Childerich II. Austrasien (Merowinger)
König Childerich II. Austrasien (Merowinger)  Childebert III. von Neustrien (Merowinger)
Childebert III. von Neustrien (Merowinger)  Dagobert (Merowinger)
Dagobert (Merowinger)  König Chilperich II. (Daniel) Merowinger
König Chilperich II. (Daniel) Merowinger  Königin Bertrada von Laon, die Jüngere
Königin Bertrada von Laon, die Jüngere  König Theuderich IV. Merowinger
König Theuderich IV. Merowinger 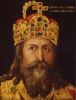 Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne
Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne  König Karlmann I. (Karolinger)
König Karlmann I. (Karolinger)